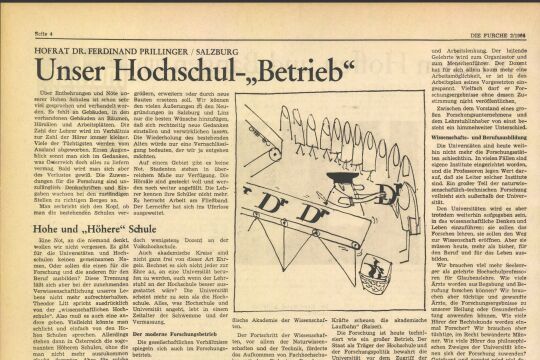Eine Tagung an der Universität Wien bestätigt den Befund: Frauen sind in akademischenSpitzenpositionen noch unterrepräsentiert. Doch Quotenregelungen und Fördermaßnahmen brechen langsam die traditionellenStrukturen an den Universitäten auf.
Als erste Hochschule des Landes öffnete die Universität Wien vor 113 Jahren ihre Pforten weiblichen Studierenden. Den Anfang machte die Philosophische Fakultät, die übrigen Fakultäten zogen nach, als Schlusslicht die Katholisch-Theologische Fakultät im Jahr 1945. Heute sind Frauen zumindest quantitativ an der Uni eine Selbstverständlichkeit, stoßen in der wissenschaftliche Karriere doch an Grenzen, wie eine Tagung bestätigte.
Seit einigen Jahren stellen Frauen mehr als die Hälfte der Studienanfänger, Studierenden und Absolventen. Doch der Frauenanteil sinkt, je höher man auf der akademischen Karriereleiter nach oben blickt – ein als „leaky pipeline“ bekanntes Phänomen. Weniger als ein Fünftel der Professorenschaft ist weiblich, Rektorinnen gibt es an staatlichen Universitäten keine, an Privatuniversitäten zwei.
Noch schlimmer sieht es in der „Gelehrtengesellschaft“ der Akademie der Wissenschaft aus. Hier sind nur zehn der 169 „wirklichen Mitglieder“ Frauen. Und auch dem Kriterium wissenschaftlicher „Exzellenz“ scheint Frau nicht zu genügen. So sind drei der 25 seit 1996 vom FWF gekürten Wittgenstein-Preisträger Frauen – zuletzt wurde es Renée Schroeder, 2003. Die für Nachwuchsforscher vergebenen START-Preise gingen heuer erstmals zur Hälfte an Frauen.
Gesetz zwingt zu Maßnahmen
Dieses Missverhältnis wird von der Politik immerhin als Problem wahrgenommen und sie versucht, bewusst gegenzusteuern. So mussten alle Unis mit dem Universitätsgesetz 2002 Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen einrichten. Das sind als Anlaufstellen für von Diskriminierung (auch religiöser, ethnischer oder sonstiger Art) betroffene Personen. Jede Uni muss einen Frauenförderungsplan vorweisen. Dies wird künftig in die Leistungsvereinbarungen zwischen Universität und Wissenschaftsministerium einfließen.
Mit der im vergangenen Herbst in Kraft getretenen UG02-Novelle ist außerdem eine 40-prozentige Frauenquote für Rektorat, Universitätsrat, Senat, Habilitations-, Berufungs- und Curricularkommissionen gefordert. Daneben gibt es zahlreiche Förderschienen für Frauen in der Wissenschaft. Derlei Maßnahmen, so unverzichtbar sie sind, ersetzen nicht die Ursachenforschung. An welchen institutionellen Schnittstellen die Flaschenhälse liegen und wie diese konkret funktionieren, ist leider nur sehr schwer zu beantworten. Den klassischen akademischen Patriarchen, für den weibliche Kollegen ein Unding wider die Natur sind, gibt es nämlich kaum noch. „Die Ausgrenzungsmechanismen basieren auf impliziten, unterschiedlichen Rollenverständnissen von Frauen und Männern“, sagt Sylwia Bukowska, Leiterin der Abteilung Frauenförderung und Gleichstellung der Uni Wien. „Diese Unterschiede durchziehen die gesamte Universitätskultur.“
Eine besondere Hürde stellen die Berufungsverfahren dar. Die Ausgrenzung zeigt sich nicht explizit, wohl aber im Bewerbungsgespräch: „Frauen werden oft andere Fragen gestellt als Männern“, sagt Sylwia Bukowska. „Zum Beispiel nach ihrem Privatleben oder der Familienplanung, obwohl das nicht zulässig ist.“ Zudem sind die Entscheidungsgremien mehrheitlich männlich besetzt. Dabei kommt häufig das Phänomen der „homosozialen Kooptierung“ zum Tragen, also die unbewusste Neigung, sich mit gleichartigen Personen zu umgeben. „Ein männlicher Bewerber, der noch nicht habilitiert ist, gilt als entwicklungsfähig“, meint Richard Gamauf, Vorsitzender des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen der Universität Wien, aber:. „Bei einer Frau sagt man, sie war nicht ehrgeizig genug.“
Im Rahmen der vorvergangene Woche an der Universität Wien abgehaltenen Tagung „Geschlecht und Wissenschaft“ fragte Ada Pellert, Gründungspräsidentin der Universität für Weiterbildung in Berlin, was Frauen benötigen, um Professorin zu werden. Sie rät dazu, sich auf harte Konkurrenzkämpfe vorzubereiten. Dafür sei es nötig, rechtzeitig strategische Netzwerke zu knüpfen. „Wissenschaft basiert weniger auf Kooperation, als auf der Expertise von Individuen“, meint Pellert. „Man muss sich Kanäle suchen, in denen man ohne falsche Bescheidenheit zeigen kann, dass man Experte ist.“ Vielleicht noch stärker als Frauen in der Privatwirtschaft trifft Wissenschaftlerinnen das Problem der Vereinbarkeit von Job und Familie. Denn die Phase der Familienplanung korreliert ungünstig mit den für den Karriereweg entscheidenden Jahren nach der Dissertation. Erschwerend kommt hinzu, dass das universitäre Arbeitsrecht eine langfristige Karriereplanung erschwert – unbefristete Dienstverträge gibt es für den Mittelbau nicht. Wer nach spätestens sechs Jahren keine Professur erhält, darf nicht erneut angestellt werden.
Dominierender Mythos Mann
Zu hinterfragen ist auch der Universitäten zugrundeliegende Leistungsbegriff.
Wissenschaft wird selten als ein Beruf unter anderen gesehen, sondern gerne zur Berufung verklärt. Es dominiert der Mythos vom Wissenschaftler, der 80 Stunden pro Woche arbeitet, der eine gelungene Mischkulanz aus kreativem Genie und niemals ermüdendem Roboter ist. Für Freizeit oder Familie bleibt da keine Zeit, entsprechend unattraktiv ist dieser Entwurf für viele Frauen (übrigens zunehmend auch für Männer).
Dieses Leitbild ist eine Folge davon, dass die Globalisierung längst wissenschaftliche Institutionen erreicht hat. Wer sich mit Harvard, Princeton und Co. messen möchte, womöglich gar mittels Rankings und Kennzahlen, kann schwächelnde Wissenschaftler mit Familienwunsch kaum gebrauchen.
Solche Rahmenbedingungen sind nicht optimal geeignet, um bestehende Strukturen der Geschlechterrollen aufzubrechen.
Wie es weitergeht? Nächstes Jahr stehen in Österreich etliche Rektorswahlen an. Spätestens dann wird sich zeigen, ob gutem Willen auch gute Taten folgen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!