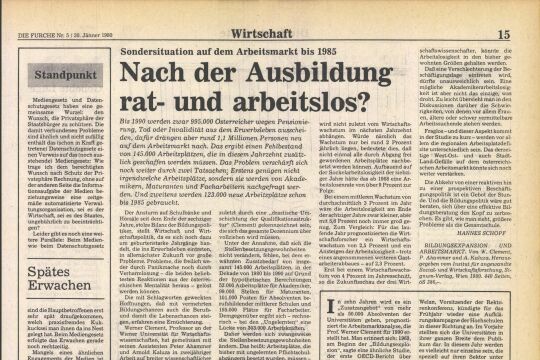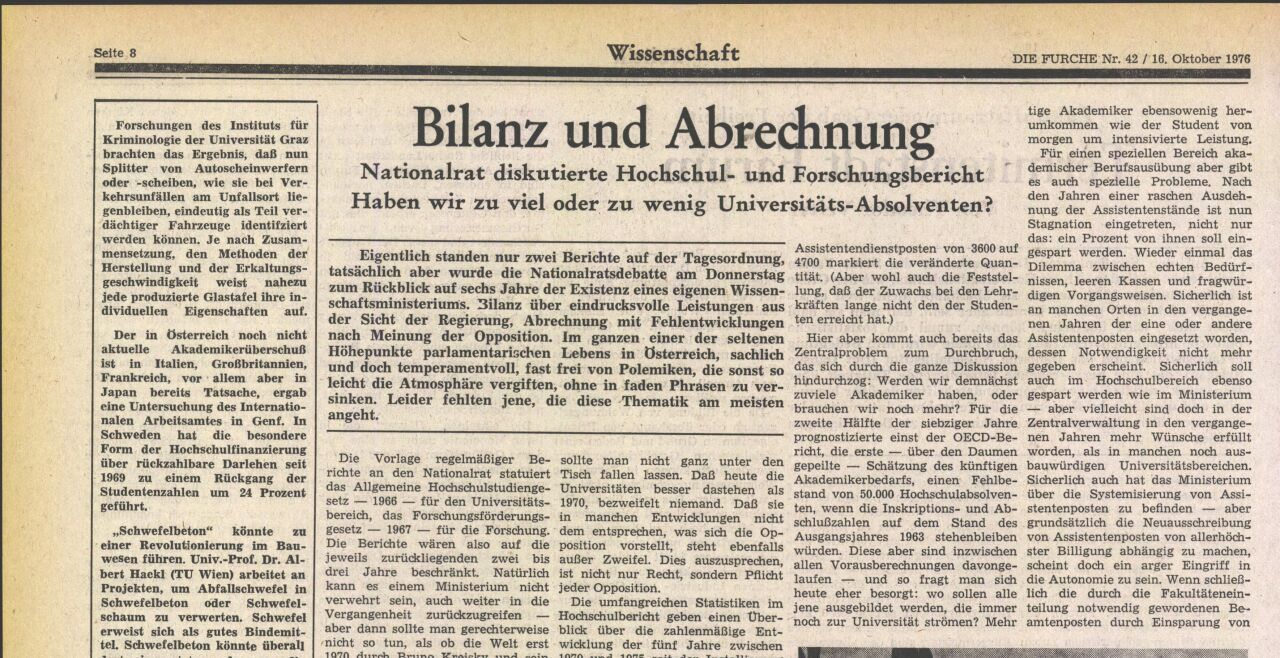
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Bilanz und Abrechnung
Eigentlich standen nur zwei Berichte auf der Tagesordnung, tatsächlich aber wurde die Nationalratsdebatte am Donnerstag zum Rückblick auf sechs Jahre der Existenz eines eigenen Wissenschaftsministeriums. 3ilanz über eindrucksvolle Leistungen aus der Sicht der Regierung, Abrechnung mit Fehlentwicklungen nach Meinung der Opposition. Im ganzen einer der seltenen Höhepunkte parlamentarischen Lebens in Österreich, sachlich und doch temperamentvoll, fast frei von Polemiken, die sonst so leicht die Atmosphäre vergiften, ohne in faden Phrasen zu versinken. Leider fehlten jene, die diese Thematik am meisten angeht.
Eigentlich standen nur zwei Berichte auf der Tagesordnung, tatsächlich aber wurde die Nationalratsdebatte am Donnerstag zum Rückblick auf sechs Jahre der Existenz eines eigenen Wissenschaftsministeriums. 3ilanz über eindrucksvolle Leistungen aus der Sicht der Regierung, Abrechnung mit Fehlentwicklungen nach Meinung der Opposition. Im ganzen einer der seltenen Höhepunkte parlamentarischen Lebens in Österreich, sachlich und doch temperamentvoll, fast frei von Polemiken, die sonst so leicht die Atmosphäre vergiften, ohne in faden Phrasen zu versinken. Leider fehlten jene, die diese Thematik am meisten angeht.
Die Vorlage regelmäßiger Berichte an den Nationalrat statuiert das Allgemeine Hochschulstudiengesetz — 1966 — für den Universitätsbereich, das Forschungsförderungs-gesetz — 1967 — für die Forschung. Die Berichte wären also auf die jeweils zurückliegenden zwei bis drei Jahre beschränkt. Natürlich kann es einem Ministerium nicht verwehrt sein, auch weiter in die Vergangenheit zurückzugreifen — aber dann sollte man gerechterweise nicht so tun, als ob die Welt erst 1970 durch Bruno Kreisky und sein Team erschaffen worden wäre. Auch Hertha Firnberg konnte auf dem aufbauen, was zwanzig Jahre vorher Hurdes und Kolb an Wiederaufbau geleistet, Drimmel an ersten Durchbrüchen erzielt, Piffl an neuer Konzeption beigetragen hatten. Dies sollte man nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Daß heute die Universitäten besser dastehen als 1970, bezweifelt niemand. Daß sie in manchen Entwicklungen nicht dem entsprechen, was sich die Opposition vorstellt, steht ebenfalls außer Zweifel. Dies auszusprechen, ist nicht nur Recht, sondern Pflicht jeder Opposition.
Die umfangreichen Statistiken im Hochschulbericht geben einen Überblick über die zahlenmäßige Entwicklung der fünf Jahre zwischen 1970 und 1975 seit der Installierung des neuen Ministeriums. Schon der Vergleich der Zahlen der studierenden Inländer — 43.000 für 1970, 62.000 für 1974 — (inzwischen dürfte ihre Zahl bei 80.000 liegen), das Ansteigen der Zahl der Professoren-Dienstposten von 900 auf 1100, der Assistentendienstposten von 3600 auf 4700 markiert die veränderte Quantität. (Aber wohl auch die Feststellung, daß der Zuwachs bei den Lehrkräften lange nicht den der Studenten erreicht hat.)
Hier aber kommt auch bereits das Zentralproblem zum Durchbruch, das sich durch die ganze Diskussion hindurchzog: Werden wir demnächst zuviele Akademiker haben, oder brauchen wir noch mehr? Für die zweite Hälfte der siebziger Jahre prognostizierte einst der OECD-Bericht, die erste — über den Daumen gepeilte — Schätzung des künftigen Akademikerbedarfs, einen Fehlbestand von 50.000 Hochschulabsolventen, wenn die Inskriptions- und Abschlußzahlen auf dem Stand des Ausgangs Jahres 1963 stehenbleiben würden. Diese aber sind inzwischen allen Vorausberechnungen davongelaufen — und so fragt man sich heute eher besorgt: wo sollen alle jene ausgebildet werden, die immer noch zur Universität strömen? Mehr noch: wo sollen sie alle untergebracht werden, wenn sie in fünf, sechs, sieben Jahren die Universität mit dem Diplom verlassen?
Erst Ministerin Firnberg gebrauchte in ihrem Resümee das Reizwort „Numerus clausus“. Keiner der Oppositionssprecher hatte ihn gefordert, wohl wissend, daß er keinen Ausweg bietet. Also unbegrenzten Zugang zur Hochschule? Grundsätzlich ja, das wird von allen bestätigt. Aber auch heute gibt es bereits Eingangsbarrieren, die schon relativ früh die Spreu vom Weizen sondern, etwa die früher als „Knochenkolloquium“ apostrophierte erste Prüfung der angehenden Mediziner.
Aber für die, die durchkommen
—wie stehen für sie die Chancen? Natürlich wären Kalkulationen schön, mit denen man sich ausrechnen könnte, wo sie einst unterkommen werden. Aber nicht nur das Ministerium ist bis jetzt diese Aussage schuldig geblieben.
Natürlich sollte das Gebot der Arbeitsplatzsicherung, heute so hochgehalten, auch für den Akademiker gelten. Natürlich wäre es wünschenswert, das, was man auf der Hochschule mitbekommen hat, auch praktisch — nicht nur als Bildungshilfe — im Beruf ausnützen zu können. Aber — das sagte Abg. Blenk
—Hochschulbildung allein wird in Zukunft weniger als bisher Karriere-und soziale Aufstiegsgarantie bieten können. Um die Bewährung im Beruf, härter als bisher, wird der künftige Akademiker ebensowenig herumkommen wie der Student von morgen um intensivierte Leistung.
Für einen speziellen Bereich akademischer Berufsausübung aber gibt es auch spezielle Probleme. Nach den Jahren einer raschen Ausdehnung der Assistentenstände ist nun Stagnation eingetreten, nicht nur das: ein Prozent von ihnen soll eingespart werden. Wieder einmal das Dilemma zwischen echten Bedürfnissen, leeren Kassen und fragwürdigen Vorgangsweisen. Sicherlich ist an manchen Orten in den vergangenen Jahren der eine oder andere Assistentenposten eingesetzt worden, dessen Notwendigkeit nicht mehr gegeben erscheint. Sicherlich soll auch im Hochschulbereich ebenso gespart werden wie im Ministerium — aber vielleicht sind doch in der Zentralverwaltung in den vergangenen Jahren mehr Wünsche erfüllt worden, als in manchen noch ausbauwürdigen Universitätsbereichen. Sicherlich auch hat das Ministerium über die Systemisierung von Assistentenposten zu befinden — aber grundsätzlich die Neuausschreibung von Assistentenposten von allerhöchster Billigung abhängig zu machen, scheint doch ein arger Eingriff in die Autonomie zu sein. Wenn schließlich die durch die Fakultäteneinteilung notwendig gewordenen Beamtenposten durch Einsparung von Assistenten geschaffen werden sollen, dann gäbe es wohl keinen schlagenden Beweis dafür, wie politische Versicherungen in die Wirklichkeit münden: das UOG sei ohne wesentliche Personalausweitung durchzuführen, hieß es mehrfach!
ÖVP-Sprecher Busek brachte erneut die Forderung nach einer Bildungspartnerschaft zur Sprache. Politik, Verwaltung, Universitäten, ihre ständischen Gruppen, aber auch die Wirtschaft — Arbeitnehmer- wie Arbeitgebervertretungen — sollten zusammenwirken, um alle diese Probleme, vor allem jenes des drohenden Überflusses an Absolventen, in den Griff zu bekommen. Der Akademische Rat, unter Drimmel erstmals gegründet, unter Piffl mehrfach einberufen, nun durch das UOG in sozialpartnerschaftlicher Form neukonzipiert, wäre ein mögliches Gremium.
Bildungspartnerschaft aber setzt nicht nur voraus, daß die Politiker die Anliegen der Wissenschafter zur Kenntnis nehmen. Zu ihr gehört auch, daß die Wissenschafter an „ihrer“ Politik Anteil nehmen — nicht zuletzt durch ihre Anwesenheit bei den wenigen sie betreffenden Parlamentsdebatten. Diesmal saß Rektor Seiteiberger stellvertretend für 1300 Professoren und 5000 Assistenten in der sonst leeren Bundesratsloge. Lag es nur an der mangelhaften Information über die Tagesordnung des Nationalrates?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!