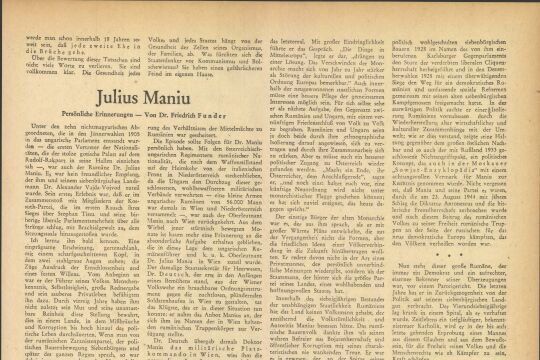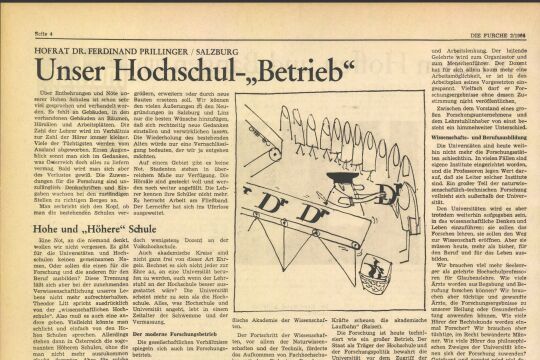Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Unruhe im „Mittelbau”
Wieder konstituiert sich eines jener vom Universitäts-Organisationsgesetz (UOG) vorgesehenen Gremien, das Standesinteressen koordinieren, Vorschläge erarbeiten, mitreden und vor allem Vertreter in eine weitere Versammlung schicken soll, wo dann weiterreichende Beschlüsse gefaßt werden können - die Bundeskonferenz des wissenschaftlichen Personals. In diese 36köpfige Interessenvertretung für den „akademischen Mittelbau” - dazu gehören alle Universitäts- und Hochschuldozenten, habilitierte und nicht habilitierte Assistenten, Vertrags- und Studienassistenten, Lektoren und Instruktoren, aber auch Demonstratoren und Tuto ren-entsendet jede Universität und Kunsthochschule Österreichs je zwei auf zwei Jahre gewählte Vertreter.
Wenige Tage vor der Konstituierung trat der Assistentenverband an die Öffentlichkeit und zeigte sich beunruhigt über die Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses an den Universitäten Österreichs. Der Vorsitzende, Dipl.- Ing. Dr. Gerhard Windischbauer von der Veterinärmedizinischen Universität, präsentierte das Ergebnis einer Umfrage, an der sich immerhin mehr als 20 Prozent der österreichischen Universitätsassistenten beteiligt hatten. Er faßte zusammen:
„Der Universitätsassistent beginnt seine Laufbahn stark forschungsmotiviert, doch führt das starke Engagement in der wissenschaftlichen Lehre dazu, daß bald der Wunsch nach mehr Zeit für Forschung und selbständige wissenschaftliche Arbeit wächst. Seine Hauptsorgen sind die berufliche Unsicherheit und die Abhängigkeit, obwohl er sonst mit seiner Tätigkeit sehr zufrieden wäre. Seine Karrieremöglichkeiten beurteilt er sehr schlecht. Nur etwa die Hälfte findet gute Abgangschancen vor. Dementsprechend richtet sich seine Kritik gegen die zu späte Entscheidung über seine berufliche Laufbahn.”
Vier Tatsachen beunruhigen die Assistenten derzeit besonders:
• die angespannte wirtschaftliche Situation,
• das in den vergangenen Jahren relativ tief eingependelte Durchschnittsalter der Universitätsprofessoren,
• die weiter steigenden Studentenzahlen,
• die Diskussionsgrundlage eines
Gesetzentwurfes für ein neues Hochschullehrer-Dienstrecht.
Die Ebbe in der Staatskasse hat bereits zu einer Reduzierung der Assi- stentenposįpn auf 4126 für 1977 geführt. Zum ‘i eiftielcn: Von *969 bis 1976 kletterte die Zahl der Assistenten von 3253 auf 4242! Unter diesen Umständen sind auch für bestens qualifizierte Hochschulabsolventen die Chancen, die wissenschaftliche Laufbahn einschlagen zu können, minimal, sie werden durch die vermehrte Akademikerproduktion der Universitäten immer geringer.
Die „Verjüngungskur” der Professoren auf ein Durchschnittsalter von 42 Jahren räumt natürlich den Assistenten kaum mehr Chancen ein, einmal selbst eine Lehrkanzel zu bekommen, da nun ein Universitätsprofessor einige Generationen von Assistenten „überleben” kann. Außerdem werden naturgemäß bei der Neubesetzung einer Professur oft Kandidaten aus dem Ausland, darunter heimkehrwillige Österreicher, bevorzugt.
Mit der ständig wachsenden Zahl der Studenten an Universitäten und Kunsthochschulen - es sind bereits an die 90.000 in Österreich - ist für die Assistenten, die ja zur Zeit weniger werden, mehr Zeitaufwand für Lehrtätigkeit und weniger Gelegenheit zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit verbunden. Ohne den Mittelbau, der nach einer Erhebung in neun österreichischen Universitäten 71 Prozent der Lehrveranstaltungen hält (Assistenten 61, Lektoren 10 Prozent), ist ein funktionierender Lehrbetrieb völlig undenkbar.
Zunehmender Arbeitsaufwand, sinkende Karrierehoffnungen - kann das neue Hochschullehrer-Dienstrechtgesetz eine Verbesserung bringen? Die Assistenten Vertreter lehnen jedenfalls die Diskussionsgrundlage des Bundeskanzleramtes schärfstens ab. Sie sieht vor, die Verwendungszeit von Hochschulassistenten rigoros mit zehn, für einzelne Fächer mit zwölf Jahren zu begrenzen, wogegen habilitierte Assistenten bisher auf Dauer übernommen werden konnten. Nun müßte der junge Wissenschafter am Ende dieser Zeit entweder schon Professor sein, ganz von der Hochschule abgehen oder er könnte, sofern die vorgesehene „sinnvolle stellenplanmäßige Steuerung” ihm diese Stellung ermöglicht, als weisungsgebundener wissenschaftlicher Beamter seine Laufbahn fortsetzen.
Nach Ansicht der Assistenten sollte dagegen spätestens nach sechs Jahren die Übernahme in ein ständiges Dienstverhältnis oder der Abgang von der Universität erfolgen. Nach zehn Dienstjahren ist ein Assistent im Durchschnitt 36 Jahre alt. Ihn dann noch außerhalb der Universität eine entsprechende Anstellung suchen zu lassen, stellt zweifellos eine echte soziale Härte dar, zumal seine speziellen Qualifikationen für die Anstellungser- fordemisse in kaum einem Beruf ausreichen und Dienstzeiten selten angerechnet werden. So darf etwa ein ehemaliger Physik-Assistent einer Technischen Universität zwar sofort an einer Höheren Technischen Lehranstalt Physik unterrichten, aber nicht an einem Gymnasium oder Realgymnasium. Für einen Physik-Assistenten einer früheren Philosophischen Fakultät kommt beides nicht in Betracht. Dazu müßte nicht nur die pädagogische, was die Assistenten noch akzeptieren würden, sondern auch die fachliche Lehramtsprüfung für allgemein- bildende höhere Schulen nachgeholt werden. Die Assistenten fordern daher eine bessere Vorbereitung auf eine spätere außeruniversitäre Tätigkeit und das Fallen unnötiger Anstellungs- erfordemisse.
Hauptwunsch des Assistentenverbandes ist ein umfassendes „Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses”, auf mindestens 15 Jahre konzipiert, das dem Mehrbedarf an Arbeitsmöglichkeiten Rechnung trägt. Zur Finanzierung werden Mittel aus der zur Diskussion stehenden Forschungsförderung vorgeschlagen. Das neue Dienstrecht soll die Durchführung dieses Programmes ermöglichen.
Ging es den Assistenten mit ihrer Stellungnahme in erster Linie zweifellos um eine standespolitische Aktion, um mehr Aufmerksamkeit für ihre eigenen Anliegen, so wurde dabei doch wesentlich mehr deutlich: die Problematik der gegenwärtigen Bildungspolitik allgemein und die möglichen Folgen in der Zukunft, die ihre Schatten schon mächtig in die Gegenwart vorauswirft.
Die Sorgen um die berufliche Zukunft teüen die Assistenten mit allen anderen Hochschulabsolventen, die verständlicherweise jene Jahre, die sie länger gelernt haben als ihre Alterskollegen, auch in entsprechend besser klingende Münze verwandeln wollen. Die ständig wachsende Studentenzahl bei abnehmender Gesamtbevölkerung beunruhigt. Werden die Österreicher ein Volk von Akademikern? Wo sind die Grenzen dieser Entwicklung?
Der „numerus clausus” ist die we- nigstpopuläre Lösung. Besser, aber nur langfristig wirksam, wäre eine totale Abkehr vom derzeitigen Nivellieren, also strenge Auslese durch alle Schulstufen hindurch, dafür großzügigere Förderung der Begabten. Heute gilt aber das Argument, die Hochschule solle keine Berufsschule sein, sondern möglichst allen die Chance zu geistiger Selbstverwirklichung bieten. Der Bedarf der Volkswirtschaft an Akademikern wird voraussichtlich mit der Zahl der Absolventen nicht Schritt halten können, ein Studium wird für viele die Berufsaussichten nicht erhöhen. Damit wird der Student zum „arbeitslosen Akademiker”. Den positiven Effekten für die Persönlichkeitsentfaltung und die allgemeine Erhöhung des Bildungsniveaus dürften dann bald die negativen der beruflichen Frustration gegenüberstehen. Wie sieht dann die Bilanz für den Staat aus? lehnung der Fristenlösung hervorgehoben hat) als Privatmann, aber doch mit dem Nimbus des Leiters einer kirchlichen Institution, zum sozialistischen Klubmann, ohne Auftrag, wird dort aber trotzdem gerne empfangen. Da wird aus seinen Versicherungen gerade jener Satz eliminiert, der die Voraussetzung für die Feststellung des ersten Satzes gewesen wäre. Diese unvollständige Feststellung wird durch einen Kontrollanruf mit vorausberechenbarer Antwort „offiziös” eingesegnet, um damit dann massiv Politik betreiben zu können. Wer spricht hier von Falschspiel?
Die (vielleicht ebenfalls vorausberechnete?) Reaktion der ÖVP-Manda- tare war - nach dem ersten Augenschein - verständlich. Trotzdem hätte man auch unter ihnen etwas in der Erinnerung nachblättern sollen. Etwa bis zu jener Predigt des Kardinals in der Stadthalle und bis zu den steinernen Gesichtern der Regierungsmitglieder, denen er klarmachte, wo die Bereitschaft zum Konsens ihr Ende haben würde. Oder an jene zahlreichen weiteren Erklärungen der Bischofskonferenz bis in die letzte Vergangenheit, die an der Haltung der Kirche in dieser Frage keine Zweifel ließ.
Man hätte sich auch erinnern sollen, daß das Wort von der Äquidistanz nie auf seiten der Kirchensprecher gefallen ist, daß diese aber auch nie einen Zweifel daran gelassen haben, daß die Seelsorge für alle dazusein hat, welche Partei immer sie bei den Wahlen bevorzugen. Und daß die Führung einer Institution, wie es die Kirche ist, eben notwendigerweise zur Regelung ihrer Angelegenheiten mit der Regierung sprechen muß, von welcher Partei immer diese gebildet wird. Daß schließlich die Vertretung solcher grundsätzlichen Anliegen, wie es der Schutz des ungeborenen Lebens ist, zu den ureigensten Aufgaben einer Partei zählen sollte, die sich auf christliche Wurzeln zurückführt, auch wenn die Kirche nicht urgiert, ist in diesęh Seiten* šclftoh mehrfach betont worden.
JbsefTäüs hat am Freitag das richtige Wort dazu gefunden: Es gibt keinen Konflikt zwischen Kirche und Volkspartei. Das sollte auch das Schlußwort zu diesem „Fall” sein, der keine „Strategien” bloßlegte, sondern nur einen riesigen Pallawatsch.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!