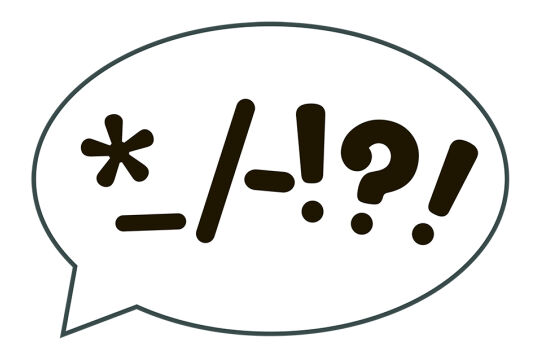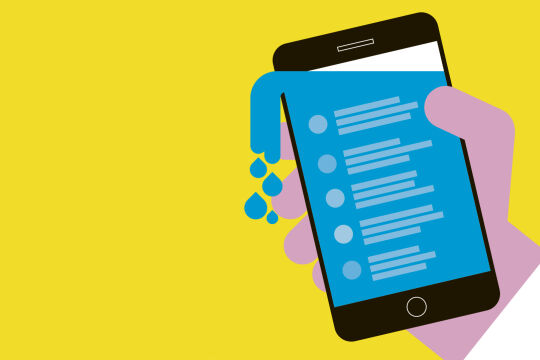Das Wiener Institut für Publizistik platzt aus allen Nähten: Bis zu 1.700 Studienanfänger sollen es heuer sein. Wie man sich dem Ansturm stellen will, erläutert der Ordinarius des Instituts, der auch seine Sorgen über die heimische Bildungspolitik zum Ausdruck bringt.
die furche: Wie beurteilen Sie als Kommunikationswissenschafter die Berichterstattung über den Terroranschlag in den USA?
Wolfgang R. Langenbucher: Angesichts der Breite dessen, was in den Medien stattgefunden hat, gibt es so viel Kritisierenswertes, dass man auch eine Philippika gegen den Journalismus lostreten könnte. Ich meine aber, dass jener Ausschnitt der Medien, den ein einzelner Mensch im Laufe von fünf bis zehn Tagen verfolgen kann, eine unglaublich informatorische Leistung gebracht hat, die doch auch Bewunderung verdient. Ich habe vor allem festgestellt, dass in den Feuilletons der Qualitätszeitungen sofort eine Fähigkeit zur Distanz praktiziert wurde, die dazu führte, dass dieses Einzelereignis in die größeren globalen und historischen Zusammenhänge gestellt wurde. Ich mache die generelle Kritik an den Medien nicht mit, und bezweifle, dass die Kritiker sich wirklich den breiten Überblick verschaffen konnten, der sie zu ihren kritischen Feststellungen berechtigt. Das muss jetzt die Wissenschaft leisten.
die furche: Offensichtlich steigt das Interesse an der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Medien: Das Institut für Publizistik ist mit einem unverhältnismäßig hohen Zustrom an Studierenden konfrontiert ...
Langenbucher: Allgemein sind die Studentenzahlen eher rückgängig, bei uns dagegen gab es in den vergangenen Jahren einen kontinuierlichen Anstieg. Das kommt zum einen daher, dass der Frauenanteil sehr hoch ist. Vielleicht entscheiden sich die jungen Leute auch richtig, wenn sie das Fach studieren. Wir leben in einer Medien- und Kommunikationsgesellschaft, und es wird niemanden entgangen sein, dass hier noch immer eine expandierende Berufswelt entsteht.
die furche: Das dürfte den Bildungspolitikern aber bisher entgangen sein. In Österreich führt das Fach ein Schattendasein.
Langenbucher: Ganz so negativ würde ich es nicht darstellen. Es hat zum Beispiel erst vor kurzem in Klagenfurt eine Neugründung in unserer Disziplin stattgefunden. Generell gebe ich ihnen aber recht. In Relation zu seiner gesellschaftlichen Bedeutung ist dieser wissenschaftliche Gegenstand unterdotiert, vor allem, wenn man an die damit verbundenen Berufsfelder denkt. Notwendig sind die Gründungen von Fachhochschulen, das ist aber ein langwieriger Weg. Zielführender wäre es, im Umfeld der Institute eine Journalistenschule oder ein Medien-Labor einzurichten.
die furche: Woran scheitert die Etablierung eines Universitätslehrganges für Journalismus?
Langenbucher: Am Geld. In der Schublade haben wir einen Universitätslehrgang für Journalisten, den wir als Modellversuch schon dreimal durchführten. Wir sind am Ende nur auf Schulden sitzengeblieben. Der zweite Grund ist, dass weder die Medien noch die Politik gut ausgebildete Journalisten haben wollen, denn die sind teuer, kritisch, sie verstehen etwas von ihrem Geschäft und sind nicht so leicht steuerbar. Das ist äußerst kurzsichtig, weil die Qualität des Journalismus darunter leidet und viele gute Leute ins Ausland abwandern.
die furche: Hat Ihr Institut etwas unternommen, um auf die prekäre Lage aufmerksam zu machen?
Langenbucher: Wir haben in den letzten zehn Jahren die Institutspolitik konsequent als Massenuniversität betrieben. Das ging auf Kosten der Forschung, des Personals und von Innovationen, für die, angesichts der Massen, keine Kapazitäten mehr frei waren. Hinzu kam durch die Spar-Wahn-Entscheidungen der Regierung die Streichung der Prüfungstaxen. Wir hätten uns schon viel früher aufbäumen müssen, um das Ministerium zu zwingen, unsere Probleme zur Kenntnis zu nehmen. Ich gestehe, dass das von uns versäumt wurde.
die furche: Sie haben aber für einen "Numerus selectus" plädiert, bei dem nur wenige Studierende nach einem ausführlichen Gespräch aufgenommen werden sollen.
Langenbucher: Zu sagen, es war mein Plädoyer ist ein bisschen unexakt. Zusammen mit der Universitätsleitung waren wir auf der Suche nach einer Lösung der dramatischen Zustände. In diesem Zusammenhang haben wir gesagt, wenn es keine andere Lösung gibt, dann ist das eine Notmaßnahme. In einer Besprechung stellten wir dann fest, dass das weder rechtlich noch politisch durchführbar ist. Das einzig sinnvolle wäre eine Studieneingangsphase. Und am Ende dieser Phase steht dann der "Numerus selectus".
die furche: Das Institut ist ein Paradebeispiel für die Zustände an den Hochschulen. Was könnte die Bildungspolitik leisten, um die Situation zu verbessern?
Langenbucher: Die Bildungspolitik hat sich - so ist jedenfalls teilweise der Eindruck - von der politischen Gesamtverantwortung verabschiedet. Ich habe unter anderem einen Brief an Frau Gehrer geschrieben, mit dem Vorschlag, von unseren Studierenden keine Studiengebühren zu verlangen. Nicht einmal der Eingang dieses Briefes wurde bisher bestätigt, woraus ich nur schließen kann, dass die Universitäten, was zumindest ihr finanzielles Elend anlangt, sich selbst überlassen bleiben. Auch die sogenannte Universitätsmilliarde hat bisher noch niemand gesehen. Im Grunde müsste ein völlig neuer Anfang in der Hochschulpolitik gemacht werden, der den Studieninteressen der Bevölkerung wirklich gerecht wird.
die furche: Neues Dienstrecht, Autonomie der Universitäten, Studiengebühren. Kann mit dieser Uni-Reform eine Verbesserung erreicht werden?
Langenbucher: Alle diese Maßnahmen können nur zu Verbesserungen führen, wenn mehr Personal und mehr Geld in unterausgestattete Institute gepumpt werden. Aber so wie diese Entscheidungen getroffen wurden, verändern sie in solchen Instituten wie bei uns nichts. Die Studiengebühren würden uns Veränderungen bringen. Aber wer glaubt das noch, dass dieses Geld zu uns kommt.
die furche: Kritiker behaupten, dass es dabei nicht um Reformen geht, sondern um einen Systemwechsel, der dem Demokratisierungsprinzip der Universitäten widerspricht.
Langenbucher: Ich meine, dass zunächst ganz nüchtern geprüft werden muss, welche Elemente einen positiven Effekt erzielten, und welche zur Ineffizienz geführt haben. Auf alle Fälle kann diese Mitbestimmungskultur nicht von heute auf morgen abgeschafft werden, und ich halte die Vorstellung, man könne zurück zu einer Ordinarienuniversität, für skurril. Selbst wenn im Gesetz steht, dass ich Autokrat sein darf, kann ich mich meinen Mitarbeitern gegenüber nicht so aufführen. Das alles wurde zum Teil von mir höchst verdächtigen Ministerialbeamten ausgedacht. Verdächtig deshalb, weil vieles, was aus diesem Haus kommt, für den Hass gegen die Universitäten spricht - und das nicht erst seit der ÖVP-FPÖ-Regierung.
die furche: Wie beurteilen sie die Uni-Reform im internationalen Vergleich?
Langenbucher: Das geht natürlich überall in die gleiche Richtung. So wie in den Siebziger Jahren mit der Demokratisierung der Universitäten ein ganz neuer Schritt getan wurde und die Auswirkungen nicht vorhersehbar waren, können auch die Effekte, die stärker ökonomisierte Universitäten mit sich bringen, nicht vorhergesehen werden. Grundsätzlich kann man der Politik das nicht verbieten, solche Experimente zu machen. Das sind legitime Versuche, bloß manchmal wird auch hektisch reformiert, und es erweckt nicht den Eindruck, dass dahinter eine konstruktive Politik steht. Zur Zeit wissen wir nicht, woran wir sind.
die furche: Stichwort ORF-Gesetz: Sehen sie darin jene notwendige Reform, die den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag stärken soll - oder wie manche Kritiker eine Maßnahme, um willfährige Strukturen zu erhalten?
Langenbucher: Das Gesetz ist in seiner Intention auf Ebene der Ziele ohne Zweifel ein Gesetz, das zur Stärkung des Programmauftrages führt. Bei der Operationalisierung macht es den künftigen Geschäftsführer aber zu einer Marionette. Wenn er sich daran halten würde, wäre der ORF nicht mehr führbar. Das Gesetz ist so detailliert formuliert, dass das aus journalistischen Gründen notwendige autonome Handeln nicht mehr vorgesehen ist. Wo immer es ein starkes hierarchisches Element gibt, muss der Verantwortliche die generelle Richtlinienkompetenz haben. Das gilt für alle Kulturbetriebe. Auch der Intendant des Burgtheaters ist ein Diktator, den man allerdings rausschmeißen kann, wenn er etwas falsch macht. Diese Kompetenz hat der künftige Geschäftsführer nicht mehr. Und deshalb bange ich um den ORF.
Das Gespräch führte Doris Kreindl.
Zur Person: Experte für Fragen der Kommunikation
Wolfgang R. Langenbucher wurde am 24. März 1938 in Pforzheim in Baden-Württemberg geboren. Nach dem Abitur studierte er in Stuttgart und München Volkswirtschaftslehre, Philosophie, Germanistik und Zeitungswissenschaft. Während seines Studium war er freiberuflich journalistisch, vor allem in Radioredaktionen, tätig. 1963 promovierte er mit einer Arbeit zur "Geschichte und Theorie der Unterhaltungsliteratur". Danach war er Assistent von Otto B. Roegele am Institut für Zeitungswissenschaft der Universität München. Seine Habilitationsschrift trägt den Titel "Kommunikation als Beruf" (1973). Diese Arbeit ist die theoretische Grundlegung seiner Bemühungen um eine Reform der Journalistenausbildung. Von 1975 bis 1983 wirkte Langenbucher als Professor am inzwischen umbenannten Institut für Kommunikationswissenschaft der Uni München. Im Mai 1982 erhielt er einen Ruf auf das Ordinariat für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien, dem er 1984 gefolgt ist. Seither lehrt er an der Universität Wien.