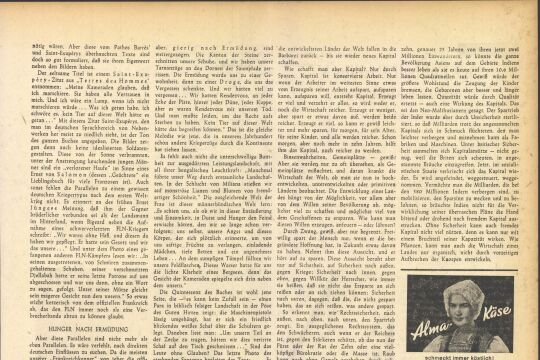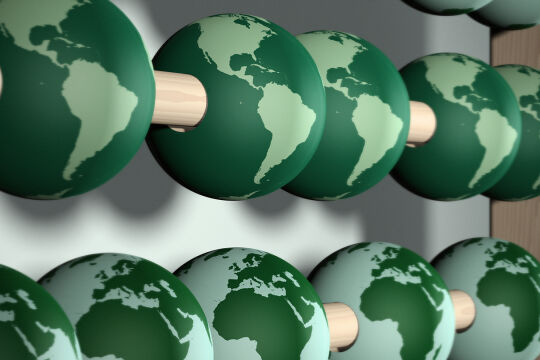Zwischen Reich und Arm: "Unser System zerstört sich selbst"
Reichtum ist an sich nichts Übles. Zuviel Geld in unproduktiven Händen ist es aber. Eine Debatte über die Vermögenskluft und ihre Folgen.
Reichtum ist an sich nichts Übles. Zuviel Geld in unproduktiven Händen ist es aber. Eine Debatte über die Vermögenskluft und ihre Folgen.
Thomas Piketty sorgte mit seinem Buch "Das Kapital im 21. Jahrhundert" über die Kluft zwischen Arm und Reich für Debatten. Wie sehr schadet der Reichtum von wenigen der Gesellschaft? Über das plutokratische Erbe der Globalisierung und die Gefahren der Finanzmärkte debattieren die Ökonomen Wilfied Altzinger und Stephan Schulmeister und der Journalist Michael Fleischhacker.
DIE FURCHE: Es gibt eine erstaunliche Umfrage zum Thema Reichtum: Von den Millionären Österreichs würden sich gleich 70 Prozent zum Mittelstand zählen. Ist das die Zier der Bescheidenheit oder Realitätsverlust?
Michael Fleischhacker: Na ja, wer einen Eigentumstitel im Wert von einer Million Euro in einem Unternehmen gebunden hat und im Wettbewerb gerade einmal so über die Runden kommt, ist nicht unbedingt reich.
Stephan Schulmeister: Reichtum ist ja ein relativer Begriff. Aber jemand, der mehr als eine Million Euro hat, ist sicher bei dem einen Prozent der Reichsten in der Gesellschaft.
Wilfried Altzinger: Schauen wir uns das einmal für Österreich an: Die vermögensschwächere Hälfte der Bevölkerung besitzt vier Prozent des Gesamtvermögen, die obersten zehn Prozent besitzen 60 Prozent. Wenn die obersten zehn Prozent also 15 Mal reicher sind als die untere Hälfte, dann ist das sehr wohl ein Problem. Je mehr Reichtum und Armut auseinanderklaffen, desto gefährdeter sind der gesellschaftliche Zusammenhalt und die demokratische Grundstruktur.
Schulmeister: Es gibt aber noch einen entscheidenden Punkt, das ist die Quelle des Reichtums. Ein Beispiel: In China gab Deng Xiao Ping 1982 den Befehl ans chinesische Volk: Werdet reich. Dieser Befehl war aber verbunden mit einer strikten Regulierung der Finanzmärkte, festen Wechselkursen und verstaatlichten Banken. Das Gewinnstreben war also über 30 Jahre auf realwirtschaftliche Bestrebungen konzentriert. Das führte zwingend zu mehr Wachstum und letztlich zu höheren Löhnen. Und zwar in einem Ausmaß, dass schon mancher multinationale Konzern meint, es zahle sich gar nicht mehr aus, in China zu produzieren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!