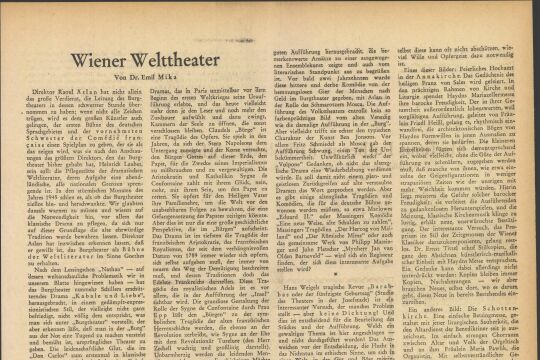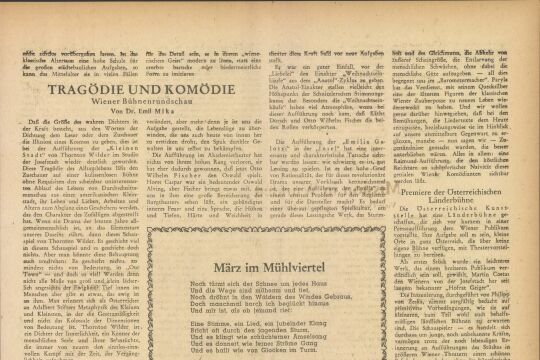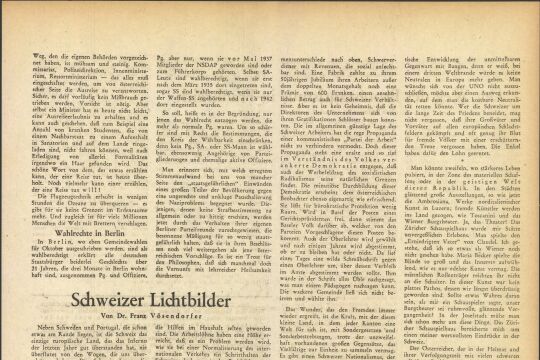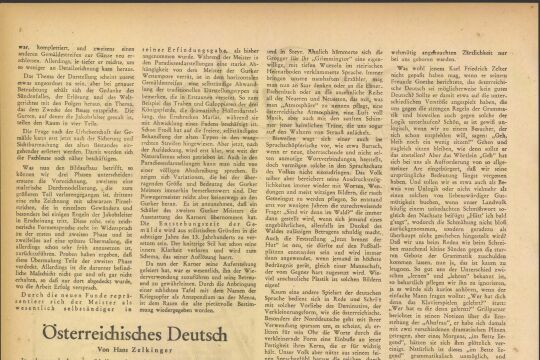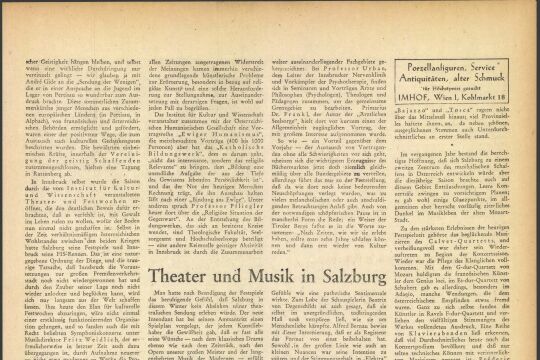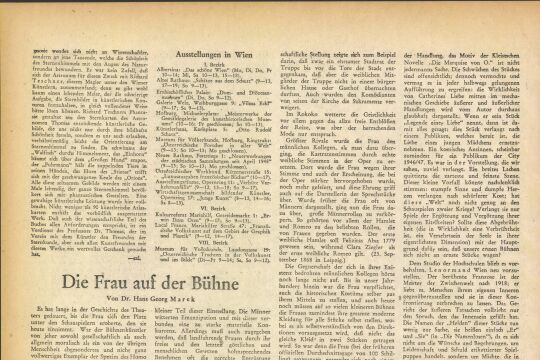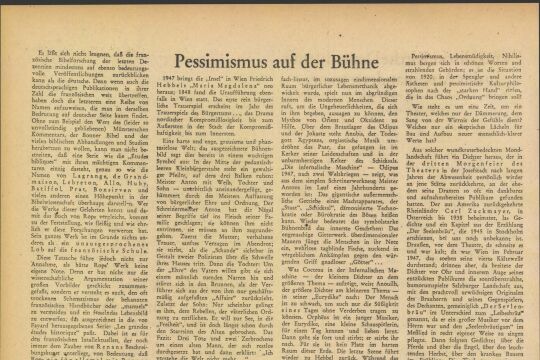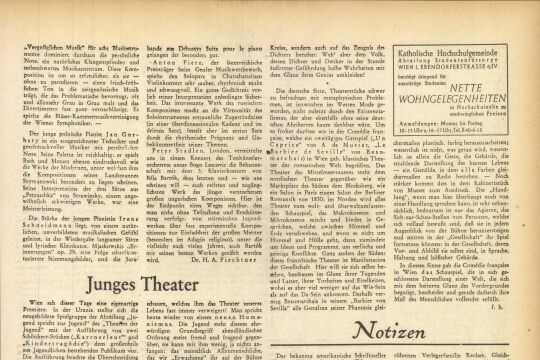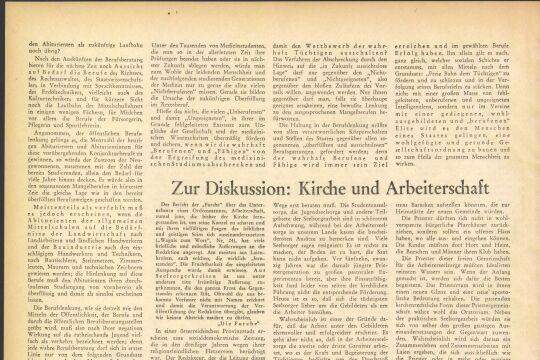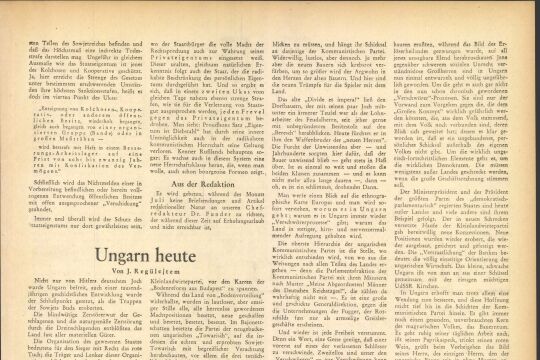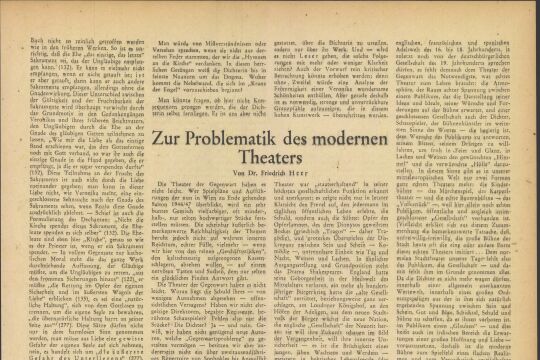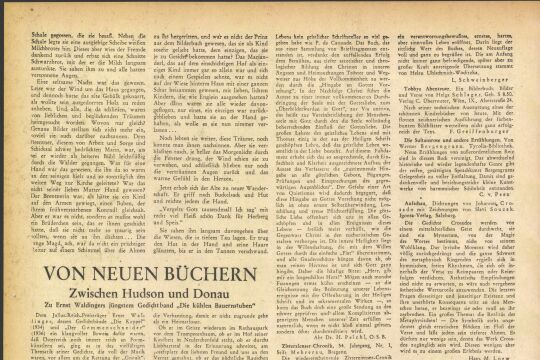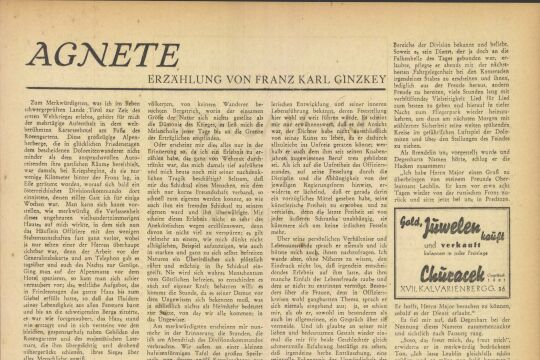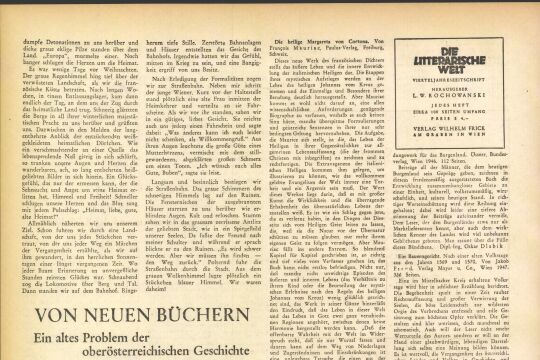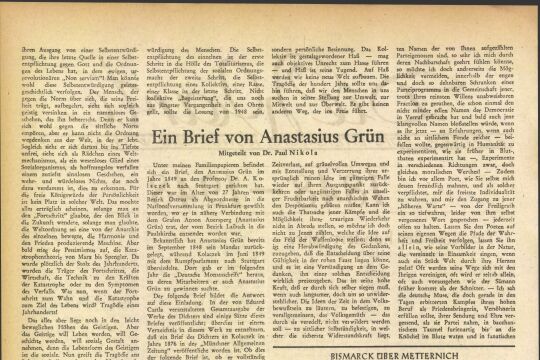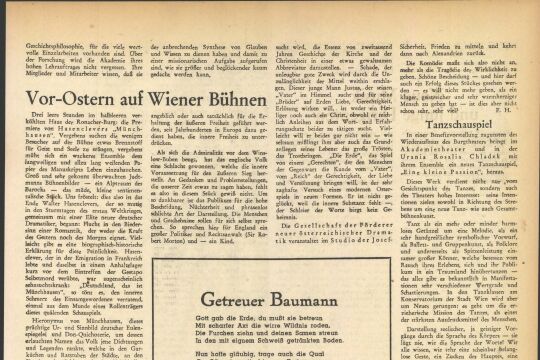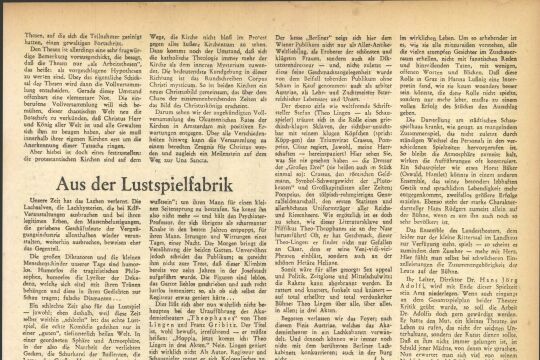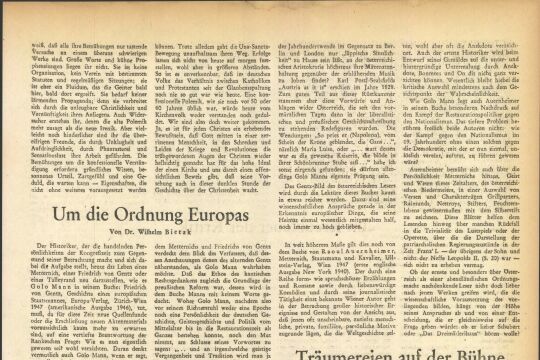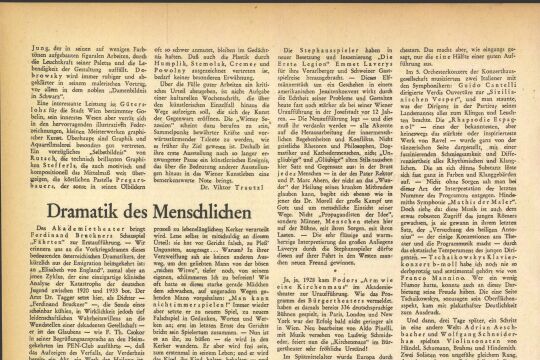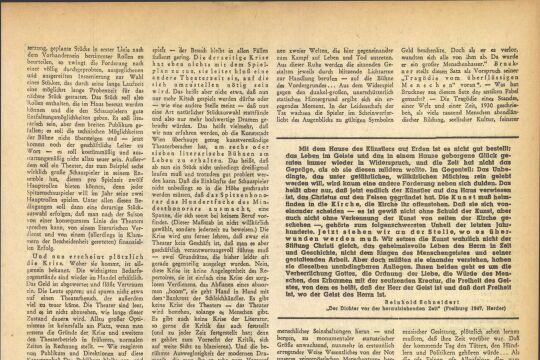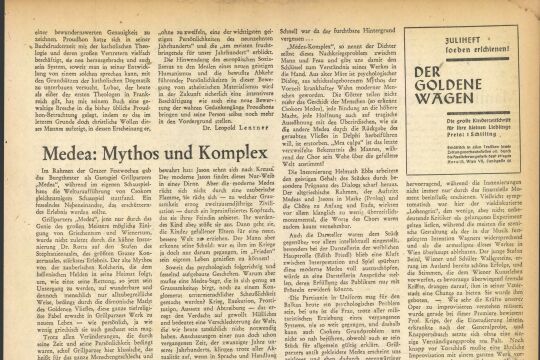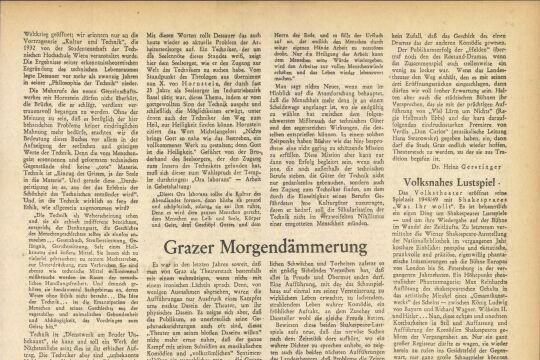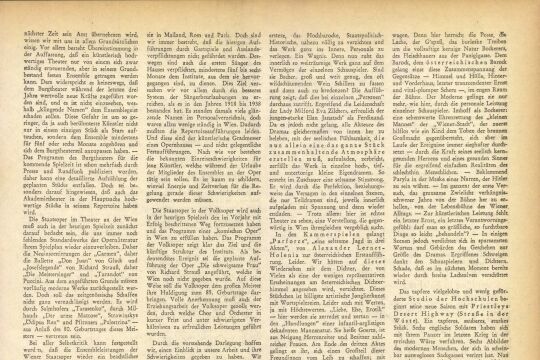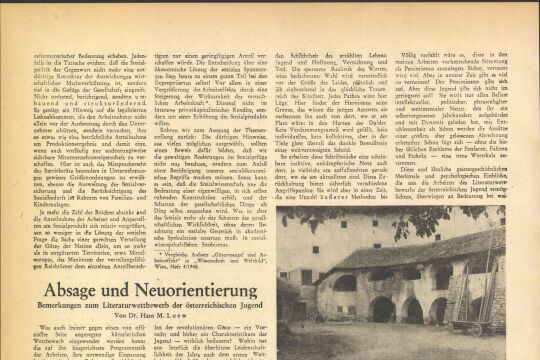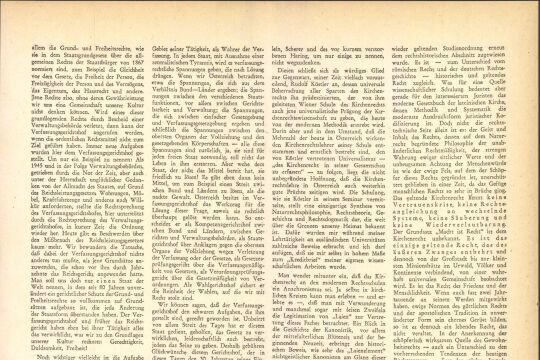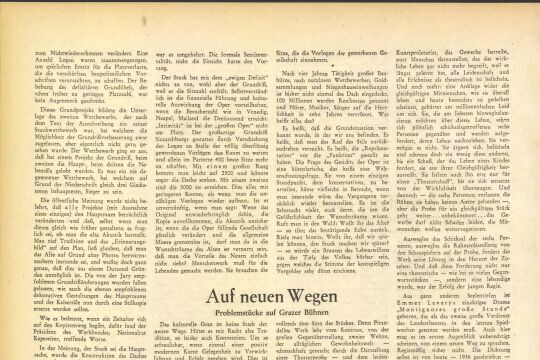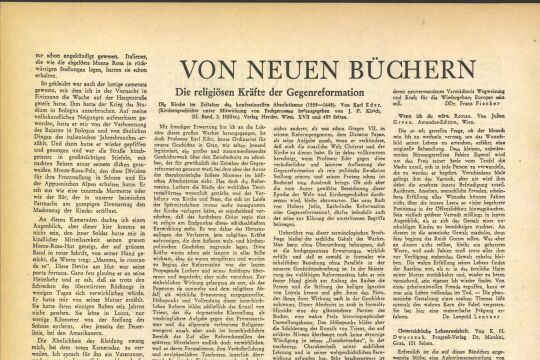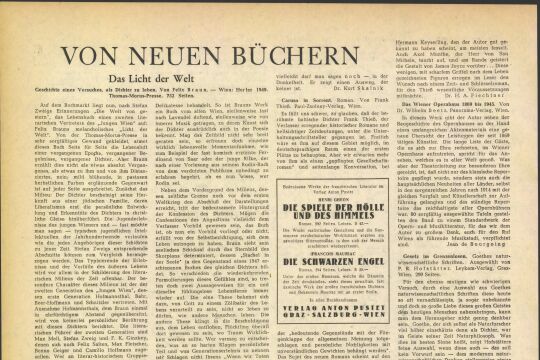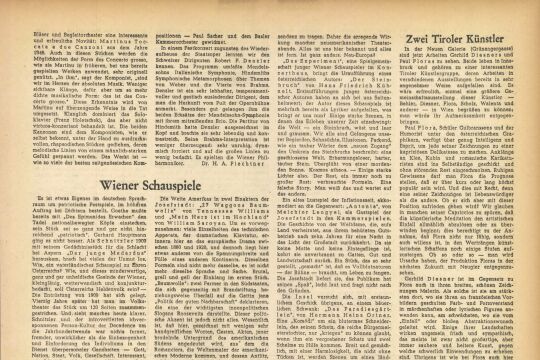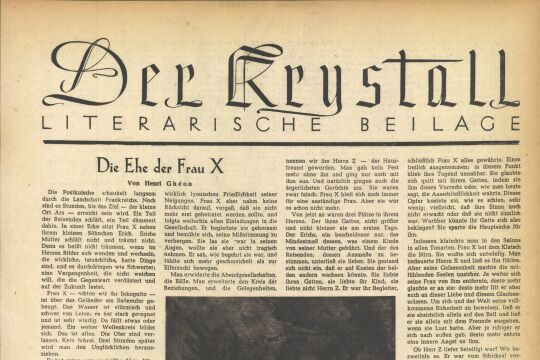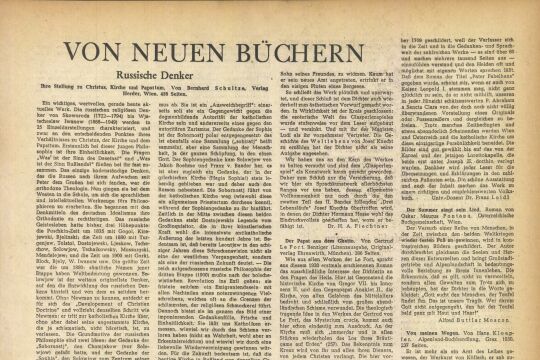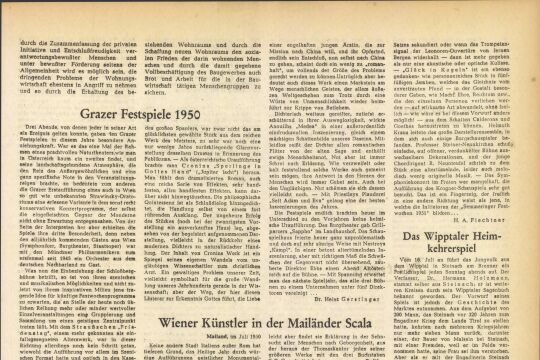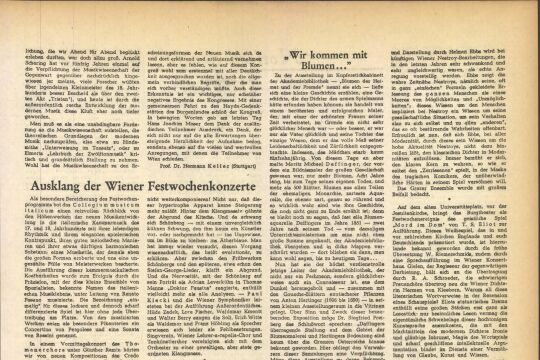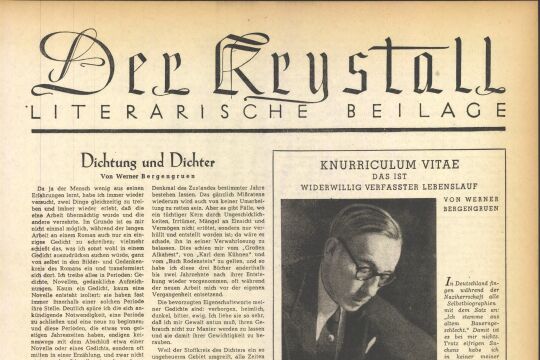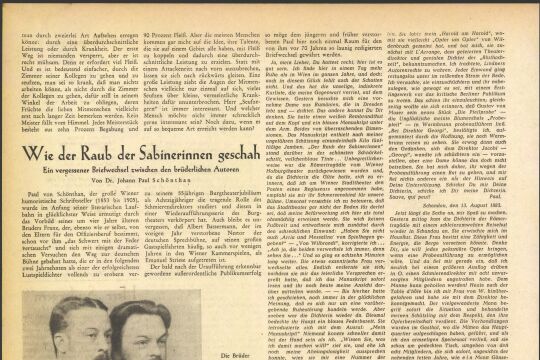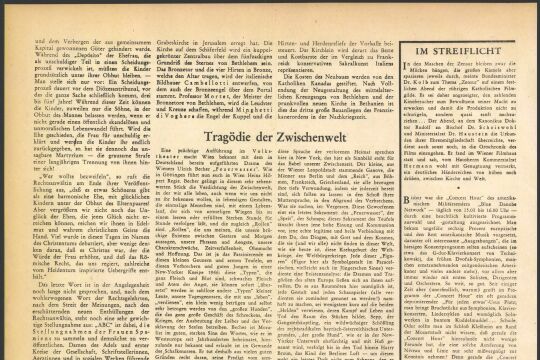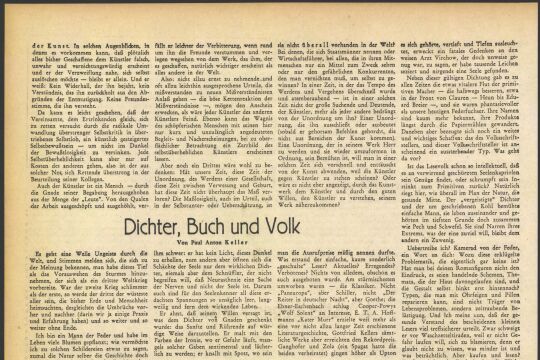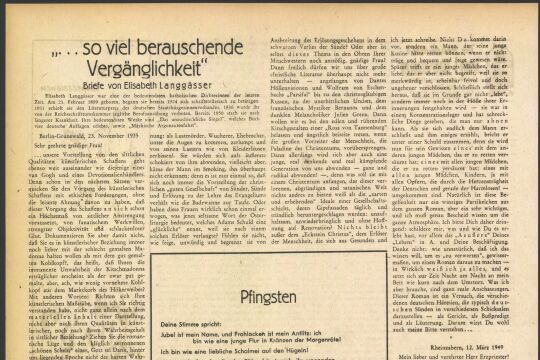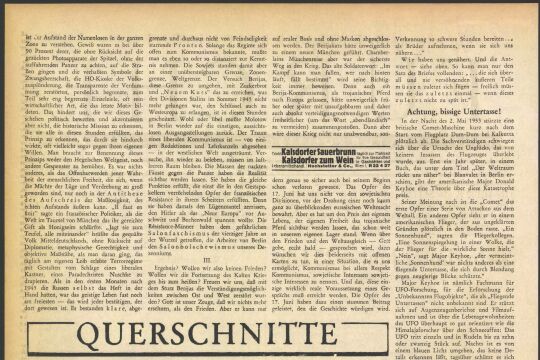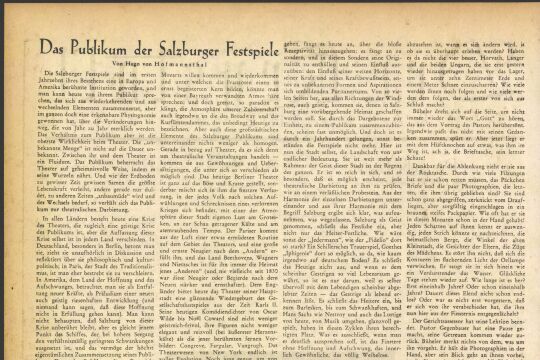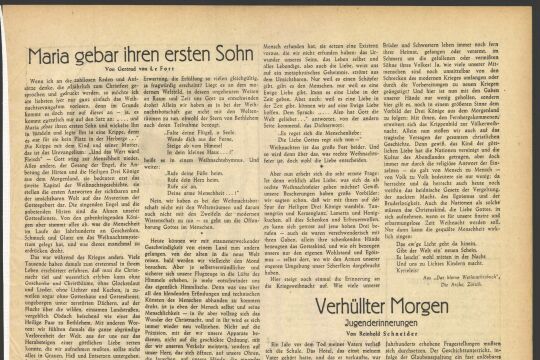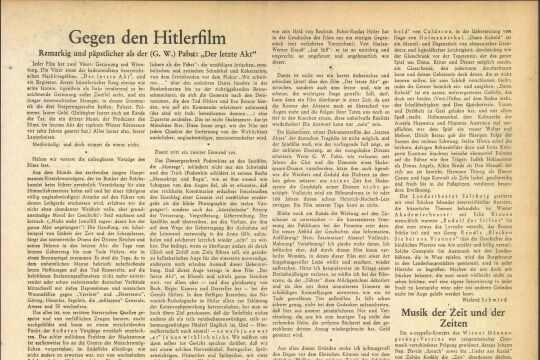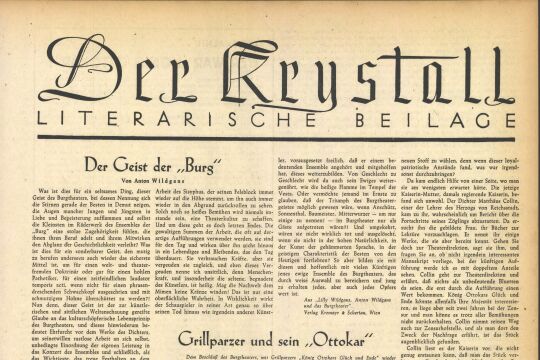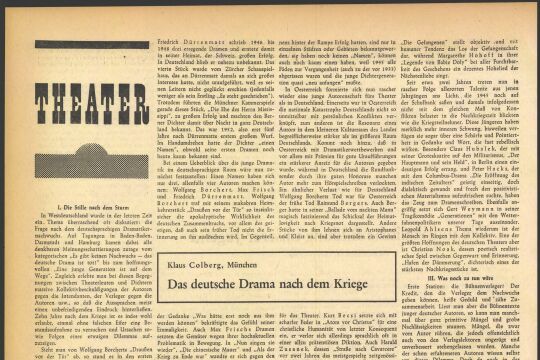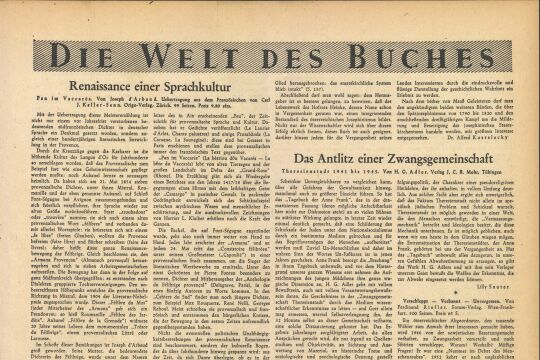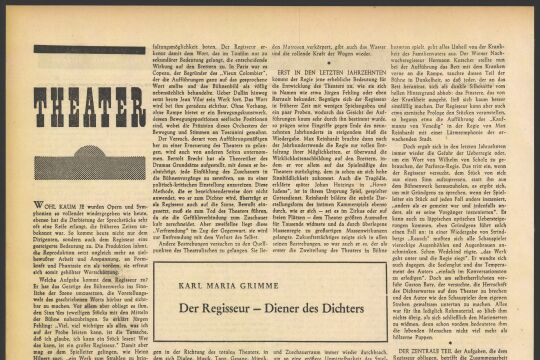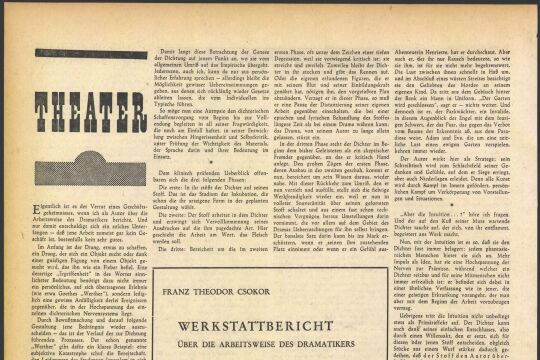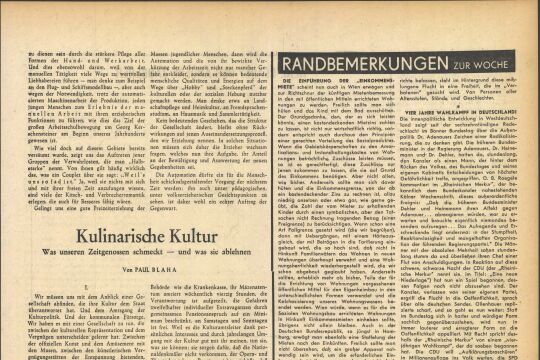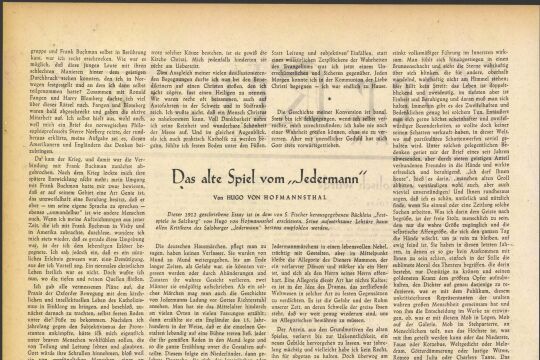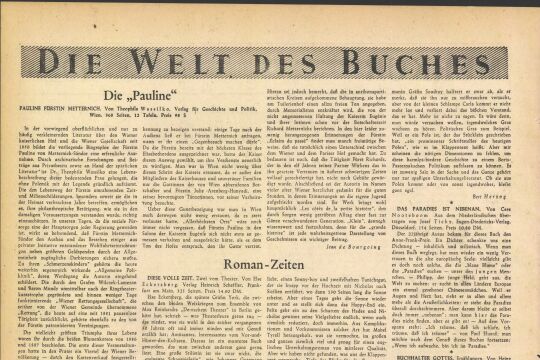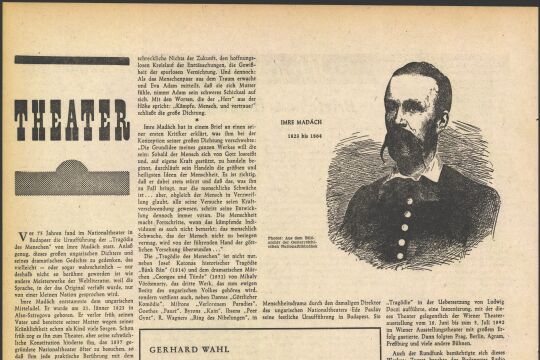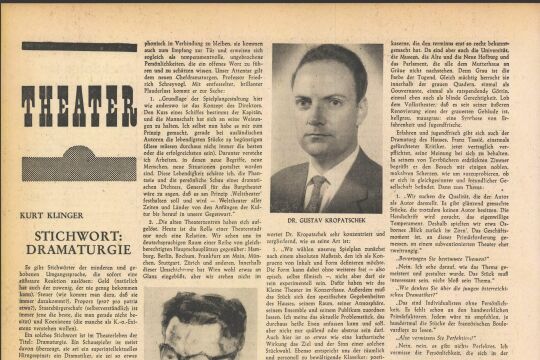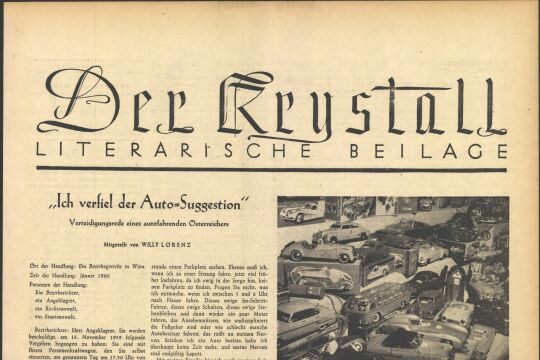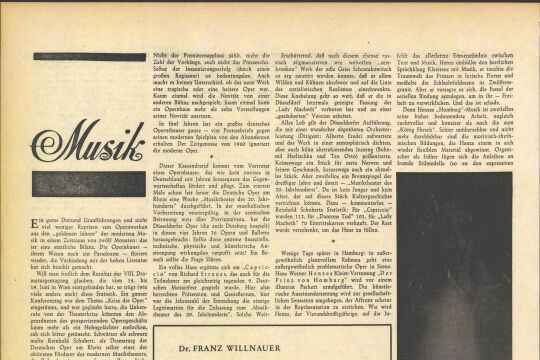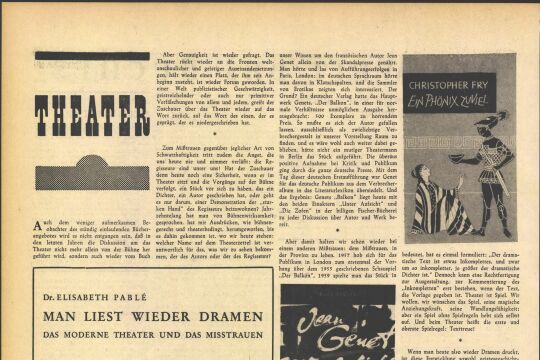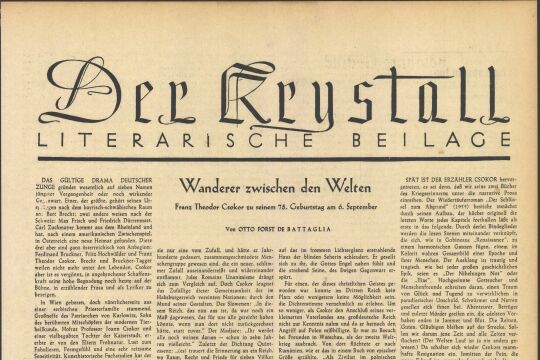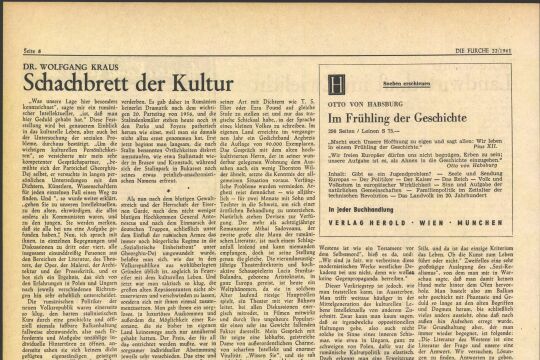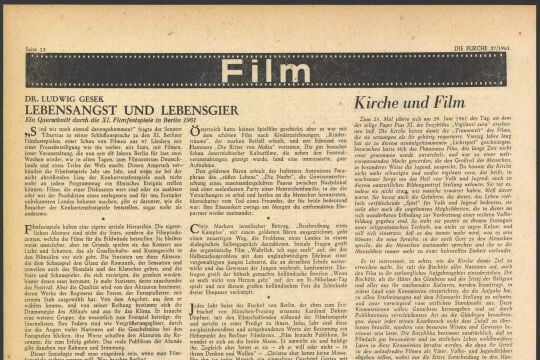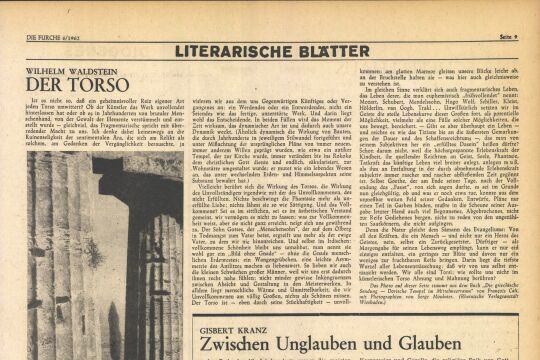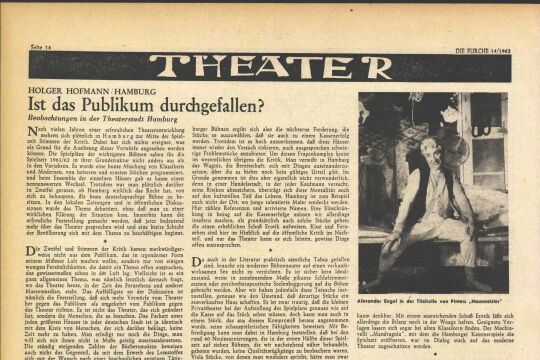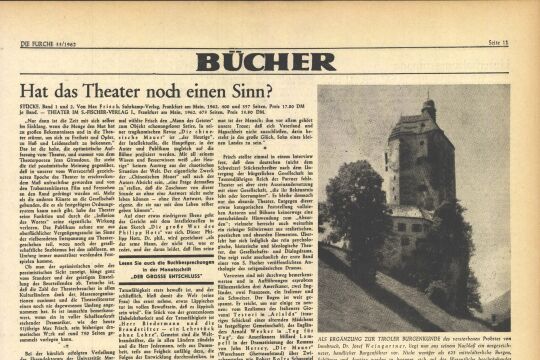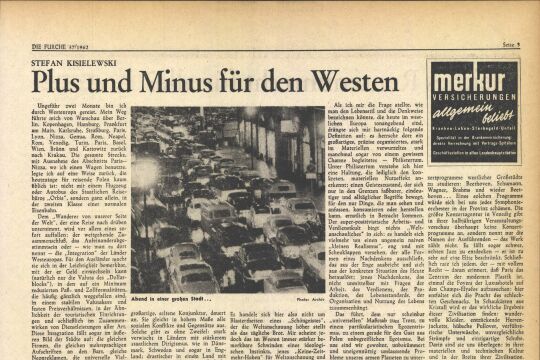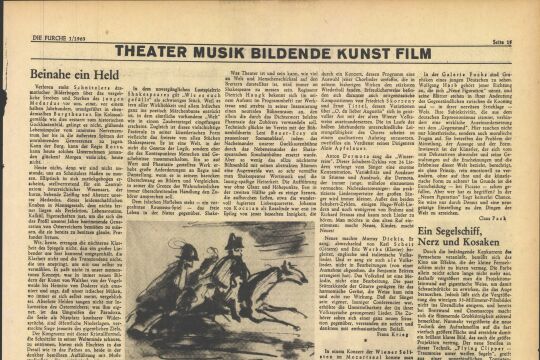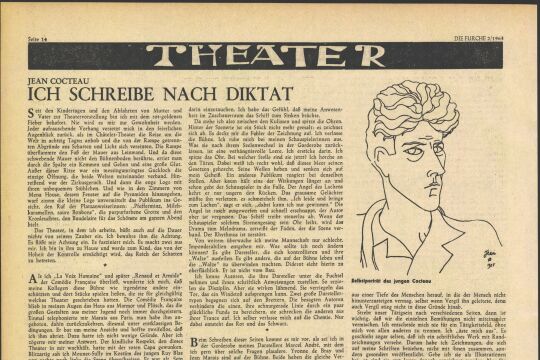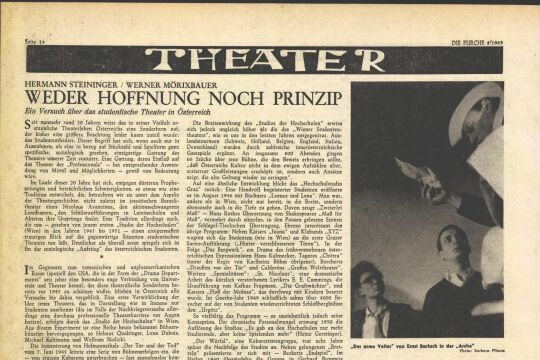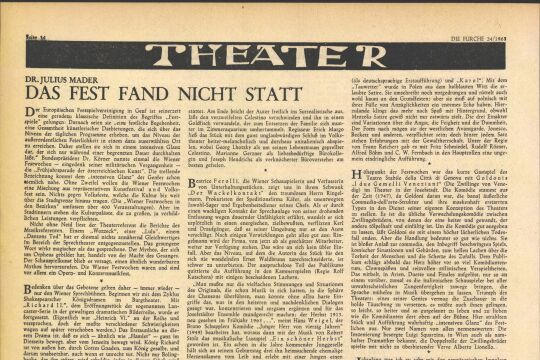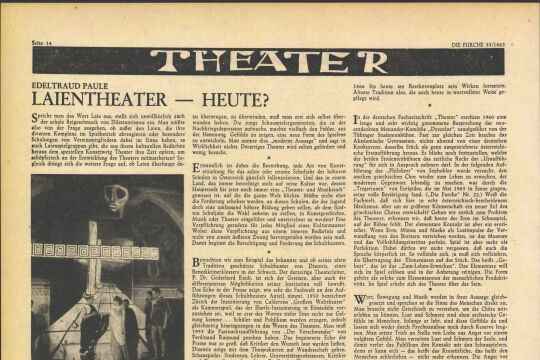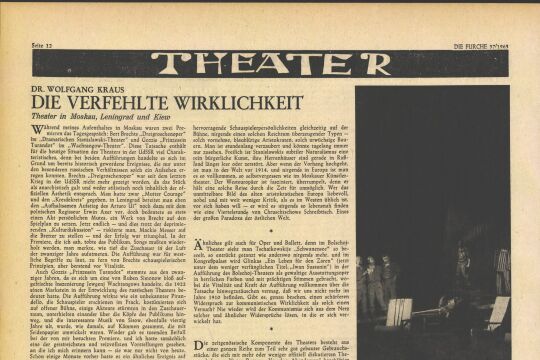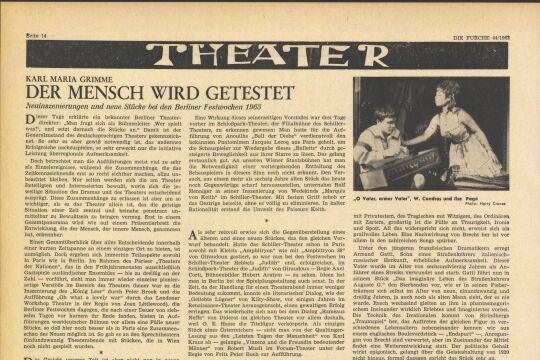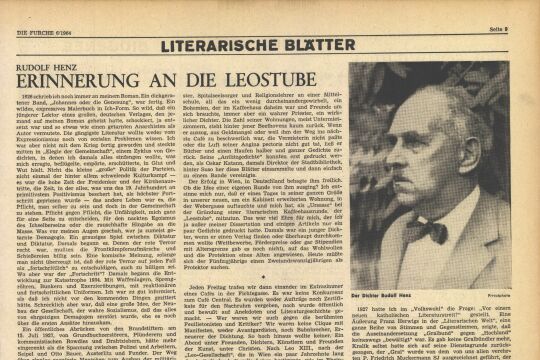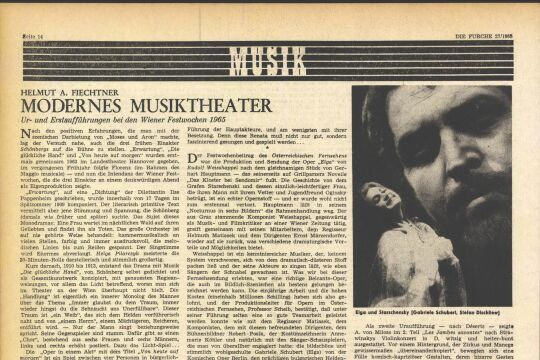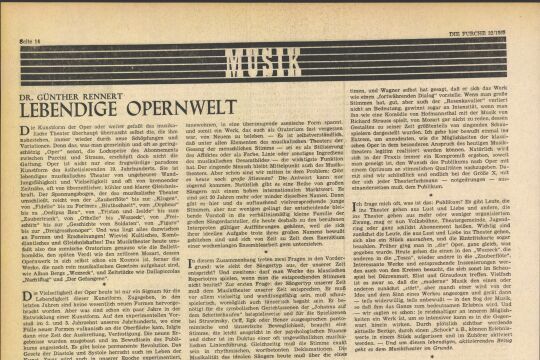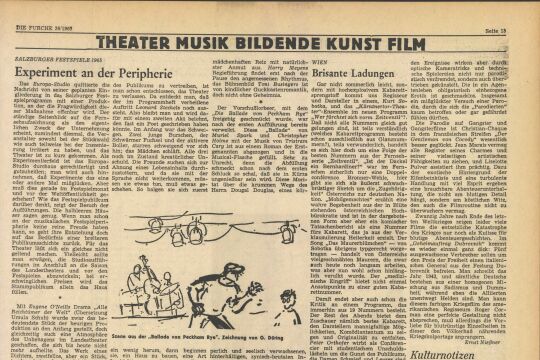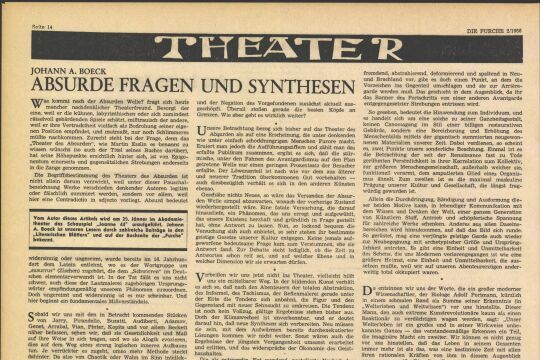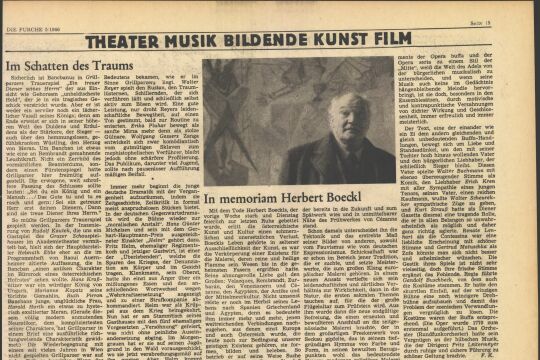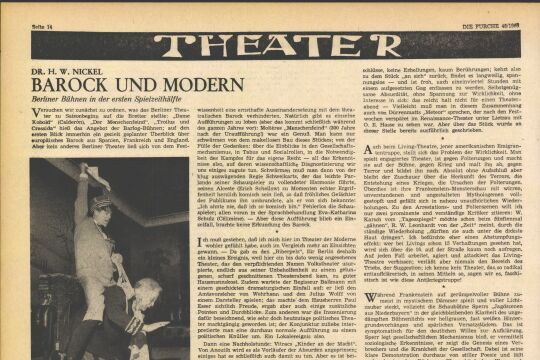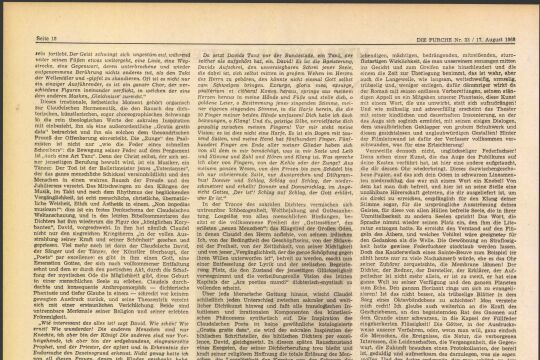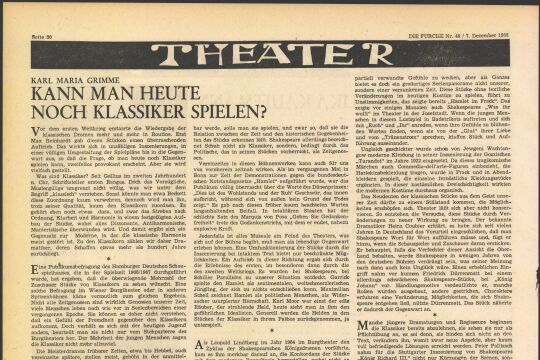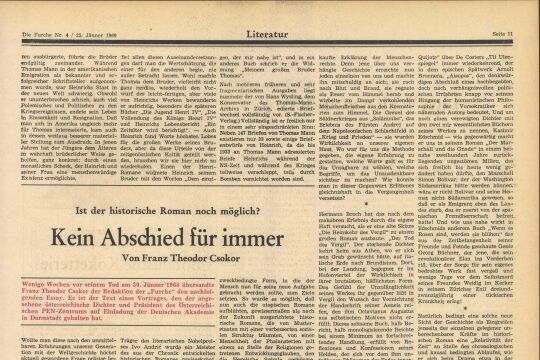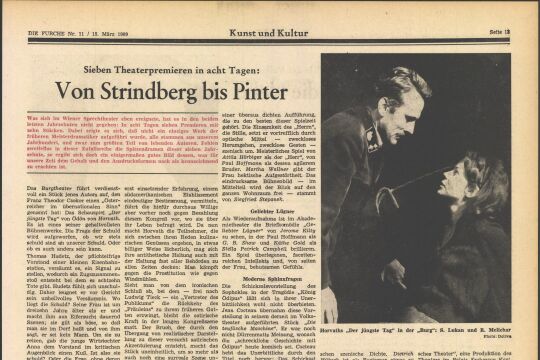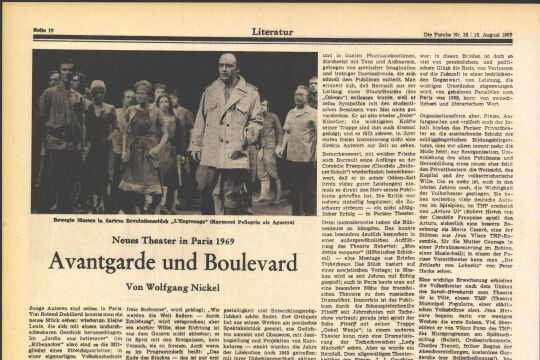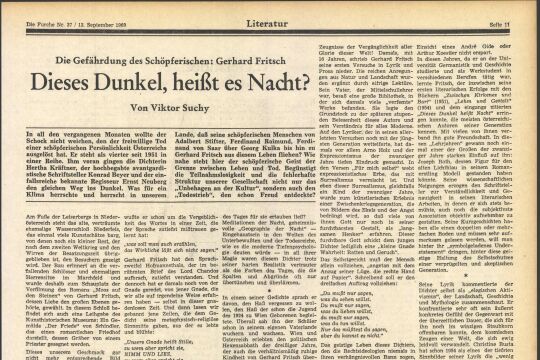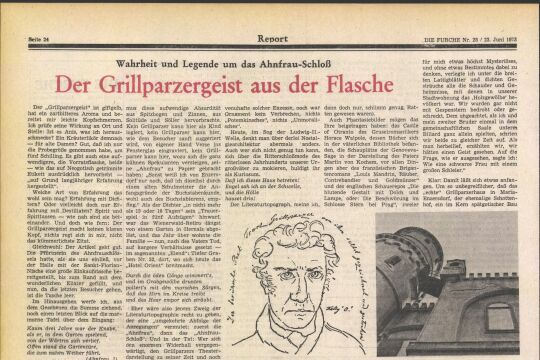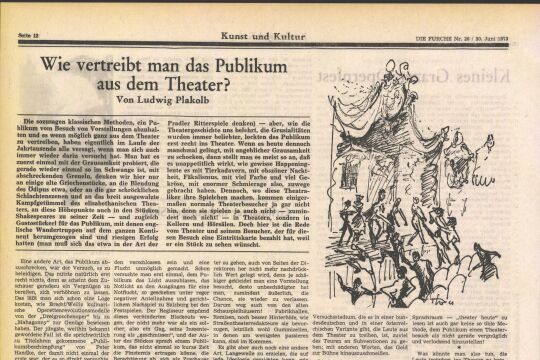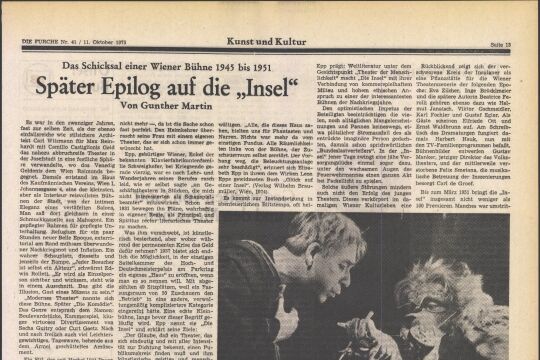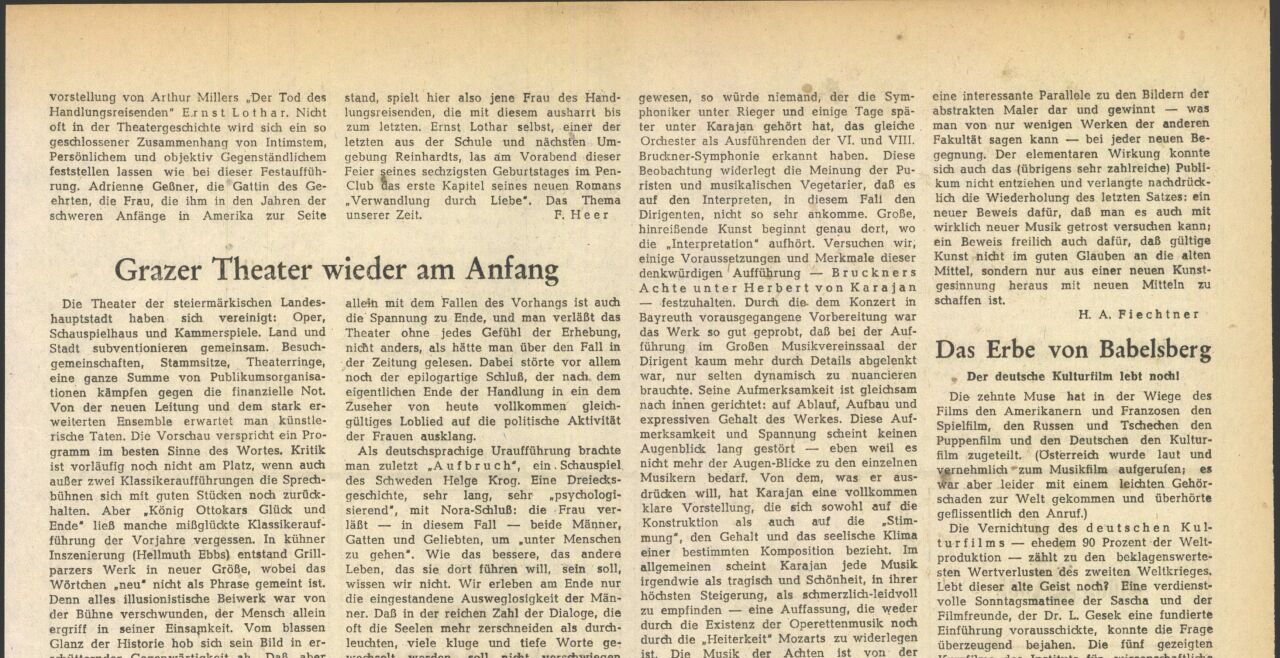
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Grazer Theater wieder am Anfang
Die Theater der steiermärkischen Landeshauptstadt haben sich vereinigt: Oper, Schauspielhaus und Kammerspiele. Land und Stadt subventionieren gemeinsam. Besuchgemeinschaften, Stammsitze, Theaterringe, eine ganze Summe von Publikumsorganisationen kämpfen gegen die finanzielle Not. Von der neuen Leitung und dem stark erweiterten Ensemble erwartet man künstlerische Taten. Die Vorschau verspricht ein Programm im besten Sinne des Wortes. Kritik ist vorläufig noch nicht am Platz, wenn auch außer zwei Klassikeraufführungen die Sprechbühnen sich mit guten Stücken noch zurückhalten. Aber .König Ottokars Glück und Ende“ ließ manche mißglückte Klassikeraufführung der Vorjahre vergessen. In kühner Inszenierung (Hellmuth Ebbs) entstand Grill-parzers Werk in neuer Größe, wobei das Wörtchen „neu“ nicht als Phrase gemeint ist. Denn alles illusionistische Beiwerk war von der Bühne verschwunden, der Mensch allein ergriff in seiner Einsamkeit. Vom blassen Glanz der Historie hob sich sein Bild in erschütternder Gegenwärtigkeit ab. Daß aber Grillparzers Drama zugleich ein Hohelied auf Osterreich ist, schien man vergessen zu haben, und ohne Widerhall verklangen die Worte Ottokars von Horneck. Das gibt zu denken: Ist die Welt so klein geworden, daß der Schatten ihres Geschehens die Lichter der Heimat verdunkelt?
Neben dieser kraftvollen Darstellung unserer Klassik scheinen die übrigen Aufführungen des Schauspielhauses trotz guter Regie- und Darstellerleistungen blaß. Man brachte Rattigans „Der Fall Winslow“ (Winslowboy). Die Geschichte vom kleinen Schuljungen, der einen Prozeß gegen die hohe englische Admiralität gewinnt, ist gewiß um ihrer historischen Wirklichkeit und ihres demokratischen Beispiels willen von Bedeutung, auch das Stück an sich fesselt, allein mit dem Fallen des Vorhangs ist auch die Spannung zu Ende, und man verläßt das Theater ohne jedes Gefühl der Erhebung, nicht anders, als hätte man über den Fall in der Zeitung gelesen. Dabei störte vor allem noch der epilogartige Schluß, der nach dem eigentlichen Ende der Handlung in ein dem Zuseher von heute vollkommen gleichgültiges Loblied auf die politische Aktivität der Frauen ausklang.
Als deutschsprachige Uraufführung brachte man zuletzt „Aufbruch“, ein . Schauspiel des Schweden Helge Krog. Eine Dreiecksgeschichte, sehr lang, sehr „psychologi-sierend“, mit Nora-Schluß: die Frau verläßt — in diesem Fall — beide Männer, Gatten und Geliebten, um „unter Menschen zu gehen“. Wie das bessere, das andere Leben, das sie dort führen will, sein soll, wissen wir nicht. Wir erleben am Ende nur die eingestandene Ausweglosigkeit der Männer. Daß in der reichen Zahl der Dialoge, die oft die Seelen mehr zerschneiden als durchleuchten, viele kluge und tiefe Worte gewechselt werden, soll nicht verschwiegen sein. Krog bemüht sich zweifellos um eine Lösung, aber er verirrt sich selbst im Labyrinth seiner Gedanken, das er auch mit der Brille nachnaturalistisdier Form nicht zu durchschauen vermag. Ein zermürbendes Drama, dessen Stoff viel zu denken gibt, zu viel zu denken gibt. Denn für Krogs Menschen ist aus der Selbstbesinnung, die uns heute allen so not tut, eine Selbstzer-pflückung geworden, bei der zuletzt nichts übrigbleibt, als braches Land. Was wir darauf bauen sollen, sagt der Dichter uns nicht.
Nach diesem eigenartigen Gastspiel der Psychoanalyse in naturalistischem Gewand erwartet man begierig die Erfüllung des versprochenen Programms. Im Geiste der König-Ottokar-Aufführung. Des „neuen König Ottokarl
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!