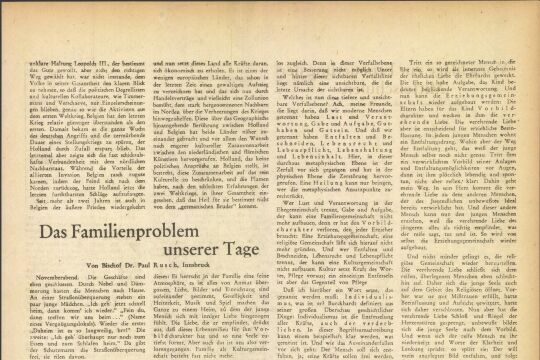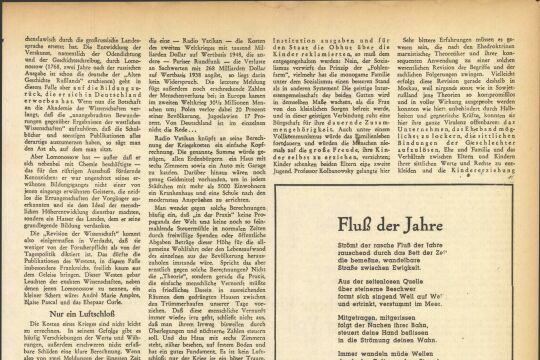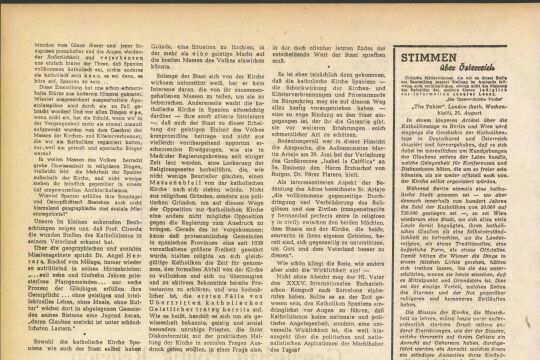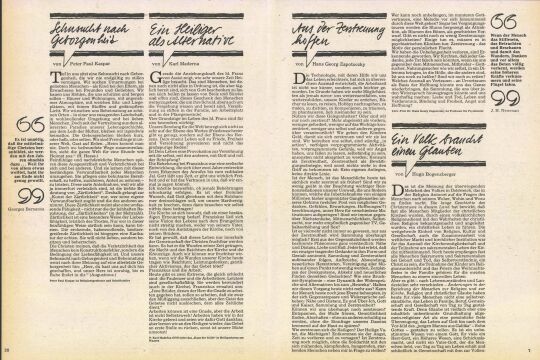Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Ich, unbekannt verzogen ...”
Welchen Regeln und Gesetzen Lebensläufe heute folgen, zeigt ein neues Buch des Münchner Soziologen Ulrich Beck.
Welchen Regeln und Gesetzen Lebensläufe heute folgen, zeigt ein neues Buch des Münchner Soziologen Ulrich Beck.
Das Ich: ein Tablett voll glitzernder Schnappschüsse? Da ist zum Beispiel der Karlsruher Wolfgang Kreuzberger. Mit 40 merkt er, daß er Männer mag, seine Adoptivtochter Nicole kommt nach der Scheidung und vielen Prozessen - wer gibt schon schwulen Vätern das Kind ?- zu ihm. Mitte 50 ist er selbst Großvater geworden, einer, der von Babies was versteht. Er hat heute, so schreibt der Kulturredakteur Ulf Erdmann Ziegler, „eine bestimmte heitere Unverletzlichkeit gewonnen, die nur Leute haben, denen tiefer und konstanter Schmerz nicht fremd ist.” Oder das achtjährige „Scheidungskind” Laura Ernst. Sie war schon in Irland, Marokko, Spanien, Kreta und Korfu. Alles mit dem Flugzeug. Sie ist „das Einzelkind zweier Familien, die erst dann Familie sind, wenn sie auch da ist”. Biographien von Menschen aus Deutschland, an denen normal ist, daß (fast) nichts normal ist.
„Die Sozialform des eigenen Lebens,” schreibt der Soziologe Ulrich Beck eingestreut in turbulente Texte zwischen Biographien und Meisterphotos von Timm Rautert, „ist also zunächst nur die Leerstelle, welche die sich immer weiter ausdifferenzierende Gesellschaft öffnet.” Und, das eigene Leben sei gar kein eigenes Leben. Vielmehr müssen die Menschen ein „eigenes Leben” führen, unter Bedingungen, die außer Kontrolle geraten. Die einzelnen werden zu Akteuren, Jongleuren, Inszenatoren ihrer Biographien, ihrer Identität, aber auch ihrer sozialen Bindungen und Netzwerke. Eigenes Leben heißt dann, das Normale der Biographie steht zur Wahl. Und hinter den Fassaden der Sicherheit und des Wohlstandes droht das Abgleiten. Daher das Klammern und die Angst selbst in der äußerlich reichen Mitte der Gesellschaft.
Eigenes Leben heißt dann in der Konsequenz, auch eigenes Scheitern. Gesellschaftliche Krisen erscheinen als persönliche. Wie bei Ulrich Mahlau zum Beispiel, der das Problem mit der Arbeit hat. Er hat nämlich keine. Der ehemalige DDB-Bür-ger nimmt die Arbeitslosigkeit als individuelles Schicksal, um so mehr, als er es zu überwinden sich vorgenommen hat. Er macht jetzt Kurse und lernt Englisch. Die Fortbildung unterbricht vor allem das Ticken der Uhr, das sich für Arbeitslose etwas lauter anhört. Vertreter, sagt Mahlau, wird er erst, wenn ihm das Wasser bis zum Scheitel steht.
Das eigene Leben ist gleichzeitig ein globales Leben, eines in dem die Zukunft nicht aus der Herkunft abgeleitet werden kann.
Aber, so korrigiert Ulrich Beck, der schon 1986 11 auf mögliche Turbulenzen verwiesen hatte, mit der Selbstbestimmung ist es genauso wenig weit her, wie mit dem eigenen Leben. Oft ist die Verwirklichung des eigenen Selbst nur der öffentliche Lückenbüßer, die Kehrseite der Folgeprobleme, die auf den nunmehr mündigen Bürger abgewälzt werden. Der mündige Bürger ist ein Notprodukt der Umstände. Überall schlagen Nachrichten, Gifte, Bilder, Anforderungen, Widersprüche herein: das eigene Leben ist prinzipiell leck.
Alle wälzen alles Mögliche und Unmögliche auf das eigene Leben ab. „Dafür”, meint Beck, „gibt es ein liebevolles Wort: den mündigen Bürger.” Die Konsequenz daraus: das Politischwerden des eigenen Lebens läßt sich nicht mehr verhindern. „Normales” wird da zum Politikum, das (noch) hinter privaten Türen abgehandelt wird. Zum Beispiel die Hausarbeitslosigkeit des Mannes. Mit der Bildung erwachte bei den Frauen auch der Anspruch auf reale, nicht nur verbale, Gleichberechtigung. Mit dem „eigenen Geld” wird die Einbettung in Familie und Ehe gelockert. Wer dann bügelt, das ist nicht mehr von vornherein klar. „Das eigene Geld,” schreibt Beck, „verlängert den Individualisierungsschub in die I Familie hinein”. Die mit dem Ar-I beitsmarkt verknüpfte Forderung nach Beweglichkeit erweist sich als Familiengift. Denn konsequent zu Ende gedacht: sind beide Elternteile vollmobil, droht das Schicksal der „ Spagatfamilie”, mit den K i ndern im Nachtzug, oder ein Teil bleibt weiterhin ehebehindert immobil.
Das eigene Leben ist also ein Märchen, das jeder selbst inszeniert, um nicht unterzugehen. Die Selbstverständlichkeiten des Lebens werden zutiefst verunsichert: die Beziehung zwischen den Geschlechtern, die Ehe, Familie und die Umweltschäden. 1
Das eigene lieben ist vergesellschaftet: es folgt einem institutionellen Programm: dem Arbeitsmarkt, der Ausbildung, dem Sozialstaat, den Kindergärten und der Oma, die manchmal auf die Kinder aufpaßt. Das eigene Leben ist kein Zeichen von überschäumenden Individualismus, sondern eine durchaus mit den Umständen konforme Existenzform.
„Eine Konformität,” so _
Beck, „die manchmal auch ihr Gegenteil erzeugt: die Unberechenbarkeit des Sozialen.” Schon wenn die Oma einmal lieber mit ihrer Freundin Kaffee trinkt, statt auf die Enkel zu schauen, fällt das eigene Leben um.
Das eigene Leben, das kein eigenes ist, wird gekennzeichnet vom Fehlen des eigenen Sterbens. „Die Sterbensfurcht,” schreibt Beck, „beginnt früh, ist erfahrbar und allgegenwärtig.” An ihr verdienen Versicherungen, Vorsorger und Heilsversprecher. „Die Angst vor dem Sterben schlägt sich nieder in den neuen Kathedralen der Sicherheit und der Versicherungen, die das nur dieseitige Leben vor den Spuren seiner Vergänglichkeit bewahren wollen.”
Das Ende des Buches „Eigenes Leben”, der Ausflüge in die unbekannte Gesellschaft, in der wir leben, ist pessimistisch. Man wünsche sich die Abschaffung des Sterbens. Der Ausweg deute sich an. Der plötzliche Urknall nämlich, ein weiteres Tschernobyl vielleicht, jedenfalls der allgemeine Unfalltod. Oder: die Verewigung des eigenen Lebens durch Tilgung aller Spuren des Verfalls am eigenen Körper. In beidem, der Verplötzlichung des allgemeinen Endes oder der Verewigung des Individuums, sind die Fortschritte groß.
Ein drittes Ende stünde aber noch an und zeigt sich in den Biographien der Menschen: die Familie der fünfziger und sechziger Jahre gehört zu einer vergangenen Zeit des „familialen Privati-simum”.
Heute nimmt sie vielfältigere, buntere Erscheinungsformen an, Männer leben mit Männern, Frauen mit Männern, mit denen sie nicht verheiratet sind, Singles haben ihre Partner im Nachbarbezirk. In ganz neuer Weise und vielleicht tiefgreifender als durch politische Reformversuche wird hier das Gefüge durch eine permanente Praxis des Andersmachens im kleinen unter Veränderungsdruck gesetzt.
Die Gefahren sind groß, aber auch die Chancen: denn das politische Potential der sich vervielfältigenden Privatsphäre liegt in ihren Gestaltungsmöglichkeiten. Kulturelle Normen und Rarrieren werden durch Andersmachen überwunden. „In diesem Sinn hat die Enttraditioniriisierung der letzten lahrzehnte einen Lernprozeß freigesetzt,” denkt Beck, „dessen historische Wirkung man mit Span-Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!