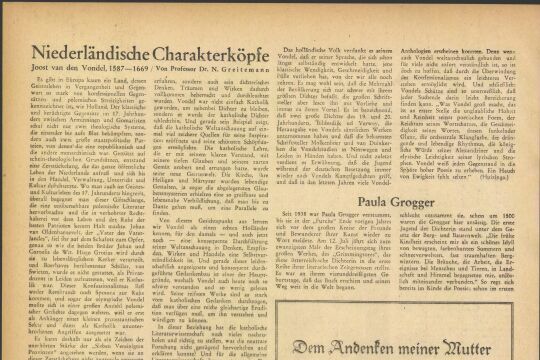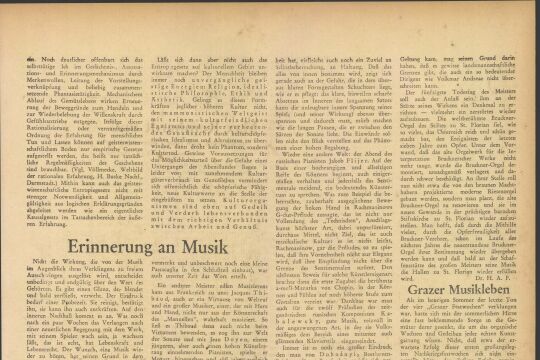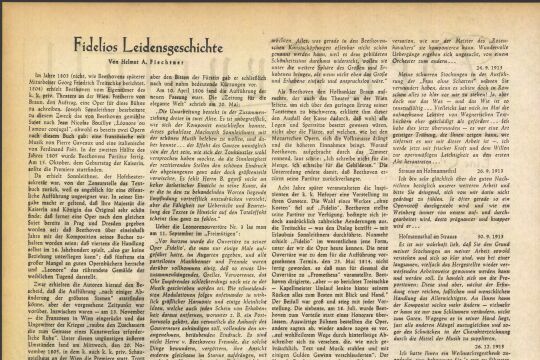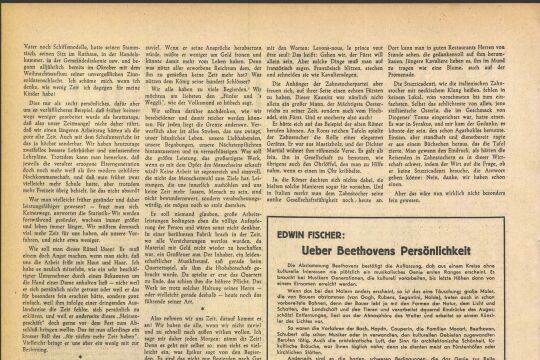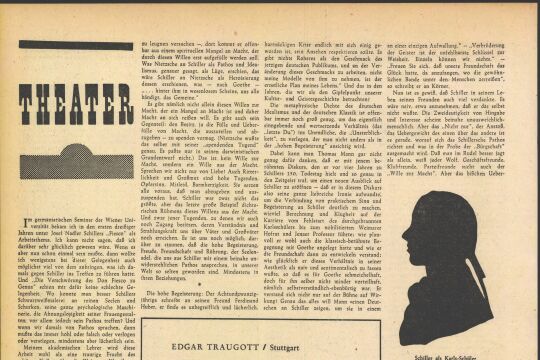Im Schatten des Titanen Beethoven fühlte sich und steht noch heute Franz Schubert. Mit den von ihm geliebten Dichte* Hölty und Novalis, mit Wackenroder, Kleist und Raffael, mit Pergolesi und Mozart sehen wir ihn in dem tragischen Kreise der Frühvollendeten: er starb im einunddreißigsten Jahre, und Grillparzers Grabschrift spricht von den „noch viel schöneren Hoffnungen“, die der reiche Besitz erweckt habe. Er selbst hatte, scheidend, die Hand auf eines großen Theoretikers Türklinke gelegt, um sich* für die hohen Pläne zu rüsten, die ihn beschäftigten, nachdem er ein umfangreiches, in der Überzahl der Teile auch schwer wiegendes Opus hinter sich gebracht hatte.
Dies Offenlassen des Werks erschwert die Erkenntnis dessen, was vorhanden ist. Komponieren heißt zwar Zusammensetzen; doch eine Beziehung zu höherer Einheit wird ja mitgemeint und ist im Falle ernstlicher Kunstanschauung unerläßlich. Diese Einheit zu finden und zu deuten, ist das Ziel der Bemühung, die über das Anekdo-tisdie hinaus möchte. Die Kräfte der Umwelt, an die man zunächst denken mag, haben zwar bildende Funktion; doch die könnte ja nicht wirksam werden, wenn sie auf ein Nichts träfe. Es geht also letztlich um die Feststellung der mensdilichen Grundlagen, die Schubert als unveränderlichen, in der besonderen Form nur ihm eigentümlichen Besitz mitbringt.
Wir legen uns, beginnend, die Frage vor: steht die unter seinem Namen bek mnte Totalexistenz wesentlich in der von Tele-mann über Beethoven zu Wagner verlaufenden Reihe oder sind Händel, Mozart, Bruckner der Uranlage nach seine Nächst-verwandten? Er verehrte Beethoven mit Bewunderung und scheuer Liebe. Das bedeutet aber ncht, daß die seelische Struktur des einen der des andern ähnlich sei.
Es wiederholt sich hier das Verhältnis, das nicht lange zuvor zwischen zwei Dichtern bestand. Als Schiller Goethe kennenlernte, befand er sich vor einem anziehenden, aber gänzlich unerwarteten Anblick: ein in allen Bereichen unverwandter Mensch trat ihm zu seinem Erstaunen 'entgegen. Das Erstaunen aber ist Endursache des Philosophierens, und so kommt Schiller zu dem Rechenschaftsberichte seiner Abhandlung über naive und sentimenta-lische Dichtung. Er wird durch sie zum Begründer der spät erst weiter ausgebauten und endlich auch auf die Tonkunst angewandten Typenlehre. Schiller zeigt mit dem Blick auf Goethe und sich Zwei Möglichkeiten der unabänderlichen menschlichen Veranlagung auf: das naive und das sentimentalische Verhalten der intelligenten Kreatur zur Welt und ihren letzten Fragen. Der naive Typus ist mit der Welt im Einklang, der sentimentalische im Zwiespalt. Der sentimentalische Mensch stellt Gott zur Rede: „Ich lasse diel nicht, du segnest mich denn vor“; dem naiven ist die schöne Last auferlegt, „das Unerforsch-liche ruhig zu verehren“, um das Wort eines naiven Dichters, Goethes nämlich, zu gebrauchen.
Der sentimentalische Geist — er ist im Norden häufiger zu finden als im Süden, wo der naive Typus zu Hause ist — hat sich in einer Kunstform manifestiert, die zu den höchsten Besitztümern der Menschheit gehört. Es ist die b e e t h o v e n s c h e Sonate für Klavier, in der Kammermusik und Symphonik. Schubert macht von seinem Rechte Gebrauch, durch ihren Anblick ergriffen zu sein; aber freilich: „Wer kann nach Beethoven noch etwas machen!“ Von seinen zweiundtwanzig Klaviersonaten wurden neun * nicht von ihm beendet; seine berühmteste Symphonie ist die „Unvollendete“ und von fünfzehn Streichquartetten sind immer noch drei
* S. 1037.
fragmentarisch überliefert. Er hatte wie kein anderer nach Beethoven noch etwas machen können: sein Darstellungsvermögen, richtig eingesetzt, reichte vom „Prometheus“ zu den „Grenzen der Menschheit“, Gedichten, in denen Goethe die Pole gegensinnigen Verhaltens zur Welt auf erhabenste Art darstellt. Aber dem instrumentalen, vom Worte gelösten Dualismus der „zwei Prinzipe“, von dem Beethoven spricht, der subjektiv erregten Antithesenwelt Hegels, die, selbst aus sentimentalem Geiste geboren, sich in seiner Sonate spiegelt, blieb Schubert im Innersten fremd. Wir können nicht zweifeln: Schubert steht dem von Mozart beglückend vertretenen Typus nahe, nicht dem beethovenschen; er ist seiner Uranlage nach naiv. Wäre ihm an der Stelle der die Welt in Aufruhr bringenden beethovensdien die mozartische Sonate als Ideallösung ersdiienen, so hätte er die geglückten I-ösungen, die es in seinem Werke reichlich gibt, ohne Umwege gefunden. Unter den zahlreichen vierhändigen Stücken sind nur zwei Sonaten, aber viele phantasieartige Gebilde, und es ist wahr: er flüchtet geradezu in das weniger verbindliche Charakterstück, das seiner Art entspricht: die drei Werke aus dem Todesjahr zeigen die Höhe an, die ihm erreichbar war. Er ist ja der Mann seligen Ausströmens, vertrauender, unbewußter Hingabe an das Höchste, nicht der Mann kämpferisdier Leistung, für den der Stoff tot wäre, wenn er sich an ihm nicht immer wieder zu bewähren hätte.
Schuberts Arbeitsweise ist der Beethovens entgegengesetzt; sie muß es sein. Sie kennt, wir sagten es, das Verlassen eines begonnenen Stückes; nicht aber kennt sie das Beginnen mit der schriftlichen Skizzierung. Beethoven ringt in zahlreichen uns überkommenen Entwürfen schon um die Gestalt des Themas; immer von neuem setzt er an, um den Keim, zum Beispiel des ersten Quartetts von opus 19, bald hierhin, bald dorthin zu entwickeln, bis, aus oft unscheinbaren Vorstufen, das Makellose, das seiner höheren Absicht Dienliche sich erhebt. Schubert skizziert nicht, vollends in diesem ethisdien Sinne nicht: wie Mozart steht ihm offenbar das Ganze vor Augen, wenn er die Feder ansetzt. Hält die Vorstellung nicht durch, wendet er sich einem neuen Plane zu; an Einfällen fehlt es ja nicht. Er ist glücklicher Versdiwender, wo Beethoven, seinem Typus treu, Sparer ist. Dpch Schubert darf sich auf die Natur als die größte Verschwenderin berufen. Seine Grundanlage will ja die dialektisch-kritische Behandlung der genialen Idee nicht, die mit der „Durchführung“ einsetzt. Wer sein Werk mit dem an der Sicht auf Beethovens Exegese entwickelten Maßstäben mißt, macht einen Versuch am untauglichen Objekt, wie es der geistvolle August Halm tat, als er einem mozartischen Sonatenthema vorwarf, es habe, beim Wiederauftreten nach der Durchführung, „nichts erlebt“. Das aus der naiven Haltung geborene Thema soll nichts erleben; es will blühen. Der Mensch, sein Schöpfer, entläßt es in die Welt wie Gott die Blume, und tritt zurück. Das muß verstanden werden, wenn man Schuberts Genialität ermessen will.
Auch kl der Singmusik, wo der Naive dem Sentimentalisdien gegenüber — er müßte denn Heinrich Schütz heißen — günstiger zu stehen scheint, ist che Vor-behaltlosigkeit der Hingabe da. Doch auch hier muß Schubert den Umweg über den unverwandten Schiller zu dem verwandten Goethe machen. Für ihn kommt, die Lage erleichternd, hinzu, daß er in den Entwicklungsjahren den Stil der italienisdien Diktion kennenlernte, die naiven Herkommens ist. Wenn Salieri, wie man hört, durch die frühreif-bombastische Komposition einer Schilkr-Nachahmung („Hagars Klage“ von Schücking) Schuberts Begabung kennengelernt hat, wird seine Bereitschaft zum Eingreifen verständlich: hier galt es, ein
Talen aus dem Irrgarten zu befreien und
ihm die gegenpolige Grenze zu zeigen, von der aus es selbst den Weg zum Ausgleich finden wird. Die Kompositionen des Fünfzehnjährigen sind mächtige Deklamatorien Reichardtscher und Zumsteegscher Prägung, erhitzte Tonballungen, am gedichteten Bilde entzündet. Schillers „Erwartung“ erscheint der Anlage (nicht sosehr der Thematik) nach als Photographie des süddeutschen Stückes. Schuberts Musik aus dem Sklavendienste am Wort zu befreien, mußte des alten Praktikers eigenstes Anliegen werden. Und richtig: Wo eben noch hochdeklamatorischer Wirrwarr war, glätten sich die Wogen; es entstehen Sätze auf unverbindliche Worte einer Poesia per musica aus Metastasios Hand. Unermüdlich formt immer neue Musik die gleichen glatten Strophen neu. Das Ergebnis ist zweifellos ein wenig langweilig. Doch der lerneifrige Jüngling mußte durch das kaudinische Joch, wenn er sich, seih Ureigenstes finden wollte. \
Der Zusammenprall von Wort und Ton in der Gesangmusik erzeugt zwei äußerste Möglichkeiten der Formung: das Rezitativ mit der Ubermacht gesprochener, die Arie mit der Ubermacht musizierter Elemente; dazwischen hegen vermittelnde Mischgebilde aller Grade und Arten.
Der immer wieder gesuchte rezitativische Ton, mit dem der Musiker dem Dichter in dienender Haltung entgegentritt, steigert sich beim „Trost an Elisa“ (Matthispn) zu einem formlosen, aber unmittelbar ergrei-
' fenden Deklamationsstück, das in dieser Einseitigkeit unwiederholbar bleiben mußte: der Verzicht auf die Gestalt und Form bildende Eigenschaft der Musik war gegen das Wesentliche in Schuberts Natur. So kommt er denn zu jenen Doppel- und Mehrfachfassungen, die, wie es scheint, nur ihm eigentümlich sind. Nicnt aus der Skizze, nur aus der Wiederholung des an sich Fertigen gewinnt Schubert die Erkenntnis des ihm Notwendigen. Wer sich klar macht, daß jede folgende Fassung — er kommt bis zu sechs Wiederholungen ■— eine Kritik der vorhergehenden, eine höherstufige Auseinandersetzung mit dem Gegebenen sei, wird sich des ethischen Kraftstroms bewußt, der im naiven Grundbereiche wirksam sein kann. Es ist unserer
“Bewunderung ein Anliegen, aus der Fülle der Fälle wenige verschieden gelagerte herauszugreifen.
Der B3d reich tum von Schillers Gedacht
„Ach, aus dieses Tales Gründen“ hatte den jungen Enthusiasten zur Ausmalung der einzelnen, durch Vollkadenzen säuberlich voneinander getrennten Episoden verleitet. Hier setzt nach geraumer Zeit die Korrekt tur ein; che Musik erhält einen würdigen Teil ihrer vereinheitlichenden Formungsrechte: Schubert hat gesehen, auf was es ankommt. Die drei Fassungen von „Thekla, eine Geisterstimme“ gehen in dieser Richtung weiter: zunächst vollzieht sich der Vorgang in regelmäßigem Wechsel von rezitierten und melodisch entfalteten Strophen; dann werden alle deklamierten Bestandteile ausgeschieden und die Strophen für sich melodisiett; endlich wird che Melodik auf das Doppelte des bisherigen Umfangs erweitert, so daß je zwei Strophen unter ihr Dach treten. Der Sieg der Musik geht nicht auf Kosten, sondern zum Vorteil des Besiegten. Des Komponisten Aufgabe war, das weiß er jetzt, nicht: Bereicherung einer Kunst durch die andere; vielmehr galt es der von Grund auf selbständigen Darstellung eines in der Welt befindlichen Wertes durch die eigene Kunst. Und so gesehen wird sein Verfahren im Falle von Goethes Gedicht „Am Flusse“ wichtig. Hier korrigiert Schubert nämlich seine Gesamtauffassung der Vorlage: es entsteht, nach siebenjähriger Pause, eine mit dem ersten Stück überhaupt nicht mehr zusammenhängende völlig neue Bildung. War das Gedicht zuerst wörtlich genommen, wird es jetzt dem Sinne nach verstanden — so nämlich, wie Goethe es gemeint hatte, als er lächelnd die Schatten junger Tage beschwor: untragisch. Eieser Schritt Schuberts über sich selbst hinaus, das Vordringen von der Hülle zum Kern, sein Wesentlichwerden ist wert, erkannt zu sein; hier ist der Schlüssel zu manchem Rätsel, das dem Betrachter des Werks (auf vokalem Gebiete noch des kirchlichen und des dramatischen Bezirks) zu denken gibt. Wo keine Auseinandersetzung mit der Form nötig, nur schweigender Gehorsam geboten ist, da wächst Schubert zu unnachahmlicher, wenn auch nicht zeitentbundener Größe auf: in seinen Tänzen. -
Wie Beethoven bei aller Ruhe, die es gibt, ein unruhiger Gast der Erde ist, so ist Schubert zutiefst befriedet. Was C. F. Meyer unter dem Bilde eines römischen Brunnens sah und pries, das preisen und sehen wir in seinem Anblick: „er strömt und ruht“.