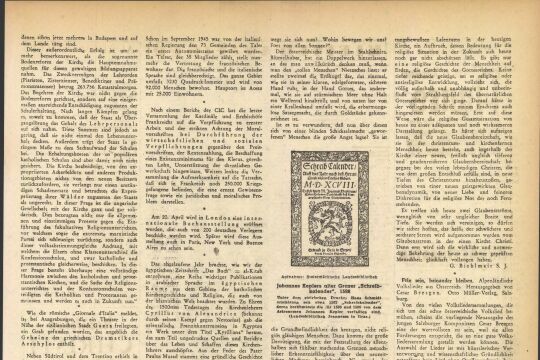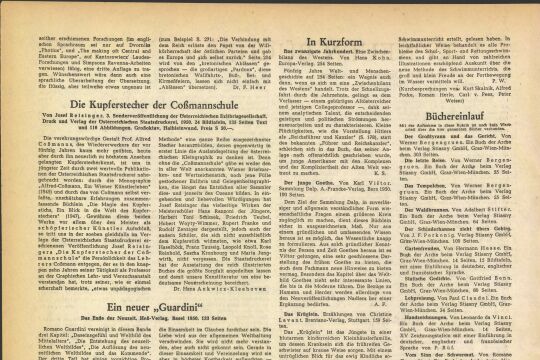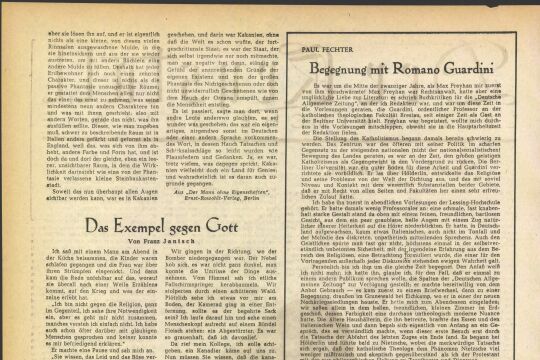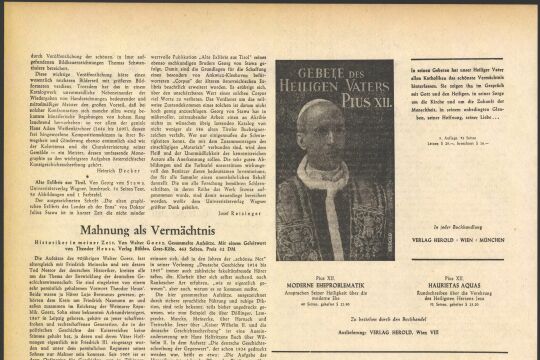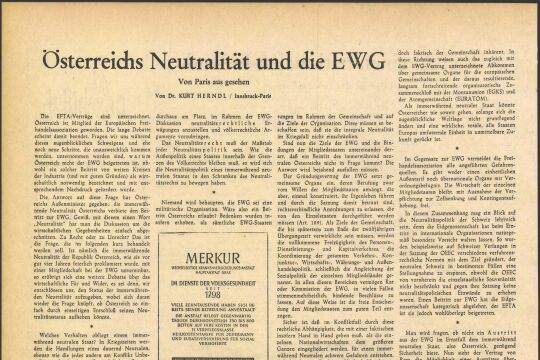Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Aus dem Ursprung
Seit dem Tode Romano Guardinis 1968 ist es still um ihn geworden. Guardini war nach dem Zeugnis vieler seiner Schüler ein Lehrer, der wirklich meinte, was er sagte, wenngleich er nicht immer alles sagte, was er dachte. Er erschien seinen Studenten und Freunden als ein mutiger und entschieden eindeutiger Mann der Kirchenreform. Der Religionswissenschafter Heinz Robert Schlette nennt ihn einmal einen Reformer lange vor dem Konzil; in einer Zeit also, in der es nur wenige Reformer gab, die zumeist
als einzelne einen schweren Stand hatten.
Guardini war lange Jahre hindurch umstritten, nicht zuletzt von all jenen Theologen und kirchlichen Amtsträgern, die den Neuerungen im liturgischen Bereich sowie seinen Sympathien für die Jugendbewegung sehr
skeptisch gegenüberstanden. Aber Guardini schlug besonnen den Weg der Reform ein. er hatte nicht nur den ersten Mut, der den Anfang macht, sondern erst recht den zweiten Mut des Durchhaltens, der nicht selten den härteren Einsatz erfordert. Wenn man heute fragt, ob es so etwas wie eine „Wende“ bei Guardini gab, so erhält man wohl die beste Auskunft auf Grund des Buches „Das Ende der Neuzeit“ (1950), ein Buch, das er zurückhaltend einen „Versuch zur Orientierung“ nennt, das aber sicher eines der bedeutendsten deutschen Bücher der Nachkriegszeit darstellt. Bis heute, meint Schlette, habe dieses Buch an diagnostischer und prognostischer Kraft nichts verloren, wie immer man auch zu der Grundthese stehen mag, die Neuzeit habe sich dem Ende zugeneigt und eine neue Epoche zeichne sich bereits ab, mit neuen Tugenden, neuen Maßstäben und neuen Bedrohungen.
Guardini skizziert dort, wie sich in der Neuzeit eine neue, den christlichen Horizont ablösen wollende Ganzheit der Weltauslegung bildet, die trotz aller Divergenzen eine gewisse Homogenität besitze. Eben diese Homogenität gehe aber im 20. Jahrhundert verloren und damit auch jene Werte und Wirklichkeiten, die in der Neuzeit noch Anerkennung gefunden hatten, wie die „Persönlichkeit“ oder auch das, was man mit einigem Respekt als die „Natur“ akzeptierte.
Dieses löse sich jetzt auf; der Mensch werde noch mehr als bisher auf sich selbst gestellt, er werde noch mehr die Abwesenheit von Grundwerten erleiden müssen. Er stehe unter der Bedrohung durch ins Unermeßliche anwachsende technisch-wissenschaftliche und politische Macht und werde in der großen Menge der Menschen sein Personsein zu behaupten haben, während die Persönlichkeit mit der Neuzeit unwiederbringlich vergangen sei.
Romano Guardini hat das Ausmaß der Krise, in die der Glaubende durch die Neuzeit und
Nachneuzeit hineingestellt wurde, illusionslos erkannt und auch beim Namen genannt. Er schrieb schon vor mehr als 20 Jahren: „Die Einsamkeit im Glauben wird furchtbar sein. Die Liebe wird aus der allgemeinen Welthaltung verschwinden. Sie wird nicht mehr verstanden noch gekonnt sein. Um so kostbarer wird sie werden, wenn sie votn Einsamen zum Einsamen geht.“
Diese extreme Situation, in der die Realität von Kirche als Gemeinde völlig zurücktritt, hat für Guardini eschatologischen Charakter, nicht im zeitlich-geschichtlichen Sinne, sondern, wie er sagt, „wesensmäßig“. In ihr gelte es standzuhalten, vielleicht schweigend, sicher aber in Geduld und nicht ohne jene Frage im Herzen, die Guardini dem Engel im letzten Gericht stellen wollte: „Warum, Gott, zum Heil die fürchterlichen Umwege, das Leid der Unschuldigen, die Schuld?“
Die Tugenden, für die Guardini vehement eintritt, sind Ernst, Tapferkeit, Kameradschaft, Fairneß und Askese. Diese werden angesichts des „Chaos“ aus den Erfordernissen der veränderten Situation der Menschheit und nicht mehr aus intuitiven Wertgefühlen oder Reduktion auf die reine Wesensschau gewonnen. So schreibt Guardini, bevor er die Tugenden skizziert, die in einer neuen, „nicht mehr kulturellen Kultur“ gelten müßten: „Das Kernproblem, um das die künftige Kulturarbeit kreisen und von dessen Lösung alles, nicht nur Wohlfahrt oder Not, sondern Le-
ben oder. Untergang abhängen wird, ist die Macht. Nicht ihre Steigerung, die geht von selbst vor sich; wohl aber die Bändigung, ihr rechter Gebrauch.“
Was Guardini unter dem „neuzeitlichen“ Menschen versteht, kritisiert und für beendet erklärt, das meint eine Situation, die, wie er selbst andeutet, vorwiegend in Europa und Amerika anzutreffen ist.
Auffallend im Gesamtwerk Guardinis ist das Fehlen einer kritischen Prüfung der theoretischen Fragen des Marxismus, von dessen politisch-totalitaristischer Praxis er sich häufig abgrenzt. Der Basler Theologe Hans Urs von Balthasar sah sich aus diesem Grunde zur Feststellung veranlaßt: „Man wird Guardini vielleicht einen Vorwurf nicht ersparen können, aus der bürgerlichen Welt, deren Unterhöhlung und Einsturz er miterlebte, als Christ nicht entschlossen genug herausgetreten zu sein. Hat er je der schreienden materiellen Not der menschlichen Massen scharf ins Antlitz geschaut? Das Entsetzen des jungen Marx vor der Welt, wie sie wirklich ist, verspürt?“
Dieser Vorwurf ist unberechtigt. Guardini brauchte eine bürgerliche Welt nicht z.u verlassen, denn er war ein philosophisch-intellektueller Mensch, für den die Kategorie „bürgerlieh“ nicht anwendbar ist.
Heilung sah Romano Guardini nur in einer neuen Inkarnation des Christlichen, in der Überwindung jener Sezession, die zu einem „chemisch reinen Christentum“ ohne weltliche Zeugungskraft führt.
Die christliche Freiheit ist eschatologisch, deshalb wird sie innerweltlich immer als ethische Utopie erscheinen. Dennoch sollte man nicht vergessen, wie viele „Utopien“ Vorformen von Realitäten gewesen sind. Das besagt, daß der Christ zwar keinen immanenten Fortschrittsglauben teilt, an Stelle des Fortschritts die Metanoia verkündet, daß er aber wesentlich aus der Hoffnung lebt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!