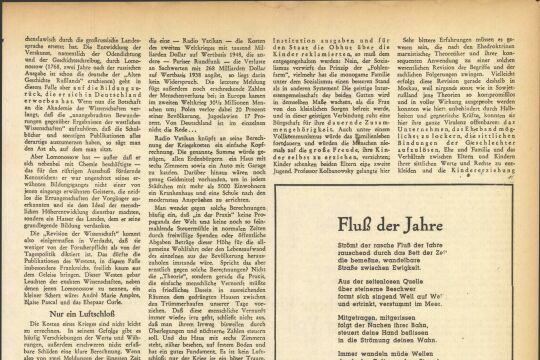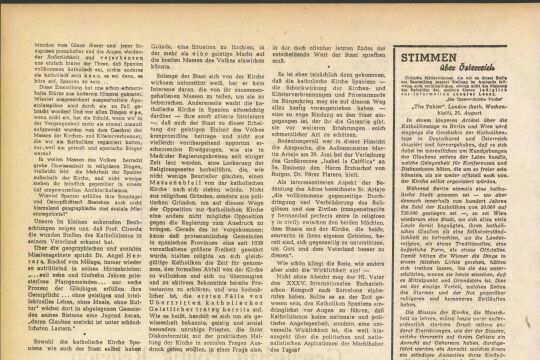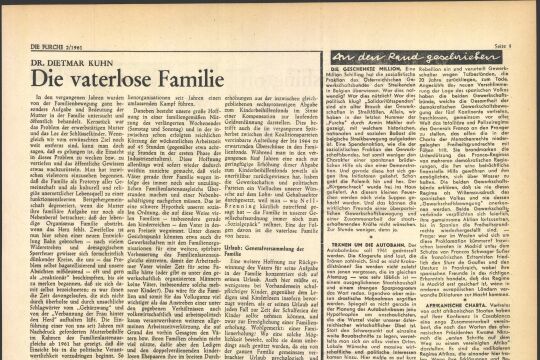Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Christliche „Spinner" am Golf
Als Gabriele H., 30, im vergangenen Sommer eine acht Wochen alte Schwangerschaft abbrechen ließ, fühlte sie sich zunächst erleichtert, später verstimmt und nervös.nbsp;. raquo;
Das gab sich, sobald sie im August mit ihrem Mann und ihrer neunjährigen Tochter zum Urlaub nach Rhodos flog. Im September nahm sie ihr normales Leben wieder auf.
Die Erinnerung an den Arzt und das kalte Licht auf dem gynäkologischen Operationsstuhl hatte sie längst beiseite geschoben. Unter normalem Leben versteht Gabriele H. ihre hübsche Wohnung, die freundliche Aufbewahrung der Tochter in einer Privatschule mit Halbinternat, die beruflichen Erfolge ihres Mannes, ihre eigene Karriere in der Bank.
Das sind die Grundlagen ihrer Selbstsicherheit und Unabhängigkeit, die nicht nur vordergründig-materielle Bedeutung hat, sondern geradezu eine zwingende innere Notwendigkeit darstellt.
Das zweite Kind, das sich unerwartet angemeldet hatte, paßte nicht in ihre Vorstellung von Leben; es hätte das ganze Gebäude einstürzen lassen, das sie mit viel Energie aufgebaut hatte und nur funktionierte, weil sie immer bemüht war, das Gleichgewicht zu halten zwischen Haushalt und Beruf, Ehemann und Schulkind, Freizeit und Freunden.
Die Abtreibung hinterließ kaum eine Spur in ihrem Gewissen. Käme sie noch einmal in dieselbe Lage, würde sie sich abermals gegen ein Kind entscheiden.
Sie ist nur eine von vielen tausend Frauen, die aus ähnlichen Motiven abtreiben. Das alles spielt sich vor einem präzis beschreibbaren gesellschaftlichen Hintergrund ab; es hat mit den Wechselbeziehungen zwischen dem Verhalten und der seelischen Landschaft des einzelnen und den Zuständen in der Gesamtgesellschaft zu tun.
In der veränderten Stellung der Frau, der damit verbundenen Ablehnung des Kindes, abzulesen an der geringen Kinderzahl pro Familie und der rückläufigen Geburtenrate, in gestörten Beziehungen innerhalb der Familien, sichtbar gemacht an Scheidungshäufigkeit und Selbstmordneigung, sieht die Psychologin Anneliese Fuchs (Institut für Präventivpsychologie, Wien) negative Auswirkungen von Prozessen, welche nicht bloß die Familie, sondern die Gesellschaft als Ganzes bedrohen.
Bis zur beginnenden Industrialisierung waren Lebensraum der Familie und Bereich der Arbeit weitgehend eine Einheit, die Rolle der Frau darin unbestritten. Sie hatte die Produktion von Kleidung und Nahrung in der Hand, als Mitarbeiterin des Mannes war sie mit unersetzbaren Qualitäten ausgestattet. So unbeschwert von Rollenproblemen und selbstbewußt sind heute höchstens die Bäuerinnen.
Kinder, damals geschätzt und erwünscht, wuchsen in großen Familien mit vielfältigen sozialen Beziehungen auf. Heute sind Arbeitsbereich und Lebensraum der Familie total getrennt. Gesellschaftlich anerkannt und privilegiert ist allein die Tätigkeit in der Berufswelt; dort dominieren die aggressivmännlichen Qualitäten und bestimmen Leistung und Erfolg.
Die Familie selbst ist geschrumpft auf den kleinstmöglichen Kern: Vater, Mutter Kind(er). Prestige hat der, der im Berufsleben steht, etwas produziert, macht, vermittelt, leistet.
Was innerhalb der Familie passiert, das Bekommen, Aufziehen und Erziehen der Kinder und der ganz alltägliche banale Haushaltskram ist unwichtig und uninteressant. Nicht außerhäuslich erwerbstätige Mütter und Hausfrauen gelten als Leute ohne Beruf, haben kein gesellschaftliches Prestige, ihre Arbeit wird kaum als solche eingeschätzt.
Der Vater tritt nur mehr als Freizeitvater, beschränkt auf wenige Wochenstunden, in Erscheinung; er lebt, auch wenn er sie liebt, in einer gewissen Distanz zu den Kindern und nimmt ihre Existenz und ihre Bedürfnisse vor allem dort wahr, wo sie Geld kosten.
Die Mutter, ausgeschlossen von jenen vermeintlich wichtigen Bereichen, in denen sich angeblich das wirkliche Leben abspielt, gerät in zunehmende soziale Isolation, die sie immer schlechter aushält. Sie verlangt nach Anerkennung und Erfolg und sucht diesen, wie der Mann, im Beruf.
Zurück bleiben die Kinder, mehr oder weniger allein gelassen; die Familie zerfällt. Auf der Strecke bleiben Werte wie Zuwendung, Anpassung, Güte, Mitleid, Barmherzigkeit, Mütterlichkeit. Das allerdings sind Dinge, ohne die ein Mensch verkümmert.
Die Kinder vermissen Liebe und Wärme, suchen sie außerhalb des Elternhauses.
Wer kein intaktes Familienleben kennt, entwickelt sich allzu leicht zum neurotischen Egozentriker, der in privaten Beziehungen wie in größeren Zusammenhängen unfähig zu Verantwortung und Leistung ist.
Das Absinken des Heiratsalters, die Neigung zu sehr früher Mutterschaft bei gleichzeitigem Absinken der Geburtenhäufigkeit und die ständige Zunahme von Scheidungen nach zu kurzer Ehedauer, das alles sind Alarmzeichen einer psychisch nicht mehr intakten Gesellschaft.
Da greift eins ins andere: wo die Ehe als Institution und Wert angezweifelt wird, die Existenz von Kindern gleichgesetzt wird mit finanzieller Belastung und Einschränkung der Handlungsfreiheit der Eltern, wird es allzu leicht zur Selbstverständlichkeit, sich ungewollt empfangener Kinder durch Abtreibung zu entledigen.
Der zerstörerischen Flucht der Mütter aus den Familien müßten konkrete praktikable Lösungen entgegengesetzt werden, Rettungsaktionen für die Familie und die Gesellschaft.
Die Liste von Modellvorschlägen ist lang und reicht von Anerkennung und Aufwertung der Halbtagsarbeit für Frauen, Förderung der weiblichen Kreatitivät, Stützung der Eigeninitiative (etwa bei der Bildung von Selbsthilfeorganisationen) bis zu alternativen nachbarschaftlichen Wohnformen und Anerkennung der Erziehungsarbeit durch ein Müttergehalt.
Frauen wie Gabriele H. sind skeptisch. Seit sie im dritten Ehejahr ihre kleine Tochter im Kindergarten deponiert hat und ins Büro zurückgelaufen ist, weil sie „sonst wahnsinnig geworden wäre", hat sie bis heute für sich noch keine andere Möglichkeit gefunden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!