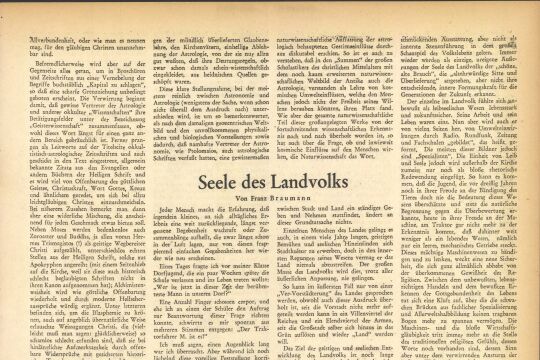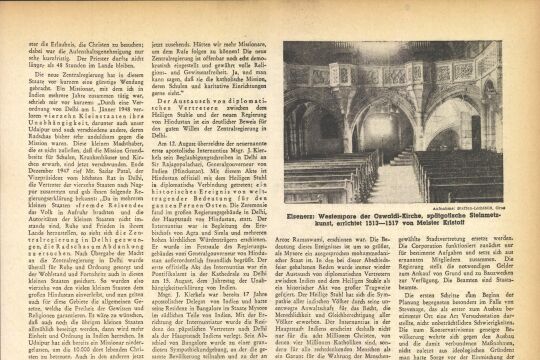Pyramiden für Möchtegern-Pharaonen
Gegen die heutigen Formen des sozialen Wohnbaues wandte sich vor einiger Zeit in einer Fernsehdiskussion der bekannte Architekt Prof. Dr. Roland Rainer. Sein Gegenvorschlag: aufgelok-kerte Gartensiedlungen und vor allem das, Atriumhaus als echter LJebensraum für die Familie.
Gegen die heutigen Formen des sozialen Wohnbaues wandte sich vor einiger Zeit in einer Fernsehdiskussion der bekannte Architekt Prof. Dr. Roland Rainer. Sein Gegenvorschlag: aufgelok-kerte Gartensiedlungen und vor allem das, Atriumhaus als echter LJebensraum für die Familie.
Die besondere Würze jenes Podiumgespräches bestand darin, daß Professor Rainer selbst Wiener Stadt-planer gewesen ist, aber angesichts der Widerstände, auf die er stieß, sehr bald wieder seinen Hut genommen hat. Bei der Diskussion saß er nun seinem ehemaligen Chef, Stadtrat Heller, gegenüber. Dieser gab sich zwar sehr freundlich und verständnisvoll, wischte aber mit der lächelnden Überlegenheit des Praktikers die Ideen des Professors kurzweg vom Tisch. Heller belehrte leutselig-herablassend: die Vorschläge seien zwar sehr schön, aber undurchführbar, weil einfach zu teuer. Die Stadt Wien, darauf liefen die Ausführungen des Stadtrates hinaus, müsse angesichts des gewaltigen Wohnbedarfes, den es zu befriedigen gibt, und der Knappheit ihrer Mittel haushalten, um ihre Bürger so billig und rasch wie möglich mit modernen Wohnungen zu versorgen. Für solche Ausgefallenheiten wie das Atriumhaus sei da kein Platz, es sei denn in der einen oder der anderen Mustersiedlung. Der Massenbedarf könne auf lange Zeit nur durch Wohnblöcke befriedigt werden.
Reste des Krieges
Theorie und Praxis, Wunschträume und Wirklichkeit. Lassen sich die StartflpünKtfe desi- Profesisors und des Stadtrates auf diese einfache Formel bringen? Oder geht es um mehr, um Grundsätzliches?
„Wir stehen nicht am Ende der Woh-nungs- und Städtebaupolitik, sondern am Beginn einer neuen Etappe"‘, schrieb der deutsche Wohnbauminister Lauritz Lauritzen in dem von ihm herausgegebenen Sammelband über „Städtebau der Zukunft", denn, so stellte er weiter fest, „der Schwerpunkt der Aufgaben im Wohnungswesen tmd Städtebau verlagert sich von der Schaffung neuer Wohnviertel zur Erneuerung überalterter Wohngebiete … Voraussichtlich wird ein erheblicher Teil der zehn Millionen Wohnungen, die aus der Vorkriegszeit stammen, in den nächsten 20 bis 25 Jahren modernisiert oder sogar abgebrochen und durch Neubauwohnungen ersetzt werden müssen. .. Künftig geht es … In stärkerem Maße um die Erneuerung und Weiterentwicklung bereits bewohnter Flächen und gleichzeitig um die Überwindung der Unzulänglichkeiten, die sich aus der städtebaulichen Entwicklung in der Vergangenheit ergeben haben."
Was hier angestrebt wird, 1st nicht einfach Schaffung neuen Wohnraumes für den Bevölkerungszuwachs und Ersatz abgewohnter, baufälliger Häuser, sondern weitgehender Neubau der Städte überhaupt. Das Werk, das die Bomben des letzten Krieges unvollendet ließen, sollen nvm Spitzhacke und Bulldozer nachholen. Lc Corbusiers schon vor einem hsdben Jahrhundert gestellte Forderung, die alten Städte zu schleifen und durch neue, bessere zu ersetzen, soU nun Wirklichkeit werden. Eine Vision, die noch vor wenigen Jahrzehnten als Wahnwitz galt, scheint nun erfüllbar geworden. Von diesen Ziel Vorstellungen geht auch die Wiener Stadtverwaltung bei ihrer scheinbar so praktischen und wirklichkeitsnahen Planung aus. In
Österreich ist man nämUch unter der gemütlichen Oberfläche radikaler als in der Bundesrepublik: Lauritzen räumt noch die Möglichkeit ein, Althäuser zu modernisieren, in Österreich, insbesondere in Wien, will man davon grundsätzlich nichts wissen. Das Althaus soll, von einigen Museumsstücken abgesehen, überhaupt verschwinden, es soll, solange es besteht, so unmodern wie möglich sein, um ungünstig vom Neubau abzustechen. Daran ändert wohl auch das kürzlich von Bürgermeister Slavik abgelegte Lippenbekenntnis zur Altstadterhaltung nichts; es war zu verschwommen und verklausuliert, um auf ein grundsätzliches Umdenken schließen zu lassen. Wieviel man sich vorgenommen hat, ließ Bautenminister Moser bed seinem Amtsantritte mit der Ankündigung erkennen, er wolle die jährliche Wohnbauleistung von ruijd 50.000 Einheiten um jährlich 5000 auf schließlich 100.000 im Jahre 1980 steigern; das ergäbe, sofern nicht die Finanzlage einen Strich durch die ehrgeizige Rechnung macht, in 20 bis 25 Jahren eine Bauleistung, die, gemessen an der Bevölkerung, die hochfliegenden deutschen Pläne noch um einiges übertrifft. Fredlich denkt auch Lauritzen weniger an Modernisierung des Altbestandes denn an Neubau, da jene die Entscheidung über das individuelle Objekt erforderte, der deutsche Wohnbauminister aber in ganzen Ortschaften und Stadtteilen denkt. Ein neues Schlagwort wurde geboren: die Flächensanierung. Und wie einst dem Handel die Flagge, so folgt heute dem Schlagworte der Gesetzesentwurf. Lauritzen verkündet: „Das Städtebauförderungsgesetz soll den Gemeinden das rechtliche und organisatorische Instrumentarium an die Hand geben, um die große Zukunftsaufgabe der Erneuerung und Entwicklung unserer Städte und Dörfer bewältigen zu können." In Österreich spricht man bescheiden von einem Assanderungsgesetz und entwirft mit dieser Namensgebung nicht das Positivbdld der Stadt von morgen, sondern das Negativbild des gesundheitsschädlichen Elendquartiers von heute. Das hat nicht nur den Vorteil, dem Gesetzgeber das moralische Recht auf härtere Em-grifle einzuräumen (tatsächlich Ist der österreichische Entwurf in vieler Hinsicht radikaler als der deutsche), sondern entschuldigt auch Stadtplaner imd Architekten von vornherein für eine imzulängliche Erneuerung; es waren eben Dringlichkeitsmaß-nahmen, Notlösungen. Ganz auf dieser Linie liegt auch das immer wieder abgelegte Bekenntnis zum billigsten Bauen.
Der radikale Standpunkt einer Totalemeuerung der Städte zwingt aber zum quantitativen Denken, zur Beschaffimg von möglichst viel modernem Wohnraum auf raschestem Wega und zu niedrigsten Kosten; er verbietet den Bau von GarterfSiedlimgen und Atriumhäusern als unverzeihlichen Luxus. „Fri-volous projects" würden die Engländer sagen, in deren Sprache mehr vom puritanischen Erbe fortlebt, als ihre heutii^e Lebensauffassung wahrhaben will.
Dem steht das qualitative Denken gegenüber, wie es zum Beispiel auch Professor Rainer vertritt: behutsame Stadtemeuerung, Modernisierung des Althausbestandes, weniger, dafür aber mustergültige Neubauten, punktuelle statt Plächensanlerung, Ensembleschutz statt Planierung, gewachsene Siedlungen statt Reißbrettentwürfen.
Diese Möglichkedt einer zweiten Problemlösung relativiert natürlich die „praktische" Einstellung des Wiener Stadtrates, denn sie ist nicht praktisch und wirtschaftlich schlechthin, sondern nur unter der Voraussetzung, daß man die Radikalemeue-rung als unbedingt notwendig anerkennt; sobald man Zweifel an der Richtigkeit dieser Lösung hegt, bricht die Rechtfertigung in sich zusammen.
Hier stehen, und das gilt weltweit, zwei unvereinbare Standpunkte einander gegenüber; Zwischenlösungen sind kaum möglich, etwa, indem man „hie und da einmal" auch Mustersiedlungen errichtet und ein paar Althäuser (als Alibi oder abschrek-kendes Beispiel?) stehen läßt. Derlei Kompromisse sind von vornherein faul.
Keine Lösung hat Anspruch auf Alleingültagkedt, Flächensanierung ist wahrscheinlich unvermeidlich etwa in Istanbul, das Alexander von Humboldt zwar zu den sieben schönsten Städten der Welt gezählt hat. deren malerische, aber morsche Holzhäuser als letzte Spuren der Altstadt (Paläste, Moscheen und ähnliches ausgenommen) kaum zu retten sind, ebenso bed Arbeitersiedlungen aus dem vorigen Jahrhundert in manchen engMschen Industriestädten und in gewissen Teilen amerikanischer Städte (nicht immer jenen, die bereits tatsächlich „flächensandert" wurden), um nur einige Beisi>iele zu nennen.
Hingegen ist die sachliche Notwendigkeit einer Hächensanierung in Wien nur in wenigen Fällen gegeben. Der vielbeklagte niedrige Wohnstandard hat seinen Grund im allgemeinen nicht in an sich schlecht gebauten Althäusem oder schlecht angelegten Stadtvierteln, als vielmehr in der tatsächlichen Verhinderung der Modernisierung durch den Gesetzgeber seit mehr als einem halben Jahrhundert.
Wohnungsmangel in Wien?
Über den Umfang des „erhaltungswürdigen Althausbesitandes" gibt es keine Erhebungen, nicht einmal brauchbare Begriflsdefinitionen. Fachleute schätzen aber, daß die Mehrheit der Wiener Althäuser mit einem Bruchteil der Abbruch- und Neubaukosten auf den ungefähren Standard des durchschnittlichen Sozialbaues von heute gebracht werden könnten (wobei Abweichungen von der Neubaunorm nicht unbedingt Nachteile sein müßten). Das Konzept einer kostspieligen und letztlich doch unzulänglichen Totalsanierung wird fragwürdig. Gerade für Wien wäre der qualitative Standpunkt eigentlich der durchwegs richtige, da die Bombenschäden hier, verglichen mit westdeutschen Städten, bescheiden waren, und diese Stadt nicht mit dem Problem des sprunghaften Bevölkerungswachstums kämpft? sondern im Gegenteil um rund eine halbe Million Einwohner weniger als zu Zeiten der Monarchie hat.
Mit Recht heißt es, daß Wien keinen quantitativen, sondern nur einen qualitativen Wohnungsmangel habe; diesen lediglich durch Neubauten statt durch Verbesserung des Bestehenden beheben zu wollen, ist weder praktisch noch wirtschaftlich und schon gar nicht zeitsparend.
„Rausch am Reißbrett"
Die bis vor kurzem hochgejubelte radikale Stadtemeuerung hat übrigens in anderen Ländern schon viel von ihrem Nimbus eingebüßt. Ein bezeichnender Fall ist das Märkische Viertel in Berlin, mit dessen Bau 1963 begonnen worden ist, und das bis 1972 vollendet sein soll. 17.000 Wohnungen für 60.000 Menschen werden geschaffen und sind zum Großteil schon bezogen; 1,5 Milliarden D-Mark sind als Baukosten veranschlagt.
Was hat es nun mit diesem überschwänglich mit Vorschußlorbeeren bedachten Vorhaben auf sich? „Der Spiegel", sonst allem Progressivem aufgeschlossen, berichtete kürzlich über Proteste und Beschwerden der Bewohner dieses Riesenwohnblockes. Als maßgebliches Urteil zitiert er imter anderem das des Arztes Dr. Dietrich Mackrodt, der den Bau „menschenverachtend" nennt; die Architekten hätten sich „dem Rausch am Reißbrett hingegeben". Der Pfarrer Johannes Hoene stÄte fest: „An den Menschen haben sie nicht gedacht; sie wollten nur etwas vorweisen zu Ihrem eigenen Rühm und Stolz." Hier wird der auch anderswo geäußerte Verdacht laut, daß es bei den modernen Großbauten nicht sosehr um Erfüllung sozialer Aufgaben gehe, sondern um den Ruhm (und das Geschäft) der Architekten und Bauherren, also einerseits um die Durchsetzung theoretischer Bau-Tconzepte, anderseits um einen möglichst bequemen und weithin sichtbaren „Leistungsnachweis" für Politiker. Möchtegempharaonen errichten ihre Pyramiden, gigantische Grab-mäler des verstorbenen Wohnbehagens.
Erst recht in Amerika, wo sich die Flächensanierung bereits gründlich ausgetobt hat, breitet sich wachsendes Unbehagen aus, dem Jane Jacobs in ihrem Buche „Tod und Leben großer amerikanischer Städte" wahrhaft apokalyptischen Ausdruck verleiht:
„Man sehe sich an, was wir mit den ersten paar Milliarden gebaut haben: Siedlungen für Minderbemittelte, die schlimmere Brutstätten für Verbrechertum, Vandalismus und soziale Hoffnungslosigkeit geworden sind als .iene Slums, die sie ersetzen sollten; wir haben Wohnviertel für mittlere Einkommen gebaut, die, wahre Wunder an Langeweile und Uniformität, fest verriegelt sind gegen jegliche Schwungkraft eines Großstadtlebens … Damit solche Wunder vollbracht werden können, werden die Menschen, die mit dem Hexenmal der Planer gezeichnet sind, herumgestoßen, enteignet, entwurzelt…" Dieses Werk erregte jenseits des Atlantiks großes Aufsehen; man vergleicht seine Wirkung auf die öffentliche Meinung mit der von Rachel Carsons „Schweigendem Frühling". Es soll nicht zuletzt Jane Jacobs’ Verdienst sein, daß mancherorts bereits eine Abkehr von der Flächensanierung und eine Zuwendung zur punktuellen Sanierung erfolgt. Der Bau neuer Stadtteile und die Flächensanierung sind, wie sich immer deutlicher zeigt, keine echte Lösung; sie schaffen mehr „Urbane Funktionsschwächen" als sie behe-
ben, der riesige Aufwand, den sie erfordem und der dann wieder zur Sparsamkeit am falschen Orte zwingt, steht in keinem Verhältnis zum Erfolg. Die siebziger Jaiire, die anscheinend zum Jahrzehnt der Ernüchterung werden, dürften auch in der Städteplanung ein Umdenken mit sich bringen.