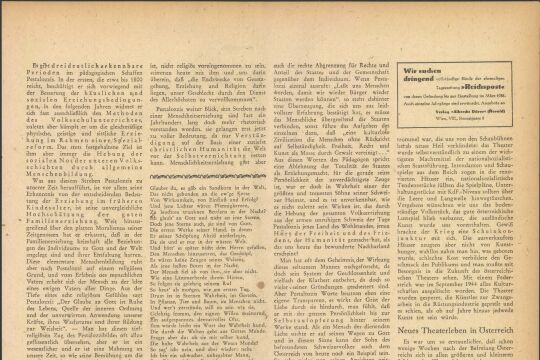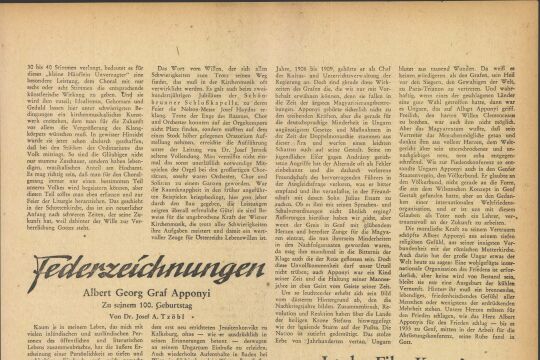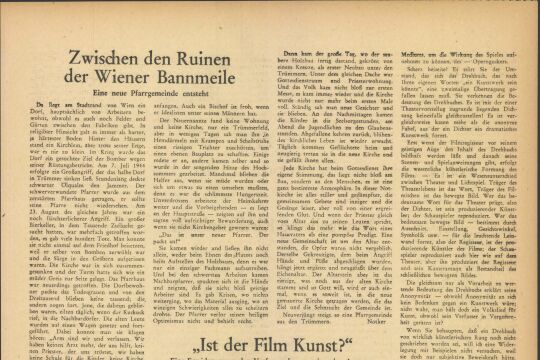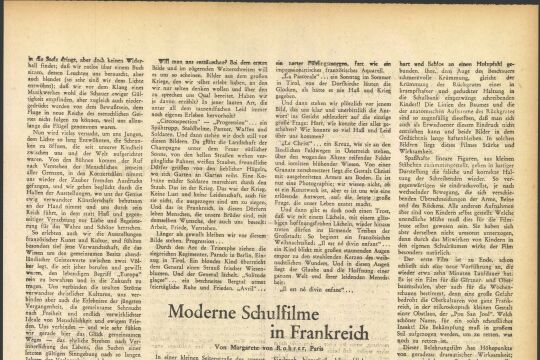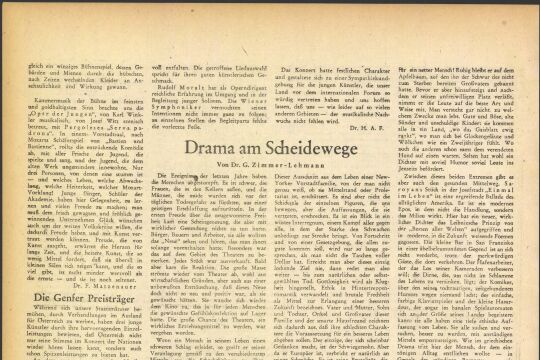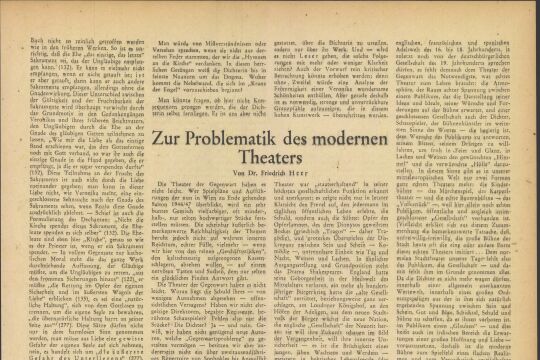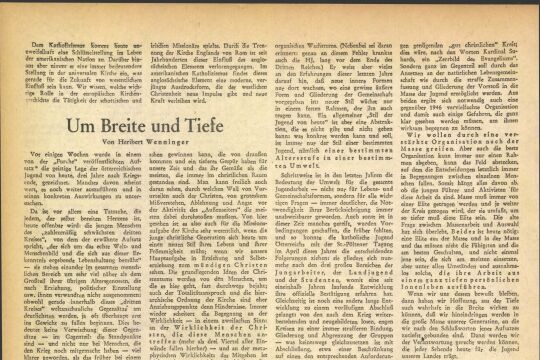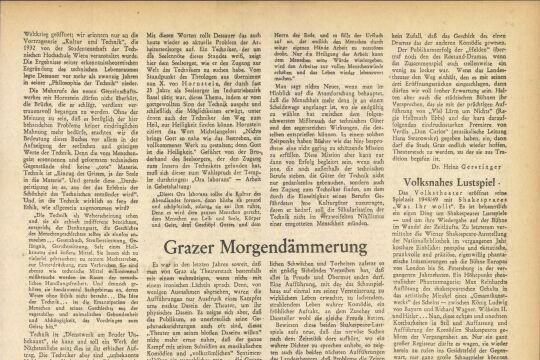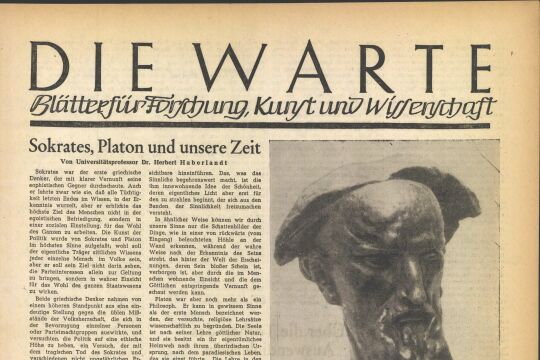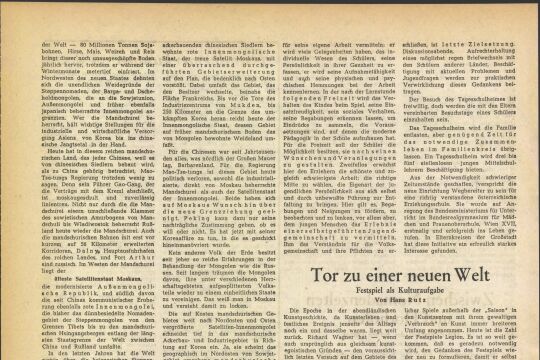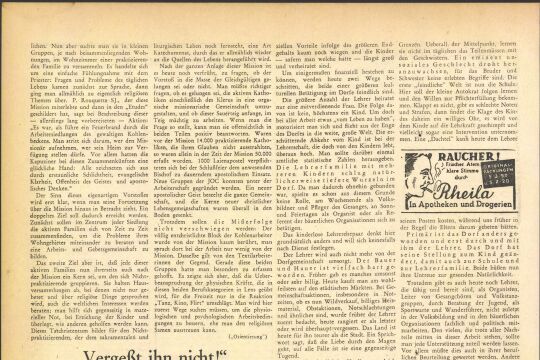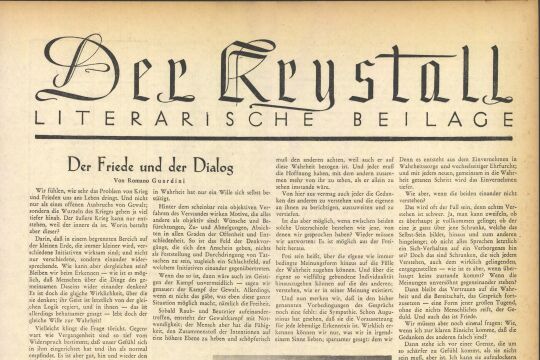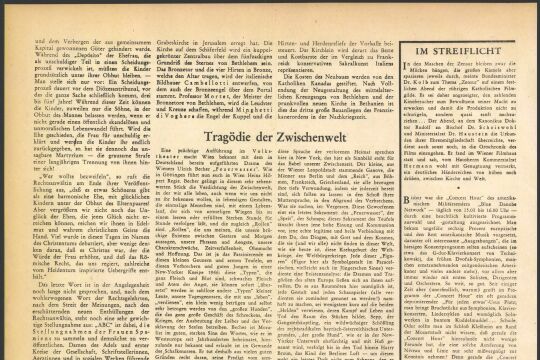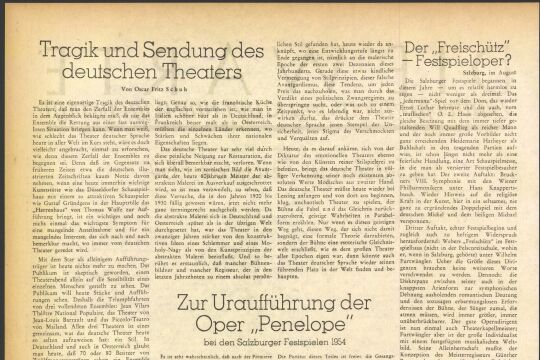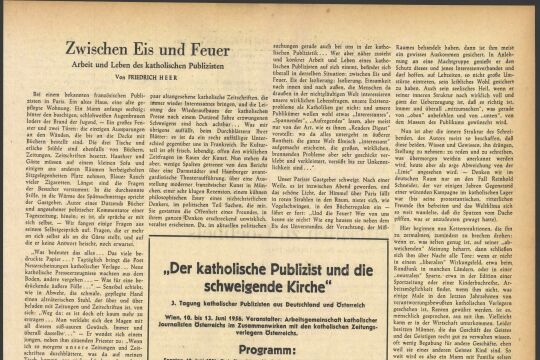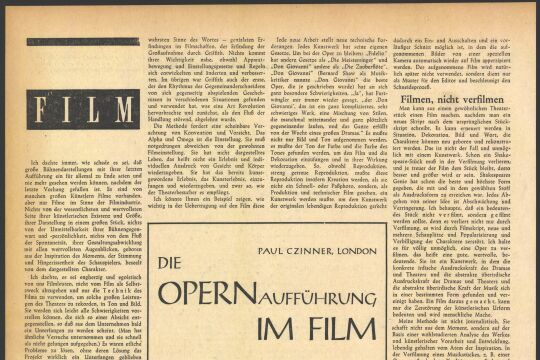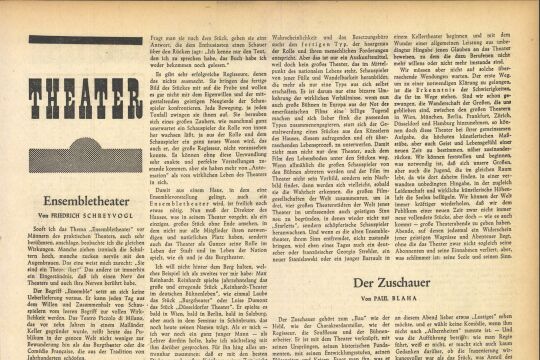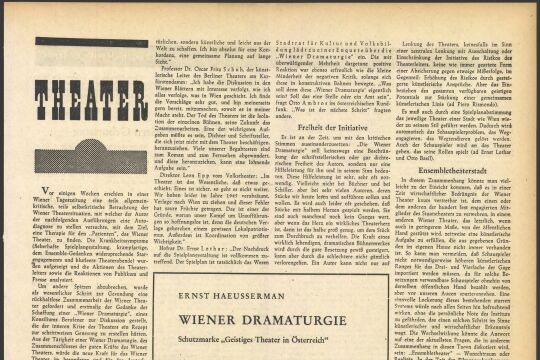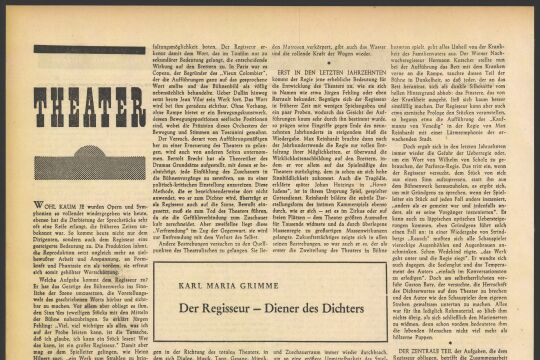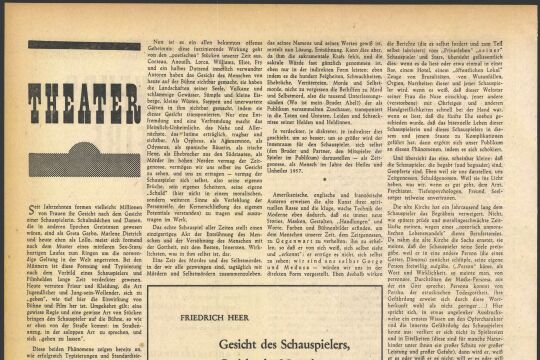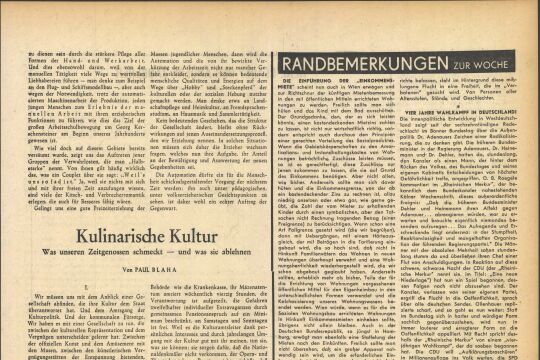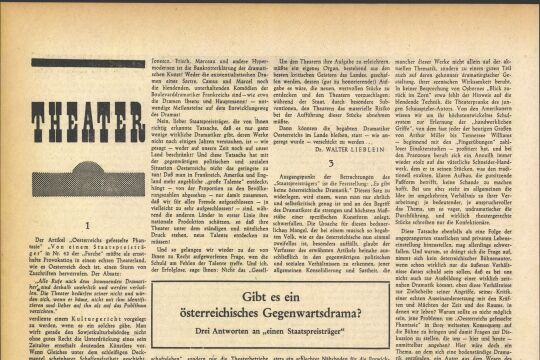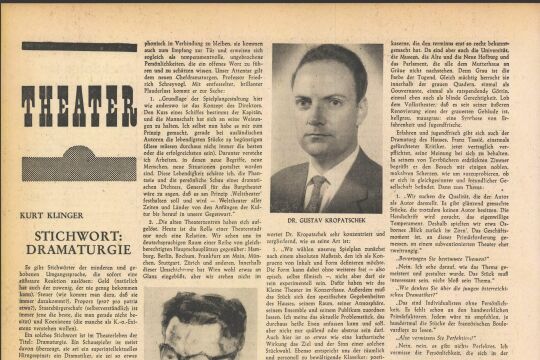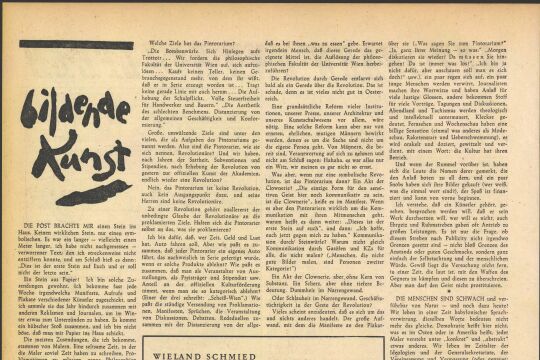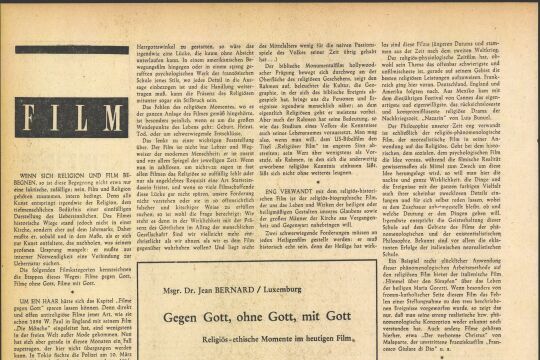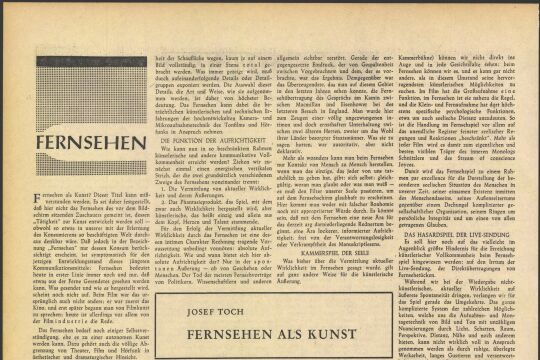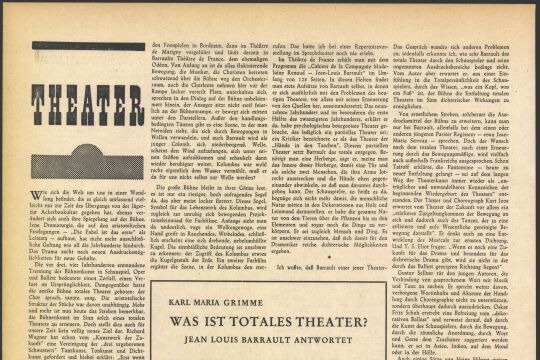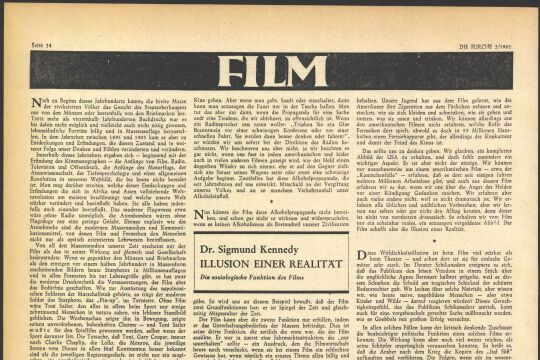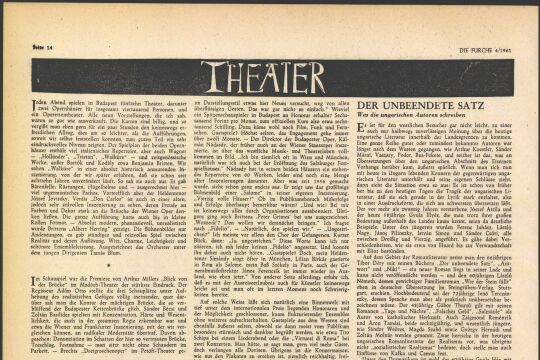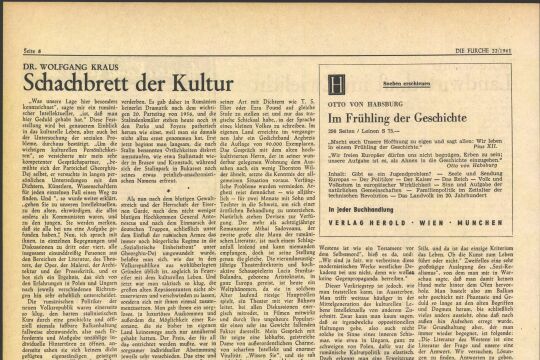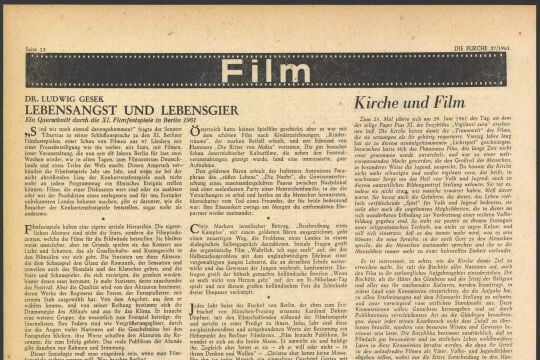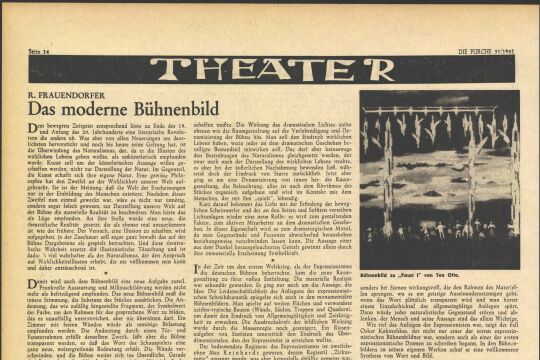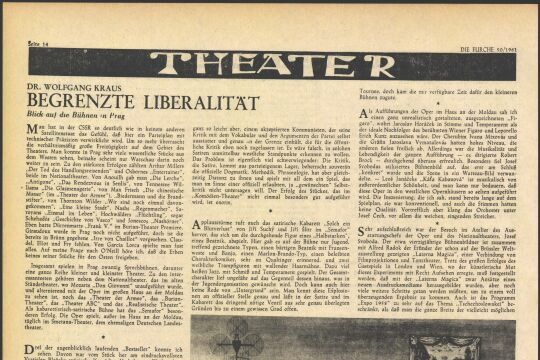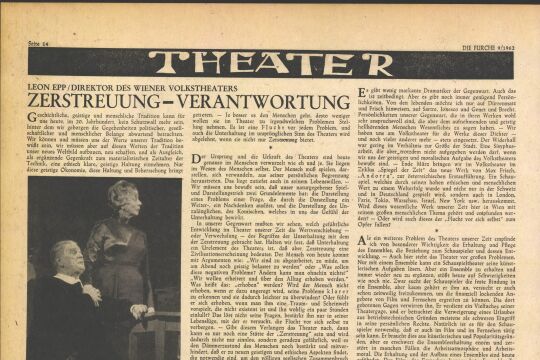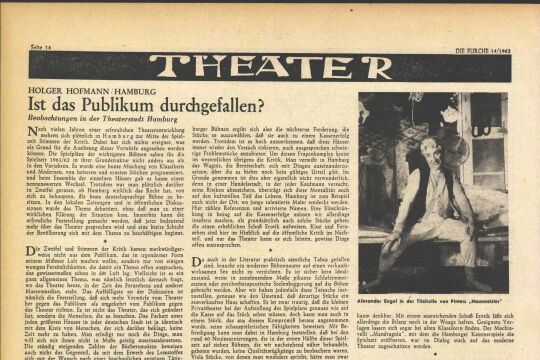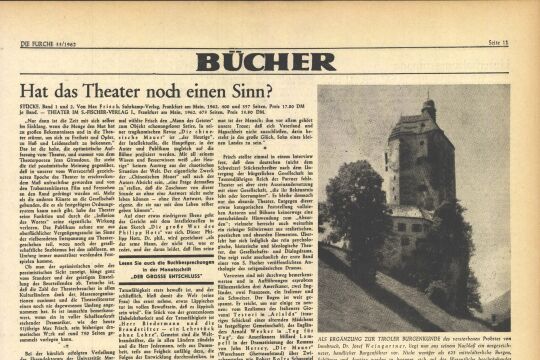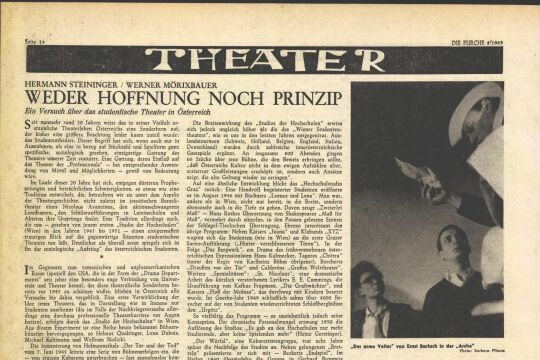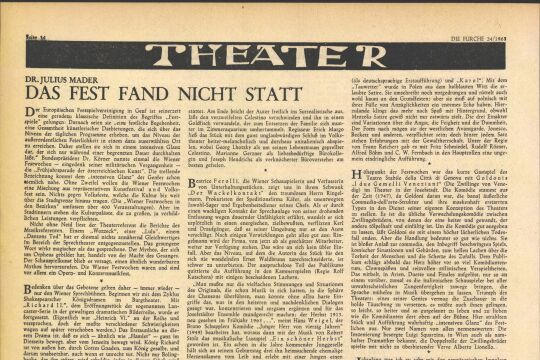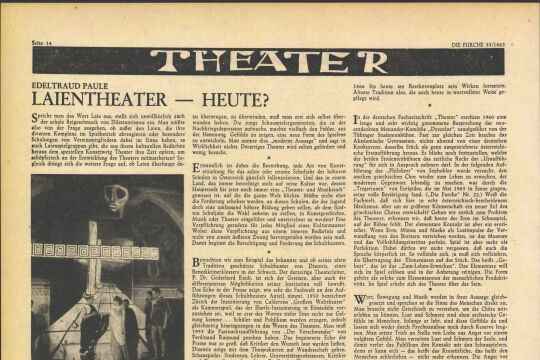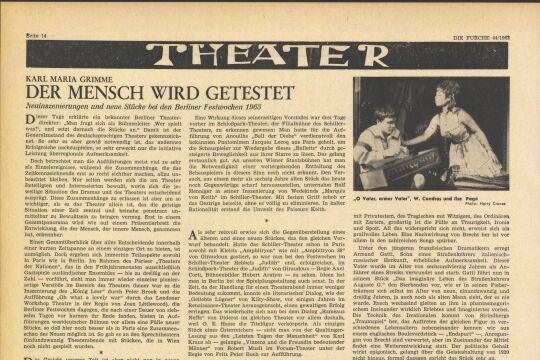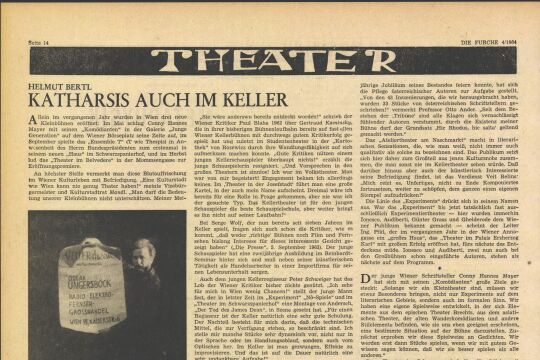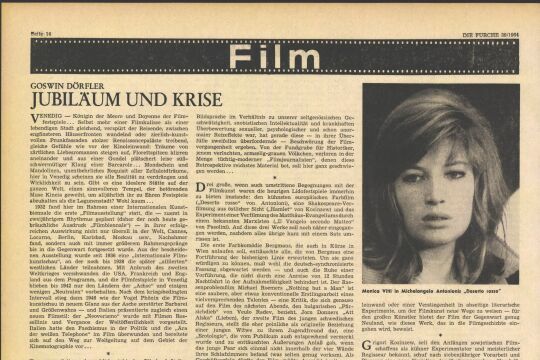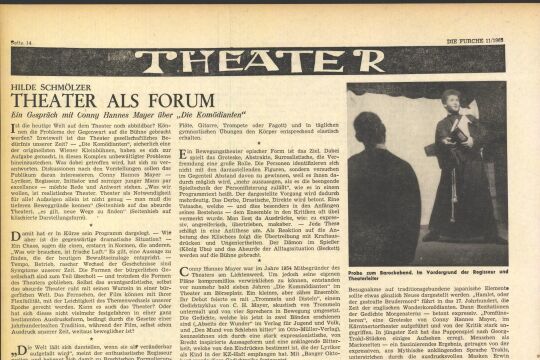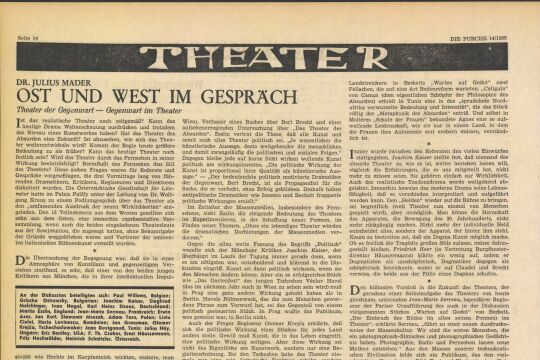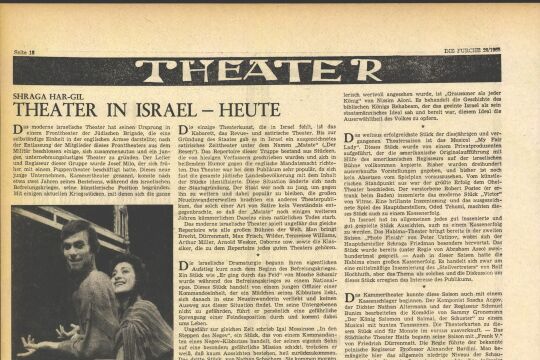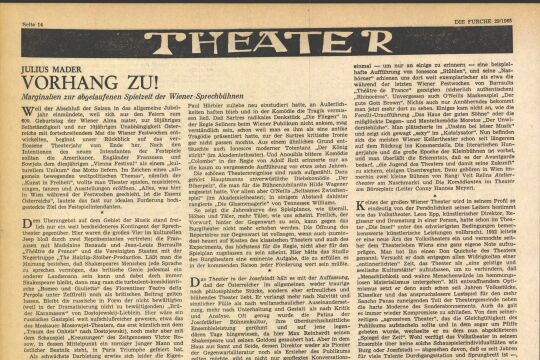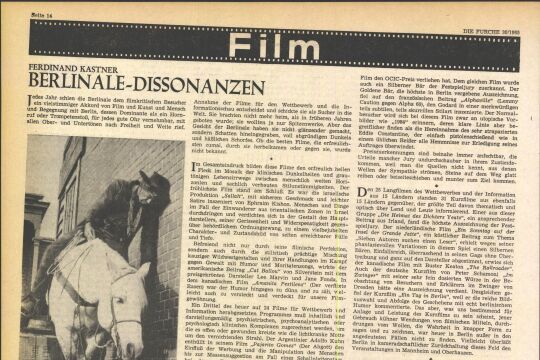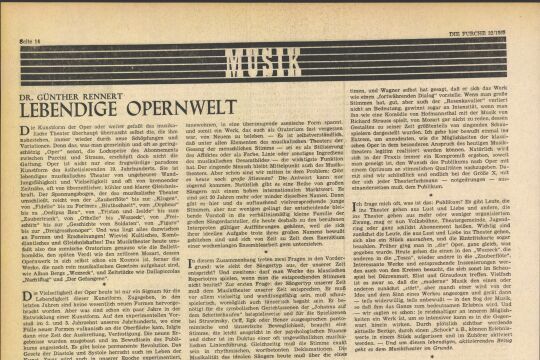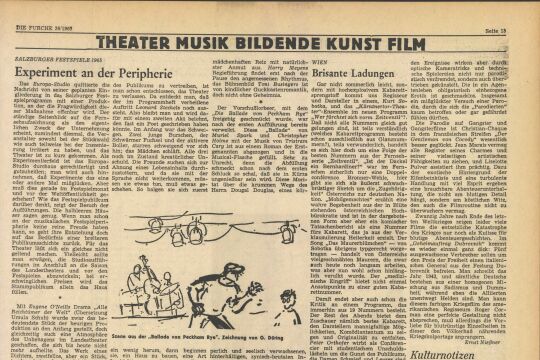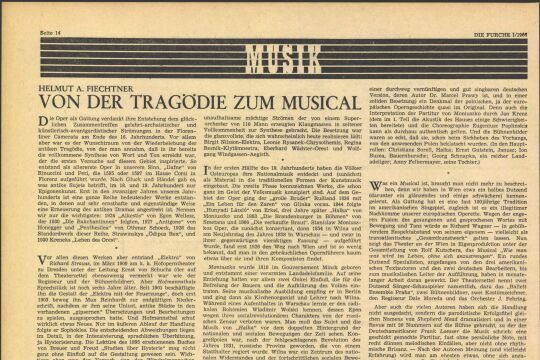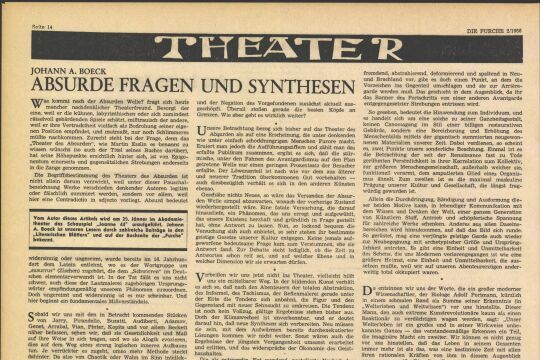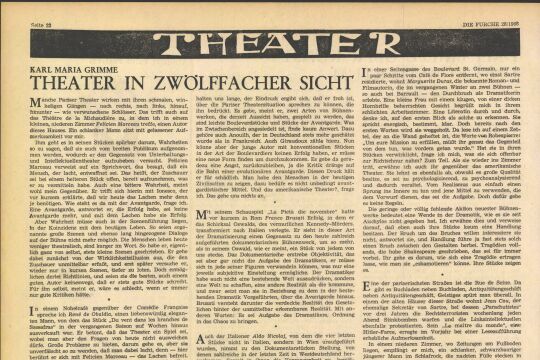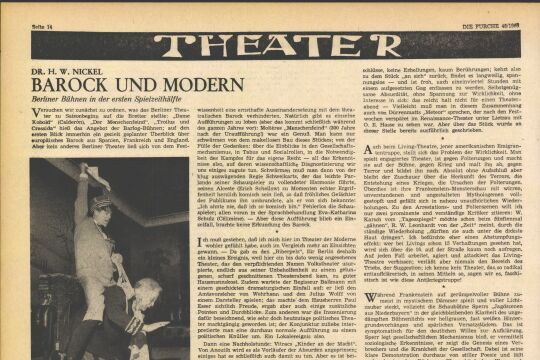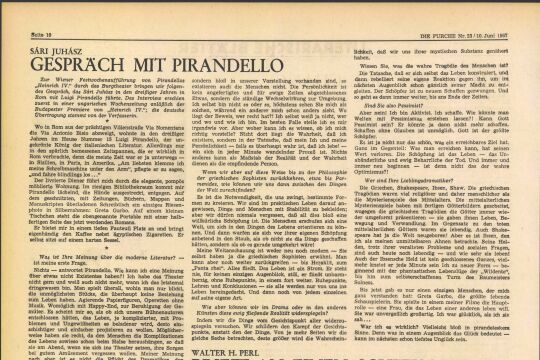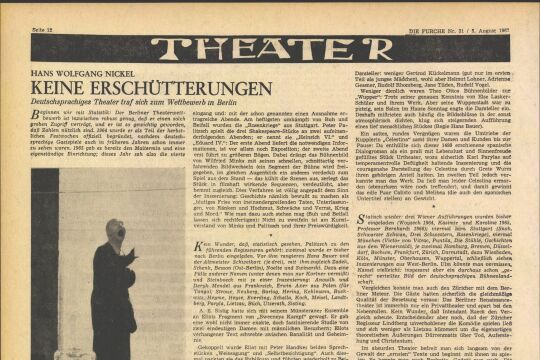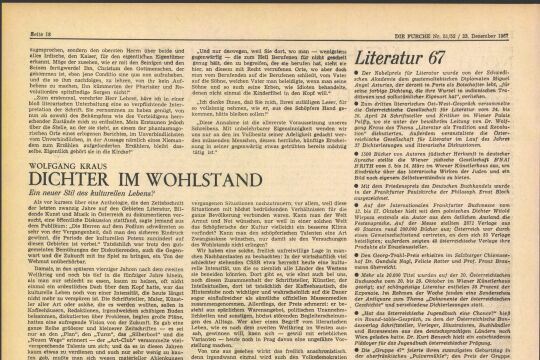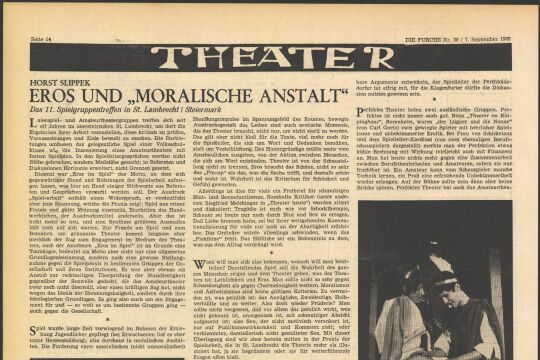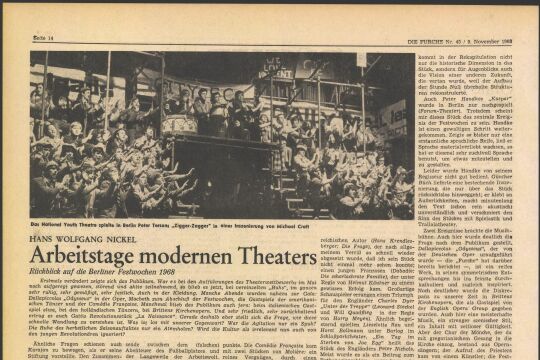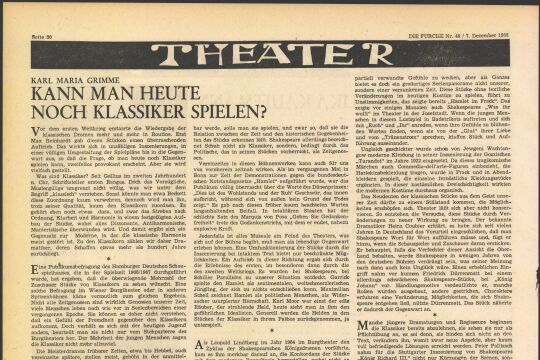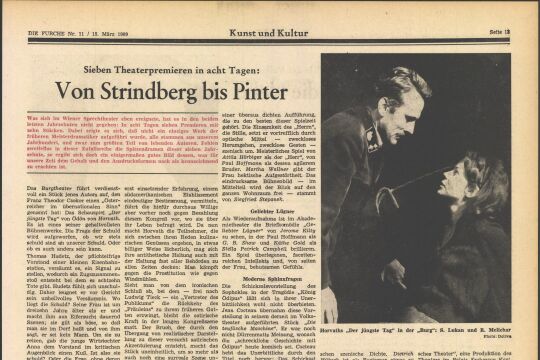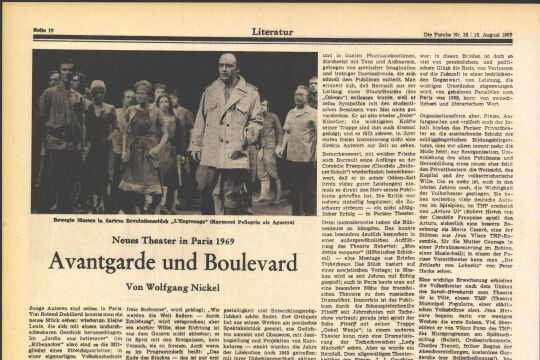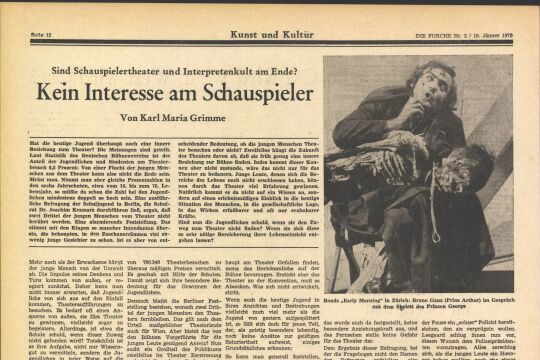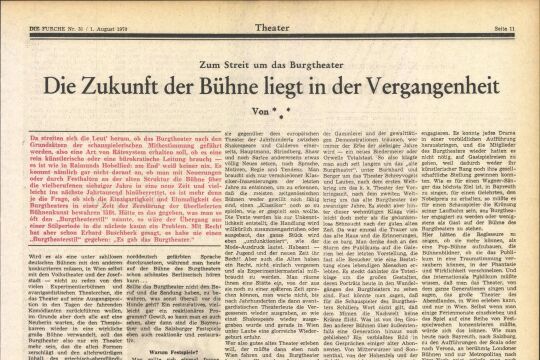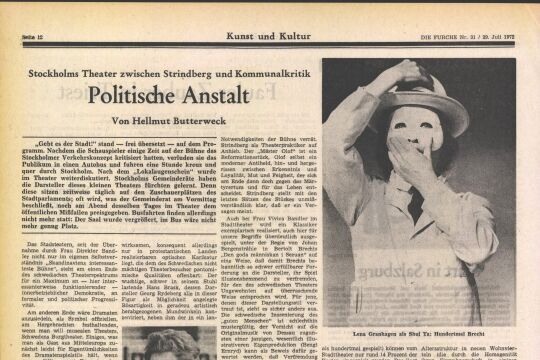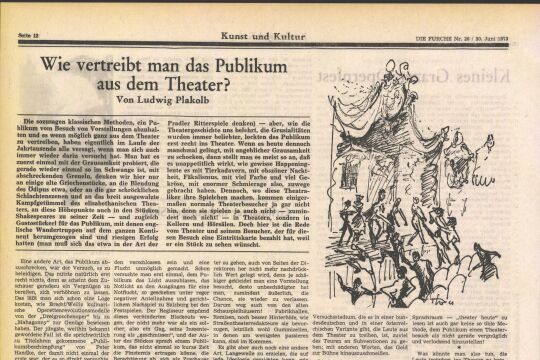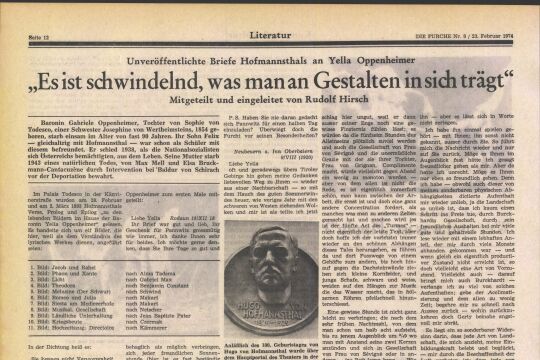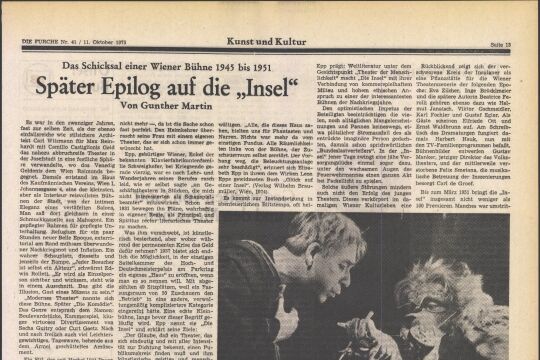Das "Young Directors Project der Salzburger Festspiele: Theater, das unter die Haut geht.
Peeping Tom aus Brüssel, Motus aus Rimini, das sind zwei Gruppen, deren Arbeit mit dem Hinweis auf Theater nur unzulänglich beschrieben ist. Beide agieren auf der Bühne, aber ein Schauspiel, dem man sich hingeben könnte, ein Konflikt, der in allen Verästelungen zur Anschauung freigegeben ist, sind nicht zu sehen. In beiden Fällen findet Regietheater ohne Theater statt. Wer sich so abwendet von einer Geschichte, die in Handlung übersetzbar ist, hat anderes im Sinn als die konsequente Entwicklung eines Figurenensembles von einem Punkt ihres Befindens an einen anderen.
Hier werden einzelne Momente ausgekostet, jene Momente, in denen sich Spannungszustände verschärfen. Vorgeführt wird das Belegmaterial dafür, dass sich die Hölle im Menschen selbst befindet. Bleibt er allein, spielen sich die Dramen des Herzens und der Seele unerbittlich in seinem Inneren ab. Trifft er auf andere Menschen, kommt er um eine Beziehung nicht umhin und alles wird erst recht kompliziert. Wie setzt man so etwas auf der Bühne um?
Theater der Zukunft
Das Young Directors Project, im Rahmen der Salzburger Festspiele zum sechsten Mal abgehalten, gibt einen kleinen Ausschnitt jungen Theaters, Beispiele von Künstlern, mit denen in Zukunft zu rechnen sein wird. Eine Jury, zu deren Mitgliedern Sunny Melles und Peter Simonischek zählen, wählt aus vier Aufführungen eine. Heuer stehen vier europäische Produktionen zur Diskussion, im nächsten Jahr soll der Blick auf andere Kontinente ausgeweitet werden.
Was bislang zu sehen war, ist jedenfalls Theater, das unter die Haut geht. Alle vier Gruppen haben sich vom Anspruch entfernt, ein Theaterstück als Ausgangslage für ihre Anliegen zu verwenden. Ihre Stücke kommen von anderswo her, entstehen in einem Arbeitsprozess, an dessen Anfang vielleicht eine Idee steht, die erst im Verlauf des Probens konkrete Gestalt annimmt.
Bei der italienischen Gruppe steht immerhin noch Pier Paolo Pasolini Pate. Ihr Stück Wie ein herrenloser Hund nimmt ein Romanfragment zum Anlass, die Reise durch ein wüstes Italien anzutreten. Auf der Bühne steht ein Auto, das Symbol für das Unterwegssein. Eine Erzählerin (Emanuela Villagrossi) befindet sich vor einem Mikrofon und rezitiert einen Text voller Gewalt. Das macht sie nüchtern und klar, als ginge sie das alles nichts an. Es geht sie auch tatsächlich nichts an, denn wir befinden uns in einer Welt, die aus zweiter Hand über uns gekommen ist.
Leben auf Schwundstufe
Eine große Leinwand bildet die Kamerafahrt durch Großstadt und Wüstenlandschaften ab, durch desolate Gegenden und eine Asphaltödnis, wo Leben auf der Schwundstufe stattfindet. Zwei kleinere Leinwände befinden sich rechts und links davon. Auf einer wird eben jenes Drama von Gewalt und einer homosexuellen Leidenschaft erahnbar, das sich im Text ereignet, auf dem anderen tollen Kinder durchs Bild, und still und starr steht ein Auto dabei. Die Zeiten waren schon einmal besser, aber als Sehnsuchtsmotiv taugt ein altes Auto noch immer.
Zwei Schauspieler (Dany Greggio und Enrico Provvedi) verkörpern das Geschehen auf der Bühne noch einmal. Und dann die Musik, die in Wellenbewegungen dramatische Ereignisse ankündigt und verebben lässt. Mehrere Parallel-Wirklichkeiten laufen gleichzeitig ab, und alle haben miteinander zu tun. Eine Wirklichkeit gibt es nicht, aber zahlreiche Versionen von ihnen. Der Zuschauer stiftet den Zusammenhang.
Das ist klug komponiertes Theater, das es auf die Emotionen des Publikums abgesehen hat. Es muss das Theater aufgewühlt verlassen. Pasolini war ja ein strenger politischer Autor, der den Mächtigen seiner Zeit nichts durchgehen ließ. Politisch ist dieses Theater auch. Es setzt lauter Signale einer grassierenden Verödung, die zur Verödung der Menschen führt. Wie sich diese auswirkt, erzählt die Geschichte.
Die Gruppe Peeping Tom verlagert das Innenleben nach außen, setzt es unmittelbar in Bewegung um. Akrobatische Hochleistungen sind zu bewundern. Wenn es im Vorfeld der Veranstaltung großsprecherisch heißt, dass es den schönsten Kuss der Theatergeschichte zu sehen gibt, glaubt man das am Ende sogar. Zwei finden sich, und was sich an Energie und Leidenschaft in ihnen aufgestaut hat, setzt sich in einem Kuss fort, der den ganzen Theaterraum und zahlreiche körperliche Hochleistungsübungen erfordert.
Schönster Theater-Kuss
Ein Familiendrama wird gegeben, das kann nicht ohne Reibereien abgehen. Die Geschichte ist einfach, so einfach, dass es auf sie gar nicht so sehr ankommt. In einem Wohnzimmer leben mehrere Generationen einer Familie zusammen, das ist der Stoff, der die Konfrontation schürt. Das eigentliche Abenteuer des Kleinbürgers liegt in der Verletzung der Seelen seiner Nächsten. Wenn das Wohnzimmer ruiniert wird, ist das nur das äußere Zeichen dafür, dass Menschen wie die Wölfe übereinander hergefallen sind.
Gabriela Carrizo, Frank Chartier, Samuel Lefeuvre und Simon Versnel leisten zusammen mit der Mezzosopranistin Eurudike de Beul ganze Arbeit, um eine aus dem Lot geratene Welt zu zeigen. Ein starkes Stück Theater!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!