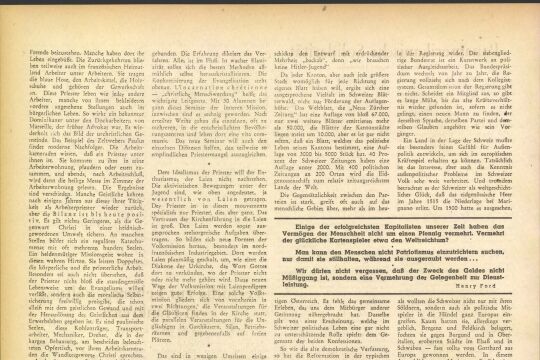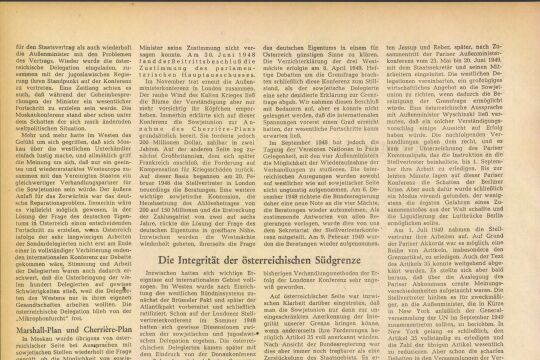Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Schweizer und der „große Kanton”
Letzten Sommer war es, auf der Rückfahrt von Spanien. Eine einsame Nachtreise schien bevorzustehen, als in Toulouse ein zweiter Reisender zustieg, an Kleidung und Gepäck unschwer als gutsituierter Deutscher zu erkennen. Wählend bald das Gespräch zwischen Franco, de Gaulle und Adenauer hin und her pendelte, wies es sich, daß der Mann nicht allein wohlinformiert und klarsichtig, sondern auch freier im Urteil und weitläufiger war, als es Leute seines Schlages gemeinhin zu sein pflegen. Um so mehr interessierte uns, was er über schweizerische Verhältnisse zu bemerken wußte, vor allem, daß er bekannte, er sei ernstlich beunruhigt über die Art, in der man ihm in der Schweiz entgegentrete: nicht, daß er im mindesten unfreundlich behandelt würde, doch glaube er, eine merklich größere Zurückhaltung zu spüren als noch vor wenigen Jahren, und dies nicht nur ihm, sondern allgemein den Deutschen gegenüber.
Erstaunlich bloß, daß er sich über die Veränderung Rechenschaft gegeben hatte. Normalerweise bewegen sich die reisenden Deutschen in der Schweiz im tröstlichen Bewußtsein, einem Staate anzugehören, der in den eidgenössischen Statistiken als Handelspartner Nummer Eins erscheint, und sie wissen, daß ihresgleichen die schweizerische Fremdenindustrie am meisten verdienen läßt. Sie erblicken Volkswagen und Mercedes rudelweise, jeden Zeitungsstand mit deutschen Blättern überhängt, finden die gleichen Filme wie zu Hause, sehen sich freundlich bedient — was Wunder, wenn sie dafürhalten, es stehe im Verhalten der Schweizer ihrem nördlichen Nachbarn gegenüber wenn nicht zum besten, so doch auf dem Weg dazu. In Wirklichkeit liegen die Dinge etwas anders und vielschichtig.
Nichts von dem, was in Deutschland und Frankreich vor sich geht,' kann die Schweizer gleichgültig lassen. Wenn aber das Interesse für französische Belange in einer vielhundertjährigen Tradition liegt und die Züge des Engnach- barlichen trägt, so ist in den Beziehungen zu Deutschland die familiäre Note unverkennbar. Das liegt in der sprachlichen Verwandtschaft begründet, und es ist denn auch die Deutschschweiz, die hier den Ton angibt. Insofern berührt unser Thema die schweizerische Innenpolitik, als der Verdacht nicht von der Hand zu weisen ist, es verhalte sich die Zufriedenheit der Welschschweizer umgekehrt proportional zum Umfang (nicht zur Qualität) der Germano- philie im deutschsprachigen Teil. So schwierig sich das im einzelnen beweisen ließe, so einfach gelingt die Erklärung, indem es hier nicht viel anders steht als bei einer Frau, die instinktiv gegen alles Abneigung zeigt, was das Interesse ihres Mannes von ihr abzuziehen droht.
Es gab Zeiten, da man in der Schweiz deutschfreundlich war, und zwar in einem heute unvorstellbaren Maß. In Professorenfamilien hielt die deutsche Sprache Einzug, im guten Bürgertum deutsche Sitten, überall sonst wenigstens die „Gartenlaube“, und es kulminierten
Bewunderung und Begeisterung, als 1912 Kaiser Wilhelm II. gar die Manöver der schweizerischen Armee zu besuchen geruhte. Zu Beginn des ersten Weltkrieges wünschte man in der Deutschweiz unverhohlen den Sieg der Mittelmächte. Erst im Verlauf des Krieges änderte sich das, als die Einsicht überhandnahm, es gehe im Verhältnis zum Deutschen Reich auf lange Sicht um nicht mehr und nicht weniger als um die Wahrung der schweizerischen Unabhängigkeit.
Die Entwicklung bis 1945 war in ihrem positiven Aspekt dadurch gekennzeichnet, daß die Schweizer sich stärker auf ihre Eigenart besannen und die geistige Selbständigkeit als Grundgut der politischen betonten: „geistige Landesverteidigung" wurde geradezu ein Schlagwort, das im übrigen an Wirksamkeit nicht viel eingebüßt hat, und die Apostrophierungen des Nachbars im Norden, wie etwa „draußen“ oder „im Reich“ oder gar „im großen Kanton“» charakterisieren zur Genüge im Wortlaut die Abwehr, im Tonfall die Ironie. Den negativen Aspekt bildete die stets wachsende Germano- phobie, wobei die wechselseitigen Anirhositäten in den Kernworten vom „Kuhschweizer" und vom „Sauschwaben" ihren nicht so sehr feinen als vielmehr ehrlichen Ausdruck fanden.
Das Thema von der deutschen Kollektivschuld wurde in der Schweiz nach 1945 verschiedentlich abgewandelt, ohne indessen lange nachzuklingen, weil die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus die Geister stärker in Anspruch nahm. Bald war das Mitleid mit den Deutschen stärker als das Mißtrauen, und solange die Westmächte in Westdeutschland mehr zu sagen hatten als die Deutschen selber, bestand kein Anlaß, mit Sorgenfalten nach Norden zu blicken. Außerdem verfolgte man mit wohlwollender Teilnahme den Weg des Nachbars -zu einer neuen Staatsform, weil ja der Normalschweizer sich in Sachen Demokratie als sachverständig und sogar als Hüter berufen fühlt. Anzufügen ist hier, daß heutzutage die Eidgenossen unter Deutschland allein die Bundesrepublik verstehen; sie nehmen partem pro toto und halten — vorsichtig ausgedrückt — die Trennung für eines der geringeren Mißgeschicke. Mehr als akademisches Interesse am Dasein der DDR oder an der Oder-Neiße-Grenze findet sich kaum.
Es ist das „Wirtschaftswunder“, das für viele Schweizer die Gemeinplätze von deutscher Tüchtigkeit und Gründlichkeit wieder einmal mit einem positiven Vorzeichen versah, besonders weil man sich im Volk gleichzeitig daran gewöhnte, die politische Mißwirtschaft in Frankreich unbedenklich auch für andere Bereiche gültig anzusehen. „Für viele Schweizer" sagten wir. — Diese vielen gibt es aber nicht in gleichmäßig dichter Streuung durch das ganze Volk, sondern zunächst in den größeren Ortschaften besonders in der großen Menge jener, die infolge der starken Wanderbewegung an ihrem derzeitigen Wohnort noch nicht lange ansässig sind, und endlich allgemein in den minder gebildeten Schichten der Deutschschweiz. Es sind eben die Leute, die nicht oder schlecht Französisch gelernt haben, jene eben, die Mühe haben, sich in der Lokalpolitik zurechtzufinden und darum im Bereich des Verantwortungslosen einen Ersatz suchen und auch gleich bei der Hand haben, in der Form der deutschen Wochenpresse nämlich. Diese Leute sind es, in der Mehrzahl, die sich deutsche (und österreichische) Filme anschauen, deutsche Schlager hören wollen und mit Ausdauer reproduzieren, deutsche Radioprogramme den schweizerischen vorziehen und ihre Fernsehantennen auf den Empfang deutscher Stationen richten.
Leicht zu ersehen, daß diese Bindung an Deutschland nicht viel Vornehmes und wenig Politsches an sich hat; doch sollte man darob nicht vergessen, daß es sich um eine Massenbewegung handelt, die wie alle ihresgleichen imstande ist, Eigengesetzlichkeit und Anziehungskraft über ihren ersten Bereich hinaus zu entwickeln. Zudem gibt es in der Deutschschweizer Presse einige Blätter, die den Berichten aus Deutschland die Priorität einräumen oder sich offen germanophil betätigen, teils als Konzession an das oben beschriebene Publikum, teils eingedenk des ansehnlichen schweizerischen Kapitals, das in der deutschen Wirtschaft Wunder wirken hilft. Um Konzessionen an das selbe Publikum handelt es sich ganz offensichtlich auch, wenn die Programmleitungen des Radios deutschen Elementen von Jahr zu Jahr mehr Zeit gewährt. Das ist nicht etwa als kulturpolitische Absicht zu werten: man möchte bloß jeden zum Seinen kommen lassen und im übrigen um alles in der Welt nicht als chauvinistisch verschrieen werden.
Sobald diese Entwicklung größeren Umfang angenommen hatte, mußte es in den Teilen der Bevölkerung, denen sie fremd, aber nicht gleichgültig blieb, zu Reaktionen kommen. Dies äußerte sich, wie es jener Kaufmann richtig bemerkt hatte, nicht in unfreundlicher oder gar feindschaftlicher Haltung gegen deutsche Menschen und deutsche Art, sondern in einer genauer gewahrten Distanz. Und weil sich alles, was zur Vermassung beihilft, mit der schweizerischen Form der Demokratie nicht wohl verträgt, ist es auch begreiflich, wenn man vielerorts ganz aufmerksam prüft, ob und in welchem Grade das in den Massenartikeln von Norden her importierte Gedankengut Krankheitskeime einschleppen könnte. Die das tun, sind bestimmt nicht die schlechtesten Schweizer, sondern es handelt sich um die Bürger mit gut entwickeltem politischem Bewußtsein. Verständlich auch, wenn an den Puls des deutschen Lebens selber die Hand gelegt wird, gelte es die Politik oder den bürgerlichen Alltag. Besonders ist hier die Presse zu nennen, wo die Mehrheit der Blätter nicht nur mit peinlicher Genauigkeit alles registriert, was auch nur im mindesten an Gepflogenheiten im Dritten Reich erinnert, sondern auch rasch damit bei der Hand ist, solche Dinge deutlich ins Relief zu setzen,
allenfalls mit Titeln wie' „Nichts gelernt und nichts vergessen“ oder, wieder einmal Schiller zitierend, „Die braune Liesel kenn ich am Geläut“.
Immer wieder erweisen sich die Bonner Korrespondenten der großen schweizerischen Tageszeitungen als bemerkenswert gut informiert, so gut, daß auch ein naiveres Gemüt mit der Zeit darauf verfallen könnte, deutsche Kreise legten Wert darauf, diese oder jene Angelegenheit in der Schweiz ausführlich behandelt zu sehen, entweder um daraus dann direkt ein Politikum zu machen — Schweizer Zeitungen wurden schon in mehr als einer Bundestagsdebatte genannt — oder um deutsche Leserkreise solcher Zeitungen zu beeinflussen, soweit er es erkennt, je nach Schattierung mit Gleichmut oder Schadenfreude.
So wie die Dinge heute stehen, hängt der Grad eidgenössischer Sympathie zu Deutschland in erster Linie davon ab, wie sehr dort demokratischer Geist eine demokratische Lebenshaltung zu fördern vermag. Gerade in diesem Punkt bestehen ernste Besorgnisse, nicht erst angesichts der Wechsel im Präsidenten- und Kanzleramt, sondern seit man sich fragen mußte, was für Verhältnisse sich nach Dr. Adenauers Weggang ergeben würden. Ihn hatte man allgemein als Garanten eines guten Weges angesehen, während Pessimisten gar vom Felsen in der Brandung zu sprechen liebten. Von allfälligen Ergebnissen der Genfer Konferenz oder einer späteren Gipfelkonferenz hält man hierzulande von vornherein recht wenig, soweit sie Deutschland betreffen; sie kommen für das nachbarliche Verhältnis nicht in Betracht. Was für die Schweizer ins Gewicht fällt, ist das, was die Deutschen selber aus ihrem Lande machen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!