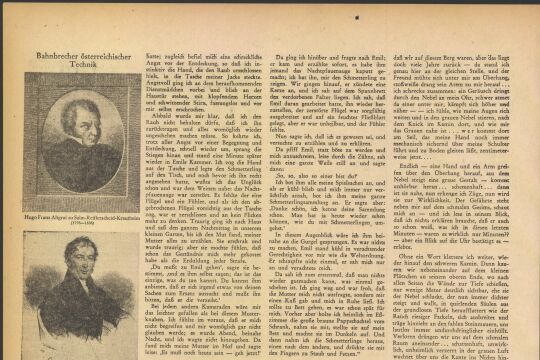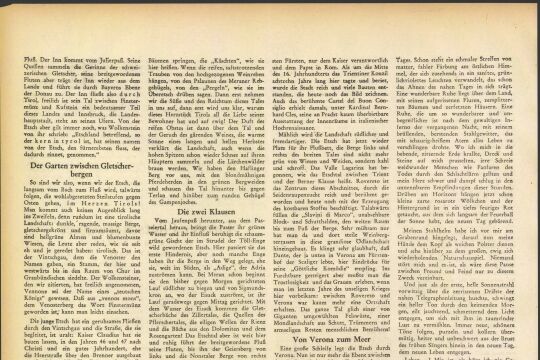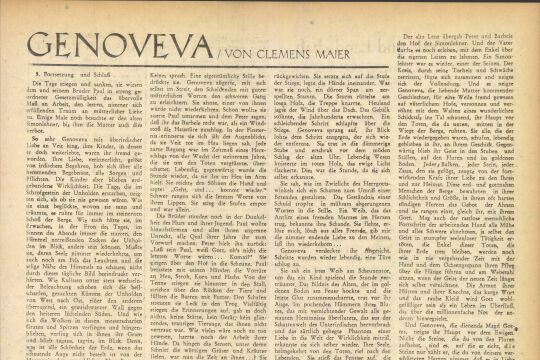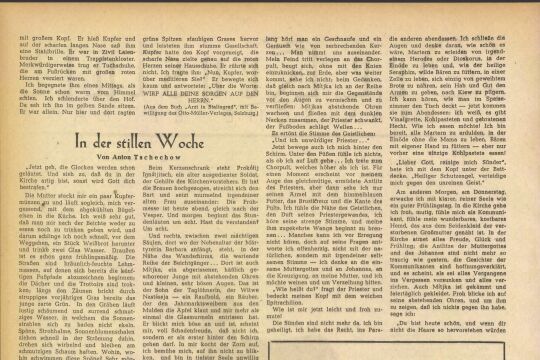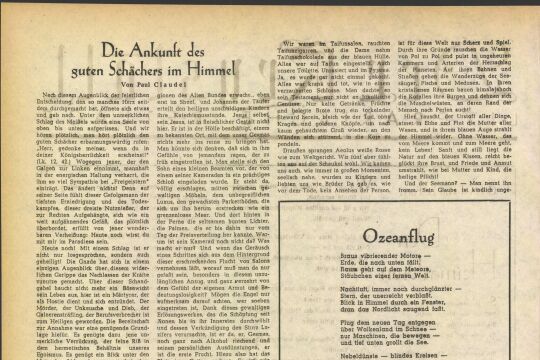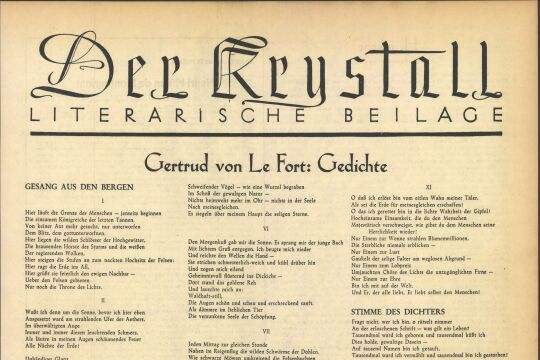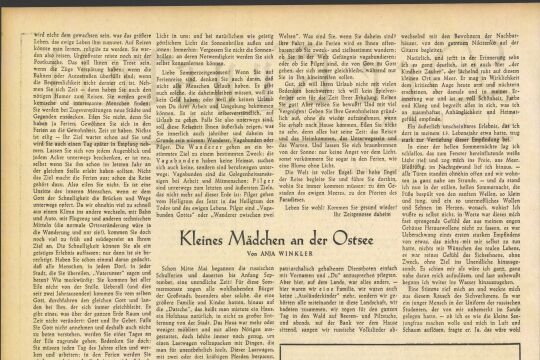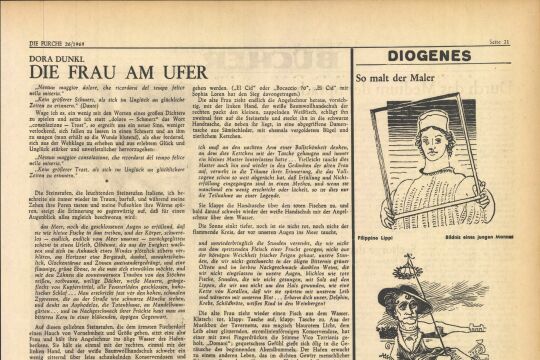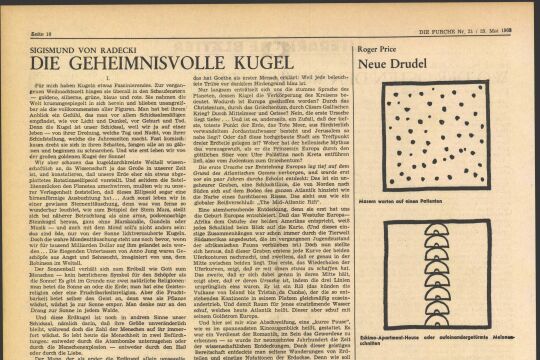Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
VON MEDUSEN UND STERNEN
Täglich verwandelt die Sonne unser Haus in einen Backofen, der dann nachts seine Hitze verströmt. Deshalb habe ich nach unserer Rückkehr vom Meer, wo wir bei Mondschein badeten, mein Bett auf die Terrasse gestellt. Da liege ich jetzt auf dem Rücken und blicke in die Sterne. Sternschnuppen ziehen, manchmal rasend schnell, manchmal zögernd, ihre leuchtende Bahn quer durch die Milchstraße. Schauend schließe ich mich ganz von der Erde ab und schwebe im All, die ungeheure Ferne unter mir. Ich lege alle Kraft in diese Vorstellung, nicht hinauf, sondern hinunter zu blicken, und bekomme plötzlich Angst hinauszustürzen.
Meine Verständnislosigkeit vor dem gestirnten Himmel ist wieder gewachsen, scheint es, seit ich zuletzt hinaufschaute. Dieser Anblick der Milchstraße, die aussieht wie frisch geschottert, sagt mir deutlicher als alles, daß ich nichts weiß. Auf ihr reisen die Verstorbenen in die Ewigkeit. Gedanken an Vergänglichkeit sind unnatürlich. Durchdrungen von un-
wandelbarem Sein, sind wir über jede Verwandlung, auch über die des Todes, im Grunde beruhigt. Die letzten Dinge freilich sind unsere ersten. Aber die Menschheit, die vor dieser Festung seit je mit sich selbst nur um die Meinung kämpft, wie sie zu erobern sei, hat bis heute noch kein Tor gefunden, das zu berennen wäre. Und die Bewegungen der Kämpfenden sind einziger Beweis dafür, daß es die Festung gibt.
Und wieder eine Sternschnuppe. Während sie fällt, fühle ich, daß es nicht zufällig geschieht, daß sie für mich verglüht.
So gilt also auch für Sternschnuppen, was Goethe vom
Kunstwerk sagt, daß man nur in ihrer Gegenwart, solange sie fallen, etwas Gültiges über sie sagen kann. Wie hätte ich mir auch diese Wirkung der Sternschnuppe ausdenken können, die ich mir erschaute? Durch ihren Schein ermutigt, wagte ich den Sprung aus der Ecke, in die der Mensch, beleidigt oder bescheiden, sich selbst gestellt, wieder zurück in die Weltmitte, wo ich auch wieder glauben kann, alles sei für mich geschaffen, der ich es denke. So korrigieren sich Ideen immer wieder an der Wirklichkeit, so wird aus Unvernunft wieder Vernunft, wird aus entleerten Gedanken wieder höchste Weisheit.
- Vollgerüstet steigt die Sonne aus den Bergen auf der Insel Ägina steil in den Himmel. Es ist noch vor sechs, aber schon brennt sie heiß auf meine Wolldecke her. Ich gebe den Kampf auf, ehe er begonnen, und gehe wieder ins Meer baden. Auf dem Weg über die Felsen schaue ich auf die eisgraue Wasserfläche hinunter, auf der eine breite Goldstraße hin-
über zur Insel führt. Wie auf Münchs Gemälde, hat sie die Form eines „i“. Nachts, als wir hier badeten, war es das gleiche Bild, doch als I-Punkt stand der Mond an der Stelle der Sonne. Der „Italiener“, der in Wirklichkeit nur ein italienisch sprechender Grieche ist, tauchte, während er uns von seiner Heimat, der Insel Zante, erzählte, von Zeit zu Zeit seinen Körper in das flüssige Gold, das dann, wenn er sich wieder daraus erhob, an ihm schillerte und schimmerte. Es war, als wollte er damit seine „Che-bella-che-bella'“-Rufe illustrieren.
Trotz der frühen Stunde sind schon wieder Badende da. Der Italiener fischt mit einem Stück Holz Medusen aus dem
Wasser. „Damenhüte“ nennt er sie scherzhaft und wirft sie auf die Felsen, wo sie samt den winzigen Fischchen in ihrem Gekröse langsam sterben. Nach einer Stunde noch pulst, von Wespen umschwärmt, die Gallerte. Einer der beiden Taucher, die täglich stundenlang auf dem Wasser liegen und in die Tiefe starren, hat einen Pulp harpuniert, und nun kommen sie ans Ufer, die Beute zu sichern. Auf gespreizten Beinen stehend, fassen sie in den aufgespießten Knäuel der Polypenarme, die sich augenblicklich wie rasend um Hände und Unterarme schlingen. Erbarmungslos zerren sie an dem Tier und reißen es von der Harpune. Ich muß die Augen schließen und setze mich auf den Felsen hin. Da ist der Kampf auch schon zu Ende. Mit klatschendem Geräusch wird die tote Krake jetzt auf dem Stein weich geschlagen. Indessen kämpft hinter meinen geschlossenen Lidem das Tier noch einmal seinen Todeskampf, wird ihm noch einmal sein Herz aus dem Leib gerissen — es war in Wirklichkeit „nur“ der Magen — und entschwindet noch einmal seine Riesenkraft wie durch Zauberei aus dem plötzlich willenlos gewordenen Körper. Der hegt da vor mir und sieht mit seinen auf acht dünnen Schläuchen gereihten, wie abgezirkelten Saugnäpfen wie ein technisches Erzeugnis aus.
Was hat darin soeben gekämpft, ehe dieses Stück eßbares Fleisch daraus wurde? Was ist die Natur? Ein Anonymes, das aus dem Hintergrund Befehl gibt, zu kämpfen, um nach verlorenem Kampf sich der Verantwortung zu entziehen, unbekümmert um den Verlust, der es nicht berührt? Aber sah ich nicht die ganze Natur mit dem Tier kämpfen, und untere lag nicht vor meinen Augen die ganze Natur mit ihm? Warum begreife ich nun wieder nichts, da mdr's doch schien, als habe soeben „geheimnisvoll am lichten Tage“ Natur den Schleier vor mir gelüftet?
Da ich ins Wasser springe, streife ich an etwas mit dem Fuß. Fröstelnd erinnere ich mich der Medusen, deren violette Fäden bei Berührung die Haut röten. Da ist so ein gelbbrauner atmender Teller. Auf der Unterseite scheint ein Schlangennest sich zu verbergen. Das Tier stößt rhythmisch Wasser aus der Glocke und bewegt sich so nach dem Rückstoßprinzip fort. Es ist, als habe sich in dem statisch-skalaren Körper des geheimnisvollen Lebewesens das richtungslos-ruhende Meer gleichsam in einem Punkt verdichtet, in dem es, wie in dem Worte „Meer“, verwandelt wieder erscheint. So verwandelt sich der dynamische Fluß in die Vektorgestalt des Fisches. Das leicht in der Flut schwebende Tier macht mir mein Geöffnetsein in die mich umgebende Welt bewußt, meine Fleischhaftigkeit, die ich plötzlich fühle, mein Dasein in meinen Organen, in Leber, Niere, Lunge, Herz, die ich nicht besitze, die ich bin. Da weiß ich auch, daß nichts Festes in mir ist und daß ein Fremdes, Ungewöhnliches, Unbekanntes in mir arbeitet, daß ich gottdurchdrungen bin.
Im dunklen Schiffsfenster der im Hafen vor Anker liegenden „Tschunke“ leuchtet ein glitzernder Wirbel auf. Dann wieder dunkel. Und wieder der glitzernde Wirbel. Und so fort. Eine Brise kommt auf. Das Meer bekommt Schuppen und schillert wie ein Fisch. Das Segelschiff, weit draußen, will sich wie ein Falter in die Luft erheben. Am Horizont besäumt ein weißes Schiff mit schneeweißer Gischt den blauen Matrosenkragen des Meeres. Weshalb sieht hier alles nur nach Matisse und Dufy, nicht nach Böcklin aus, dessen Meer mir einst so meerhaft erschienen ist? Man darf das Meer nicht erfinden, darf es nicht auswendig malen, man muß es erschauen, immer von neuem, jetzt, heute, zu dieser Stunde.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!