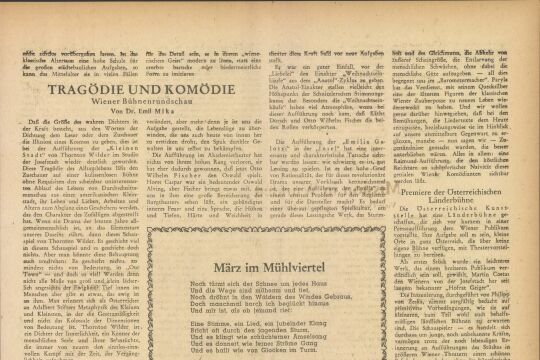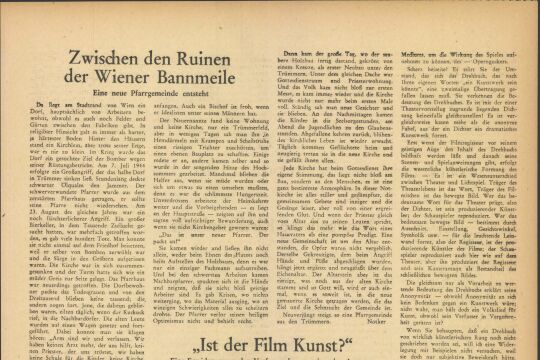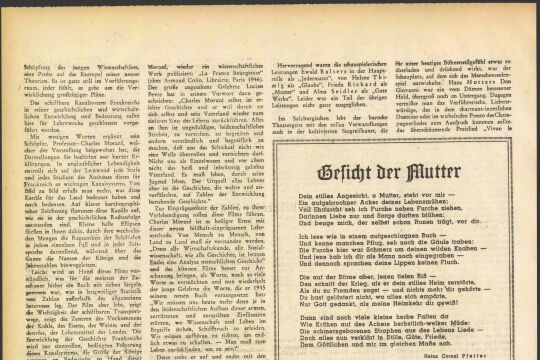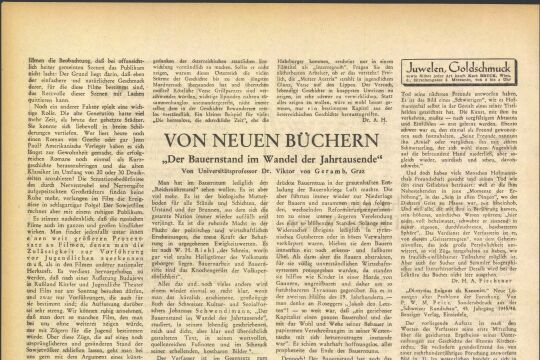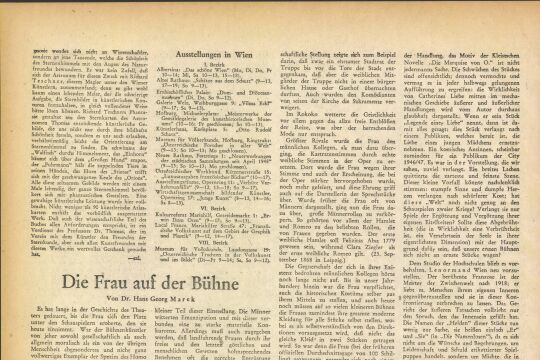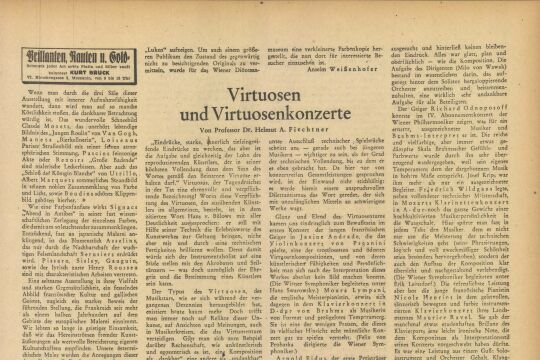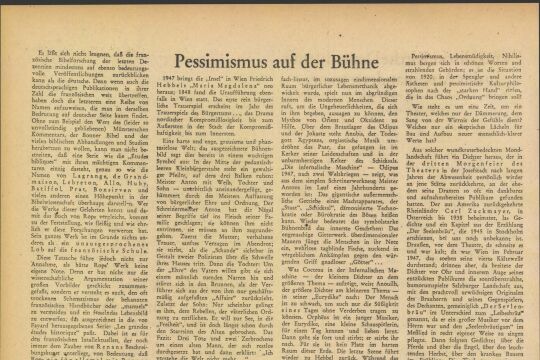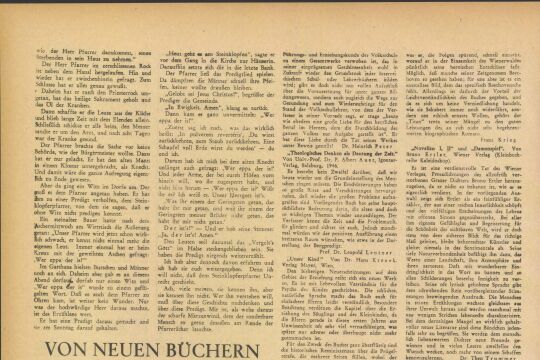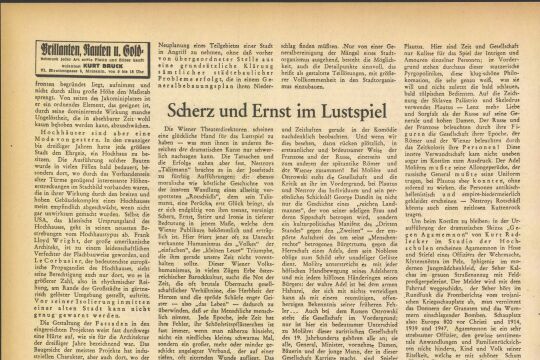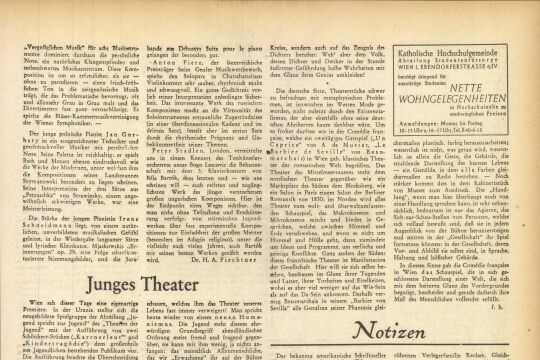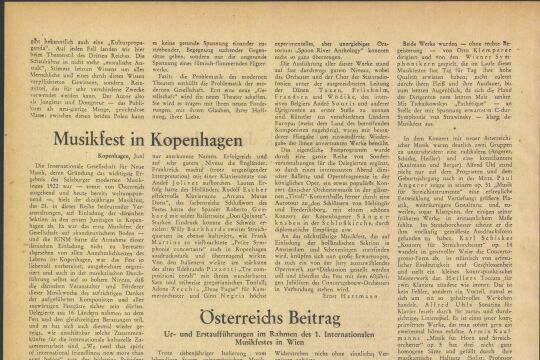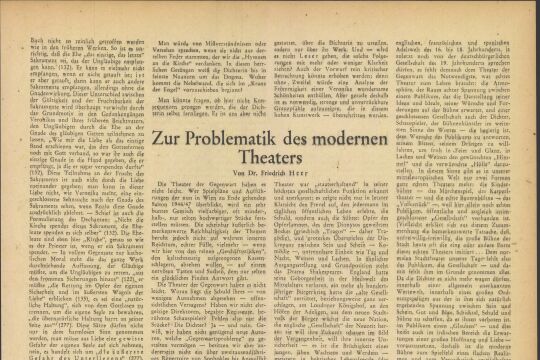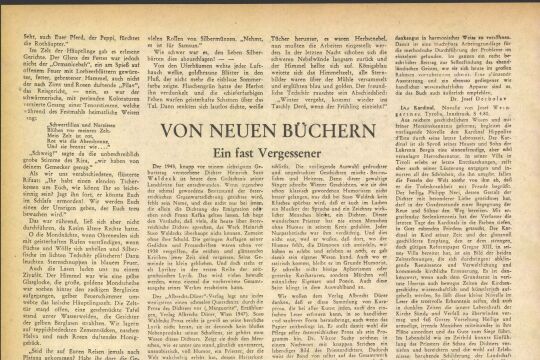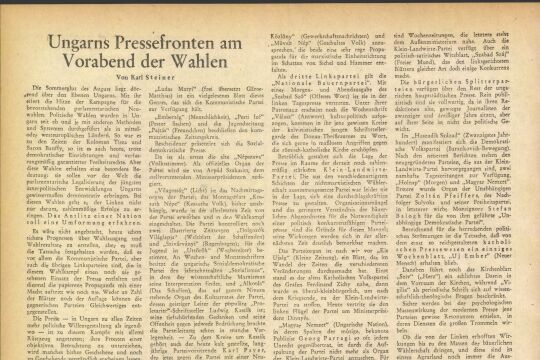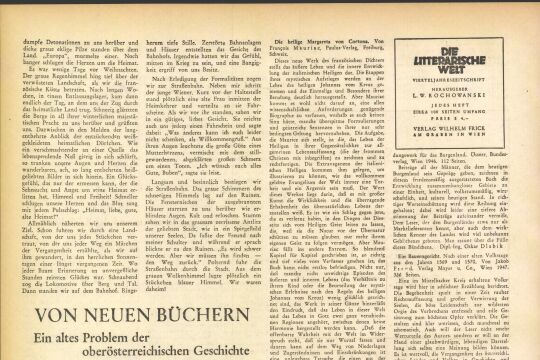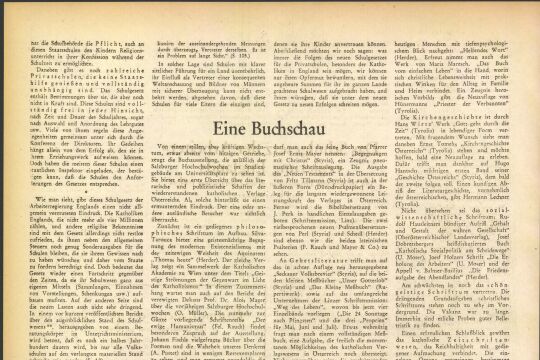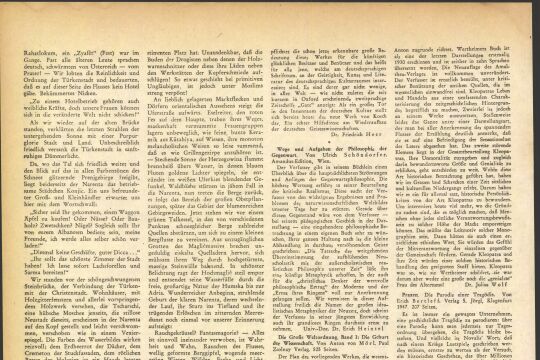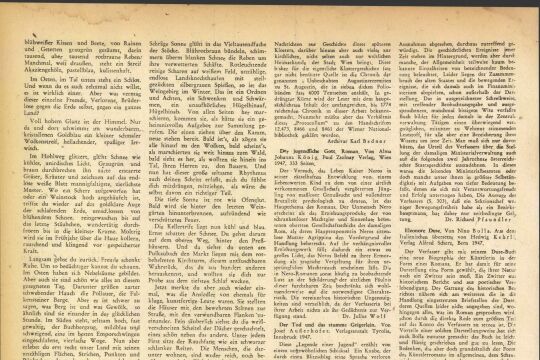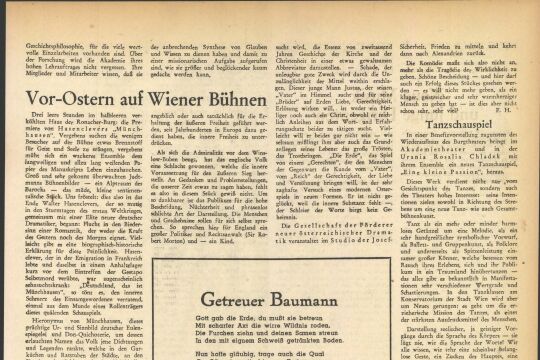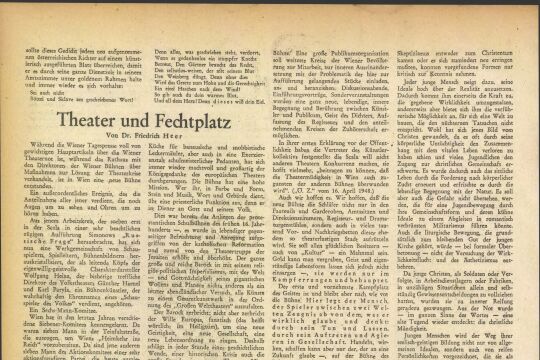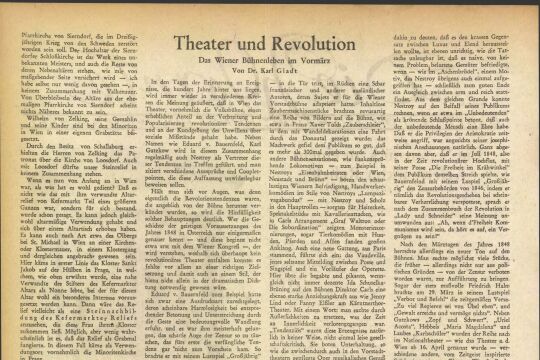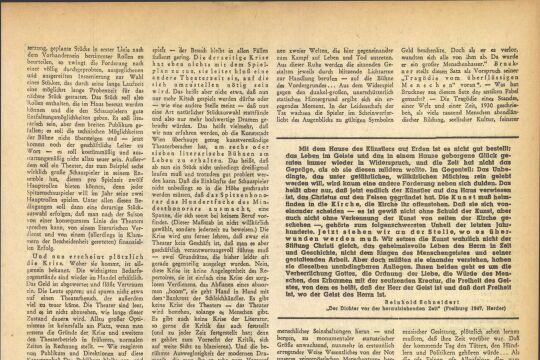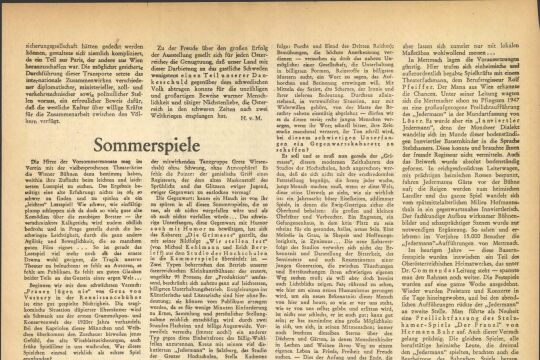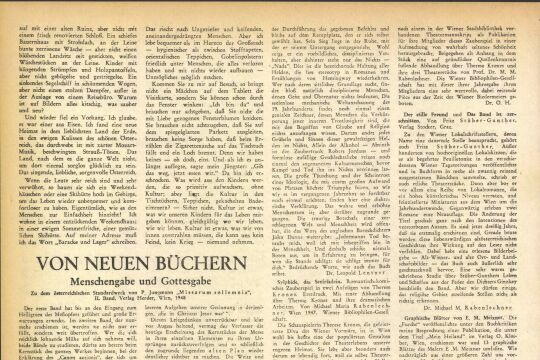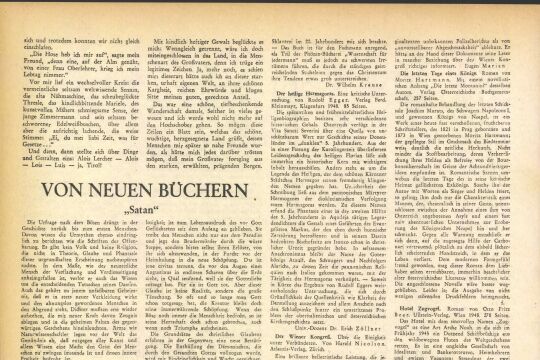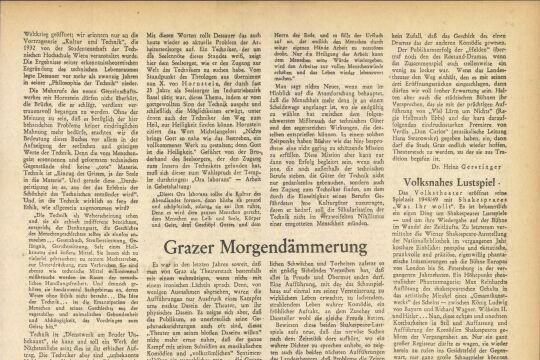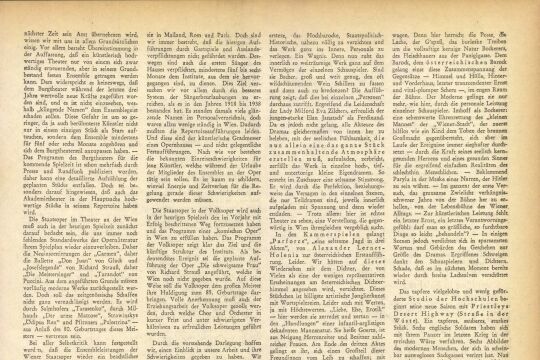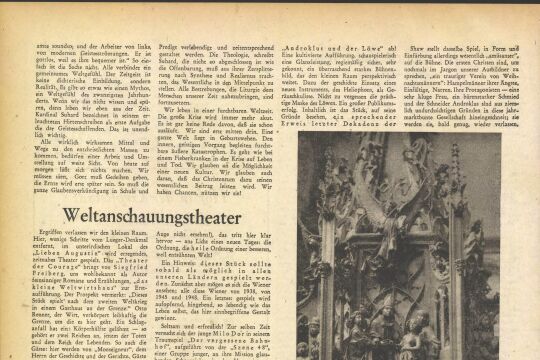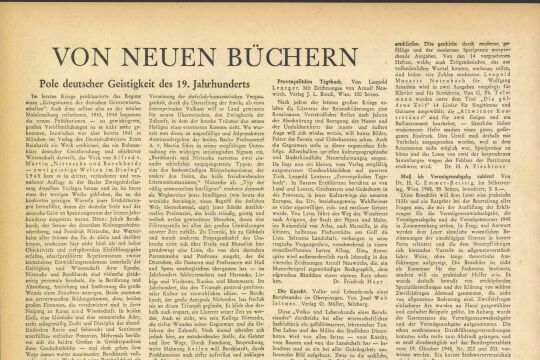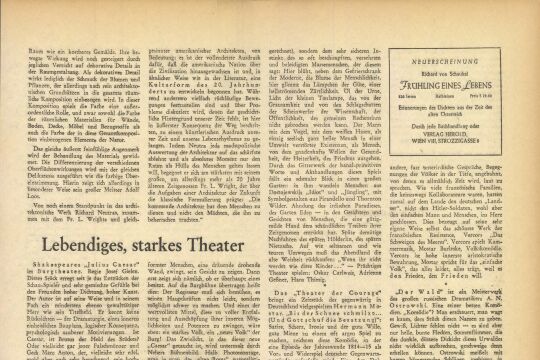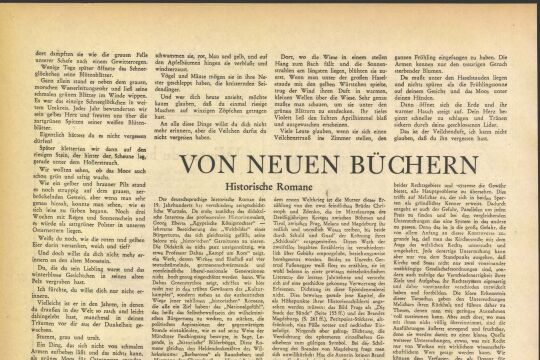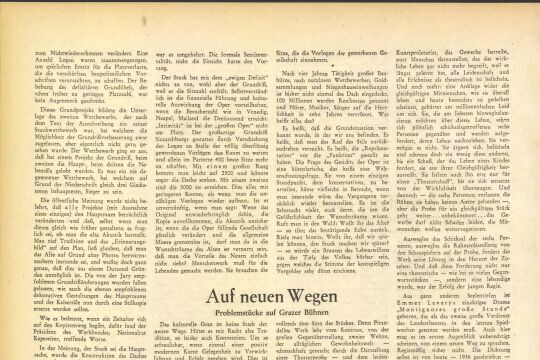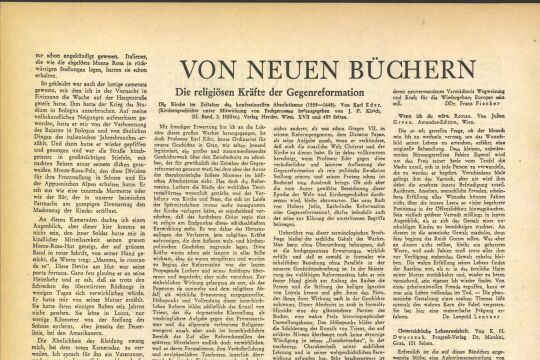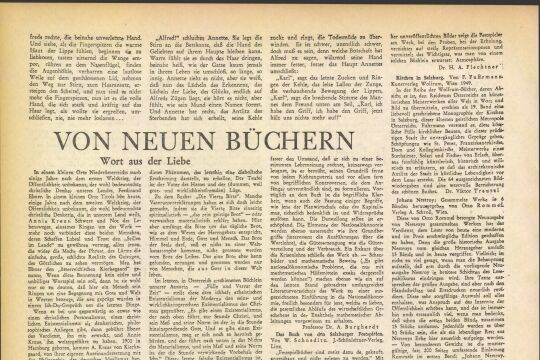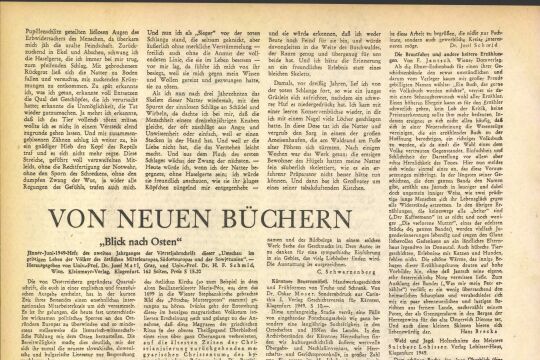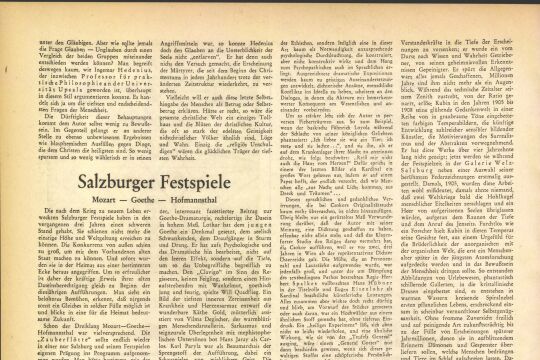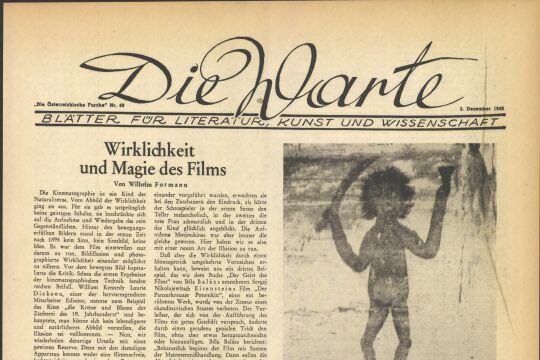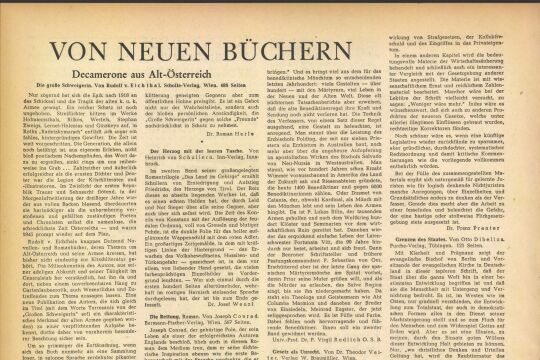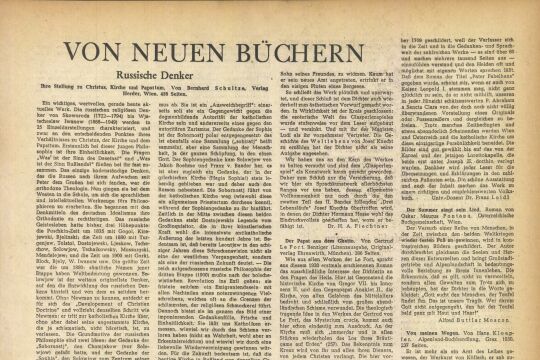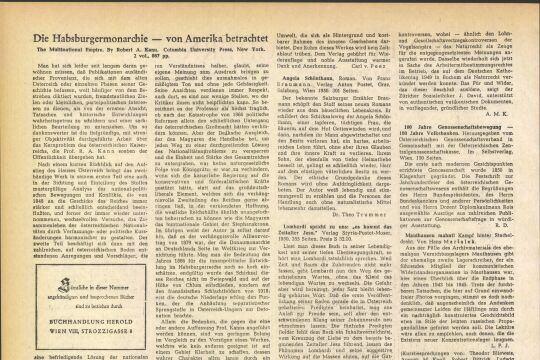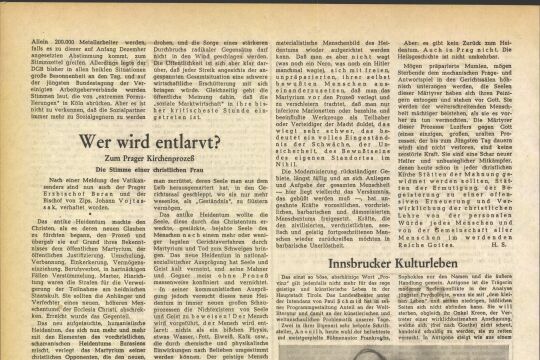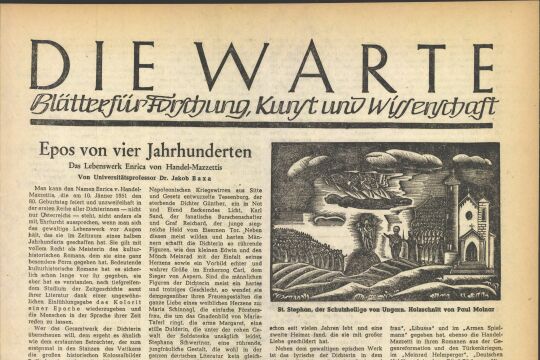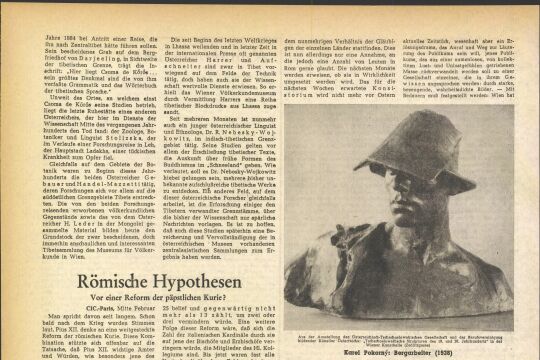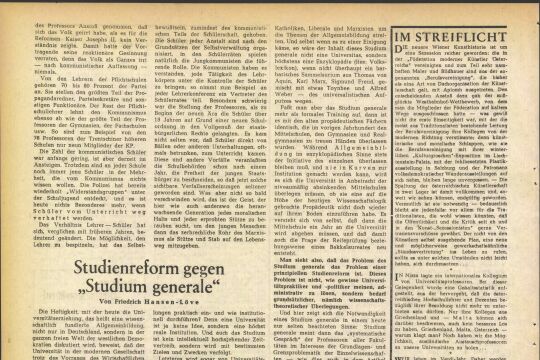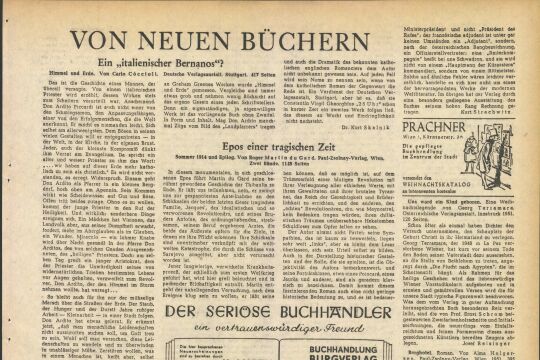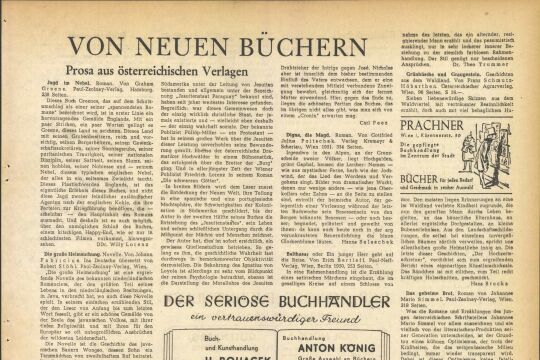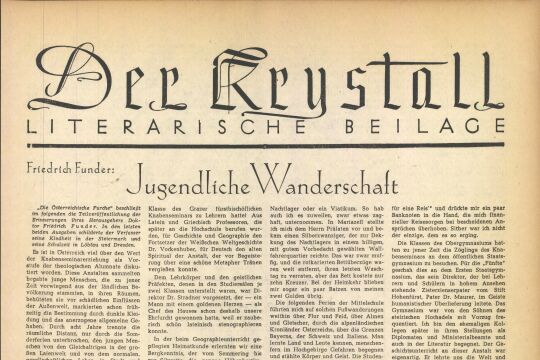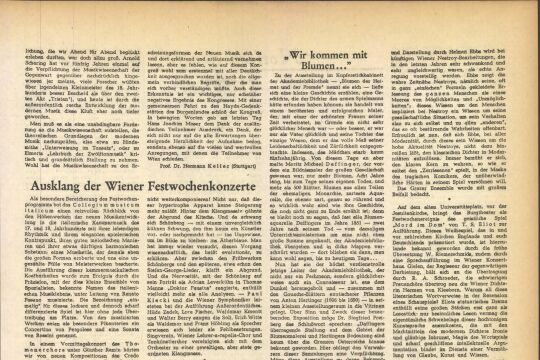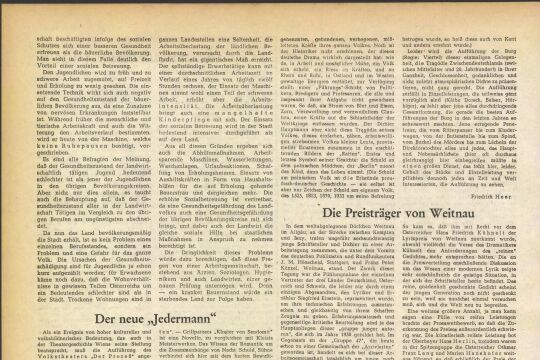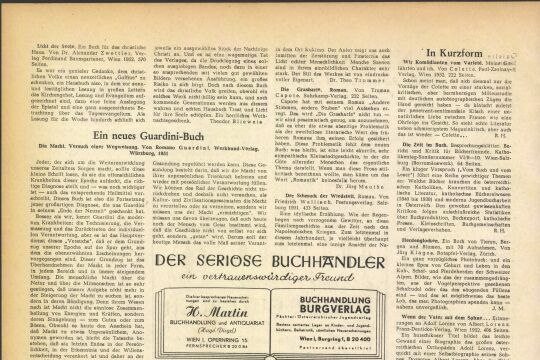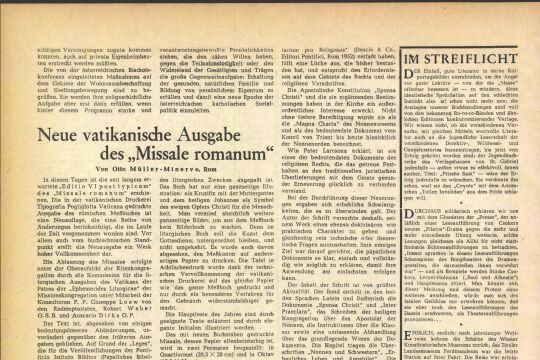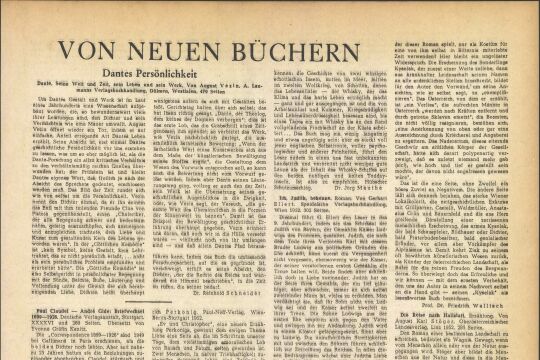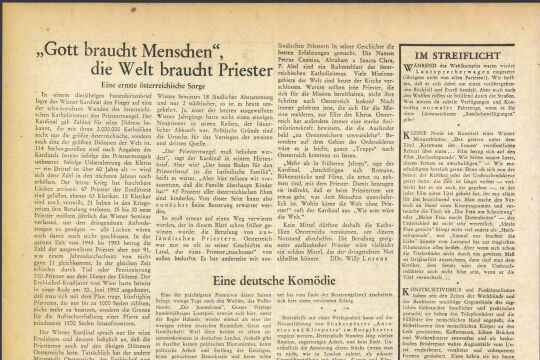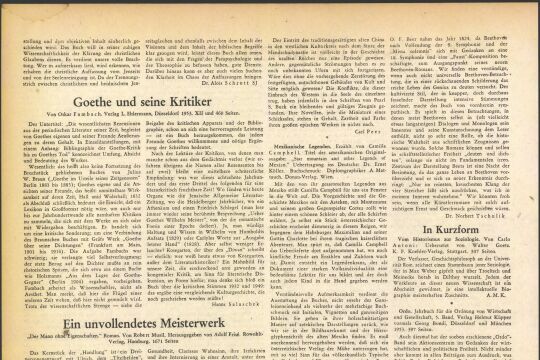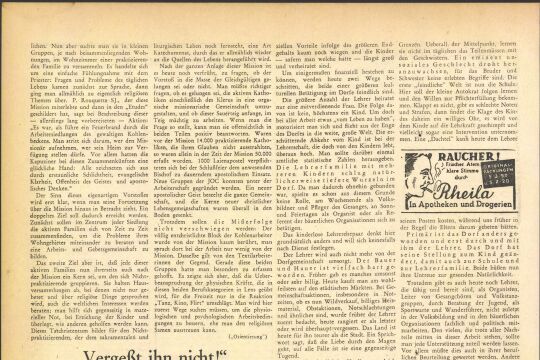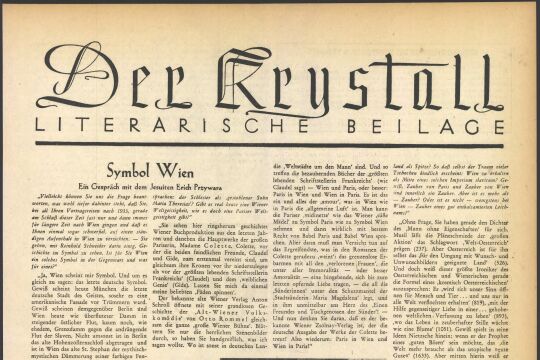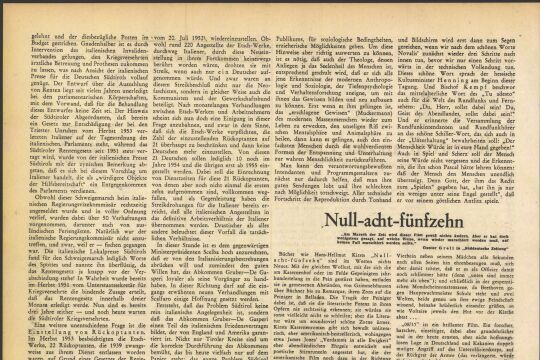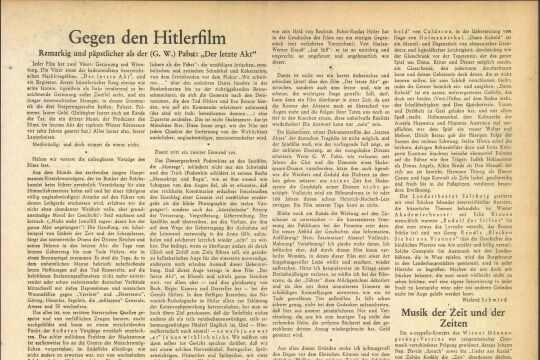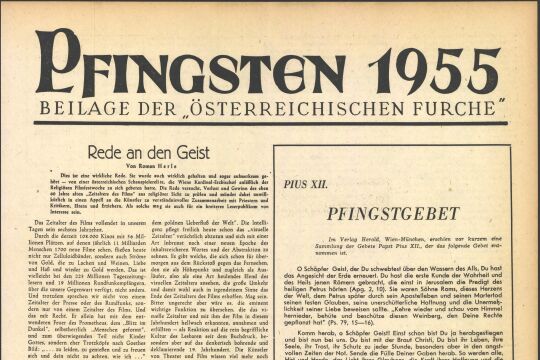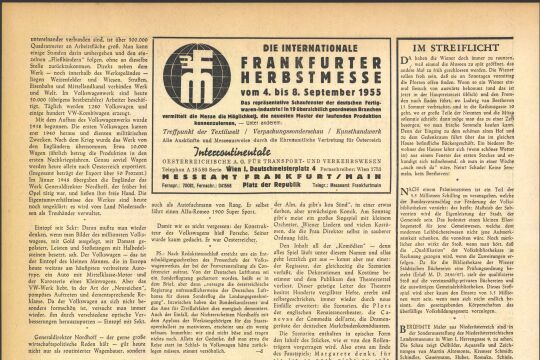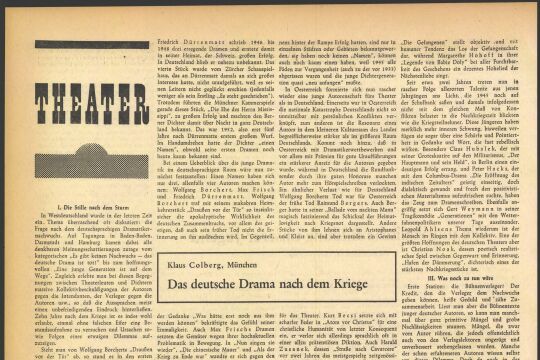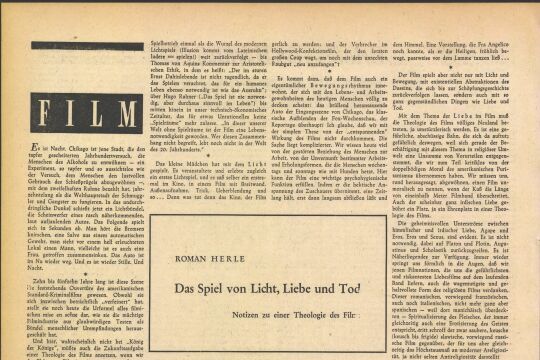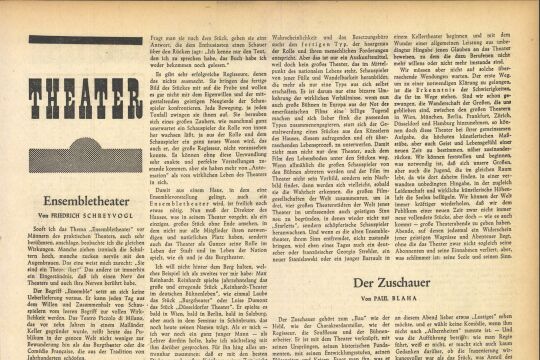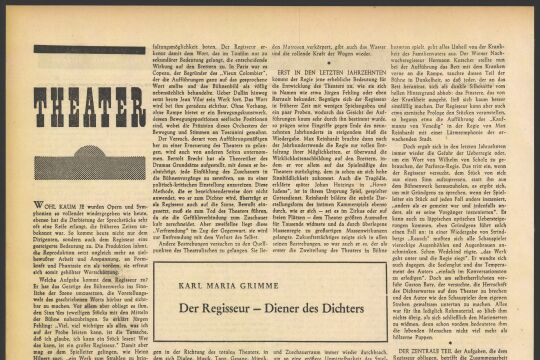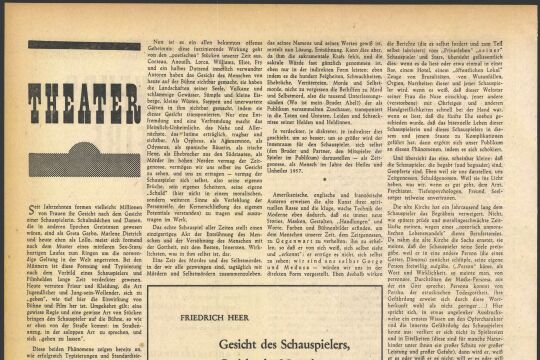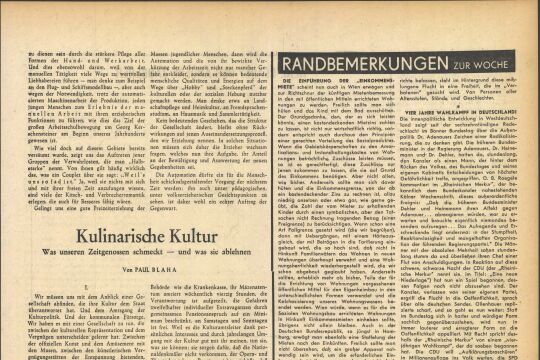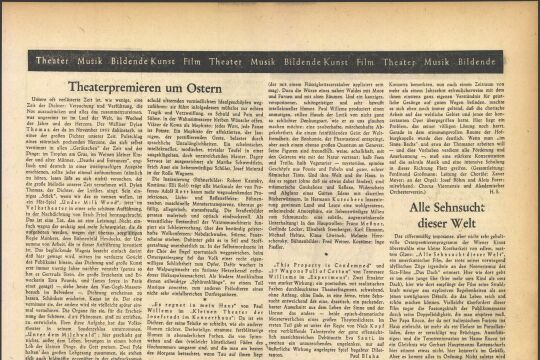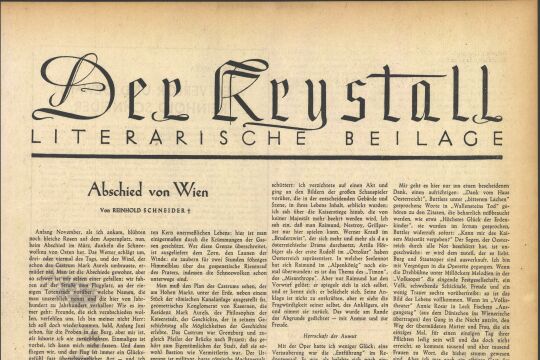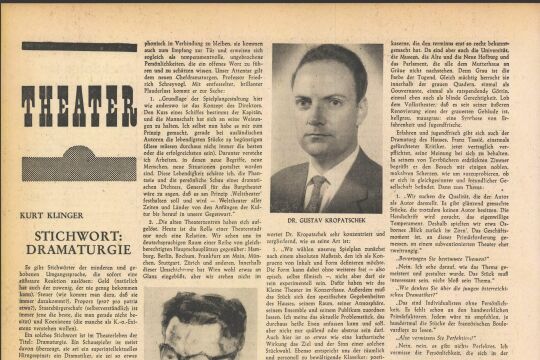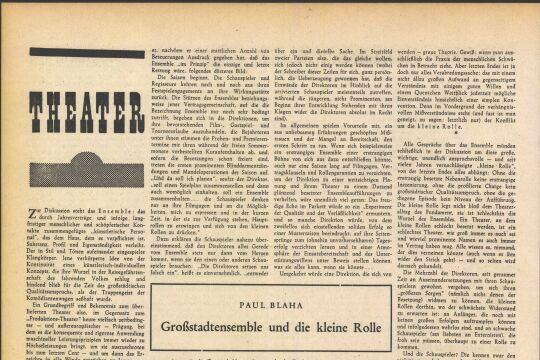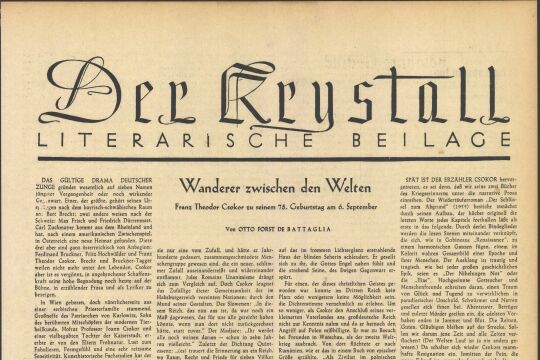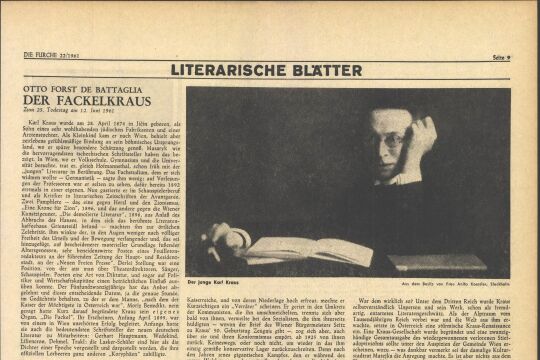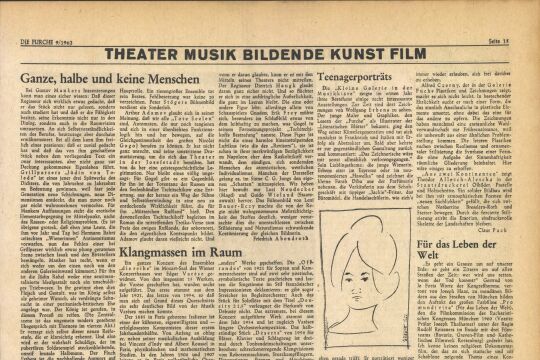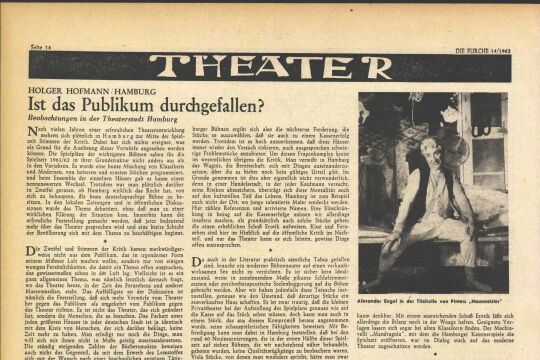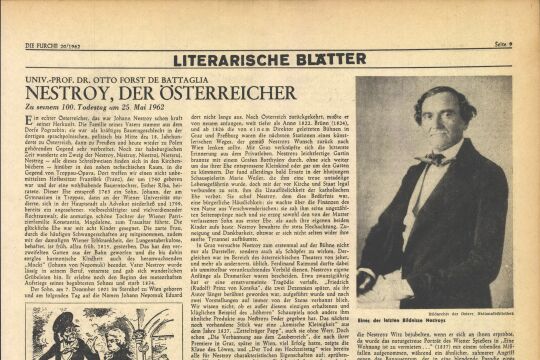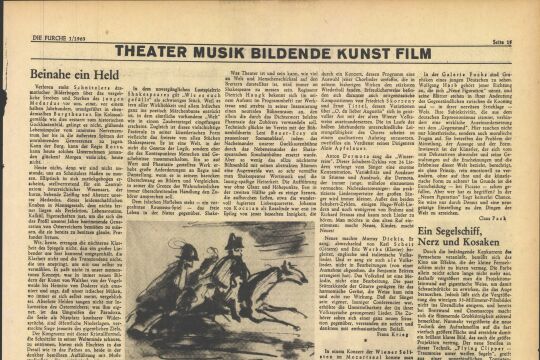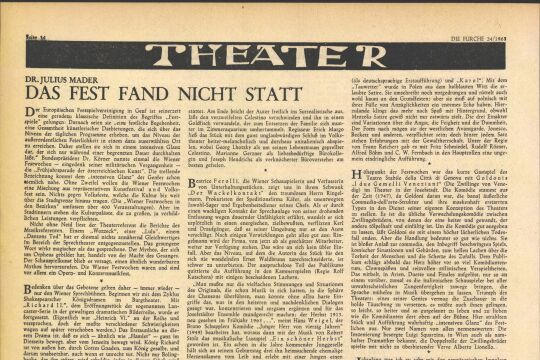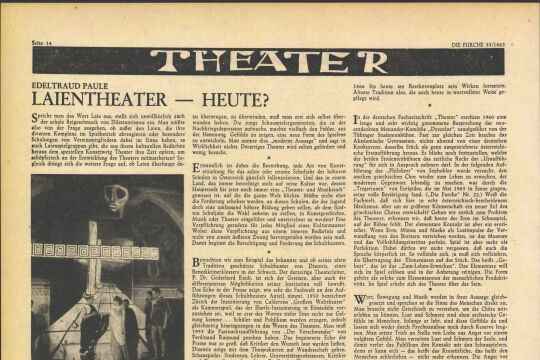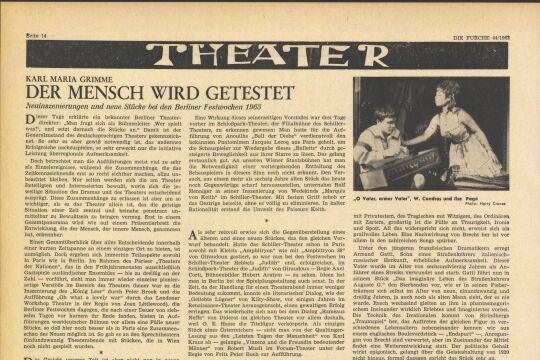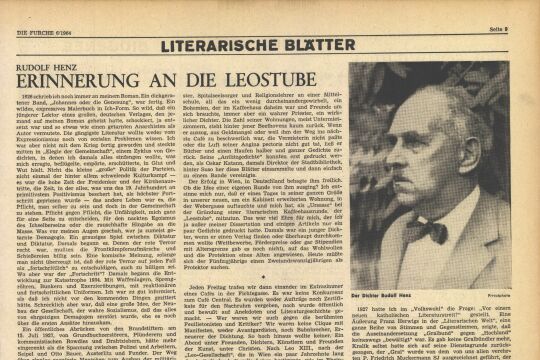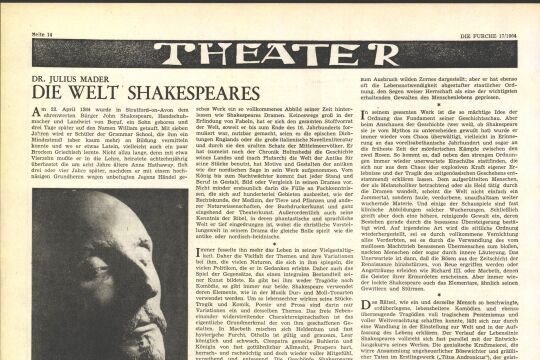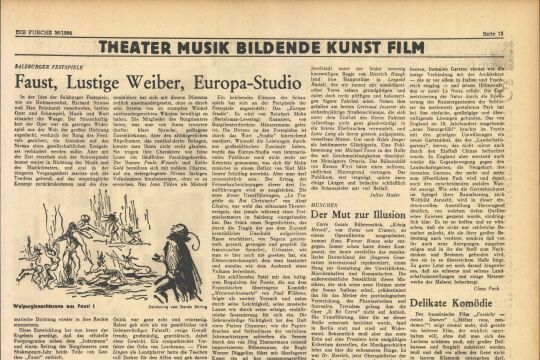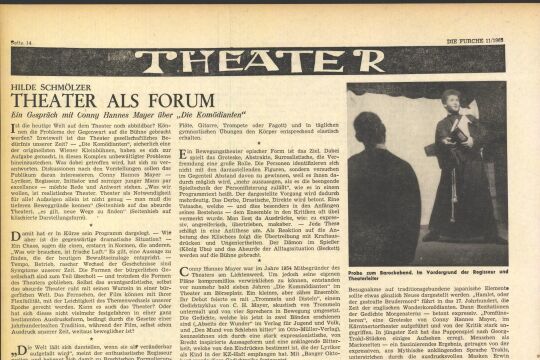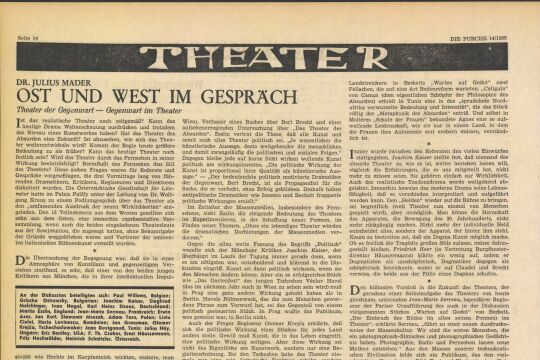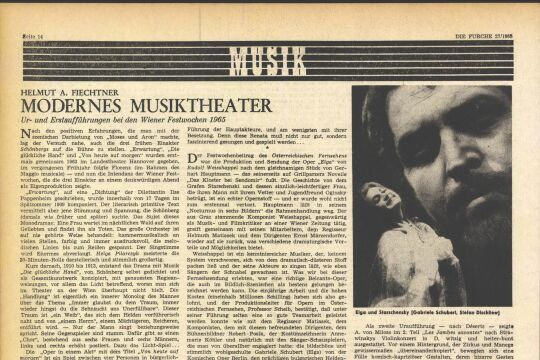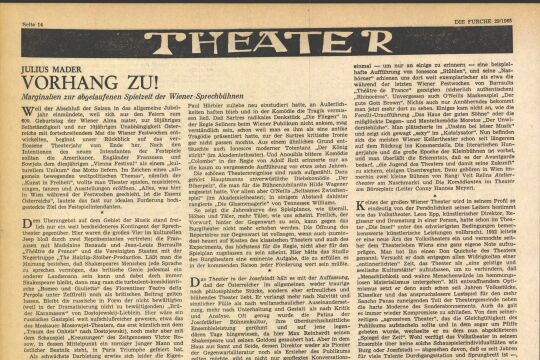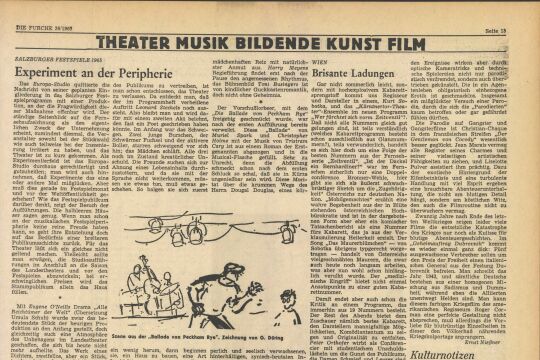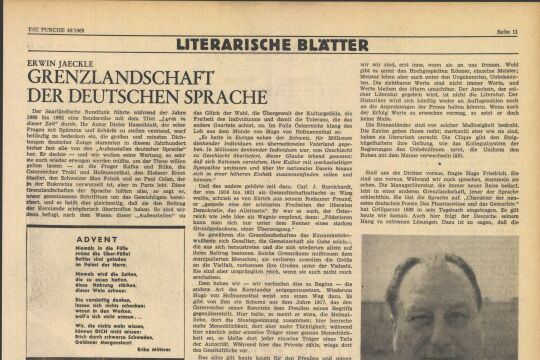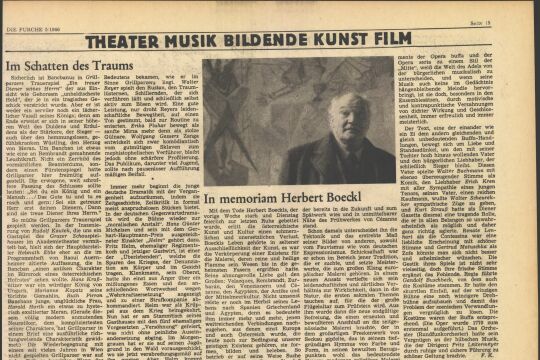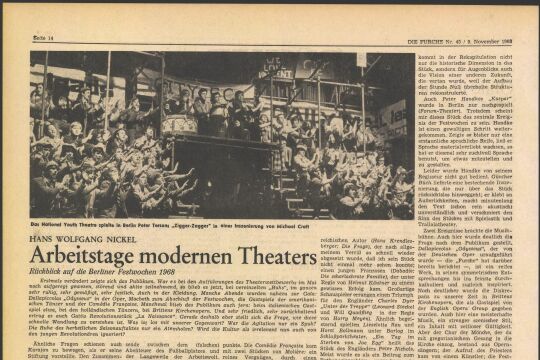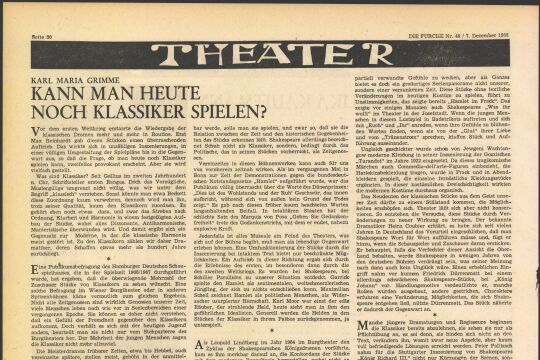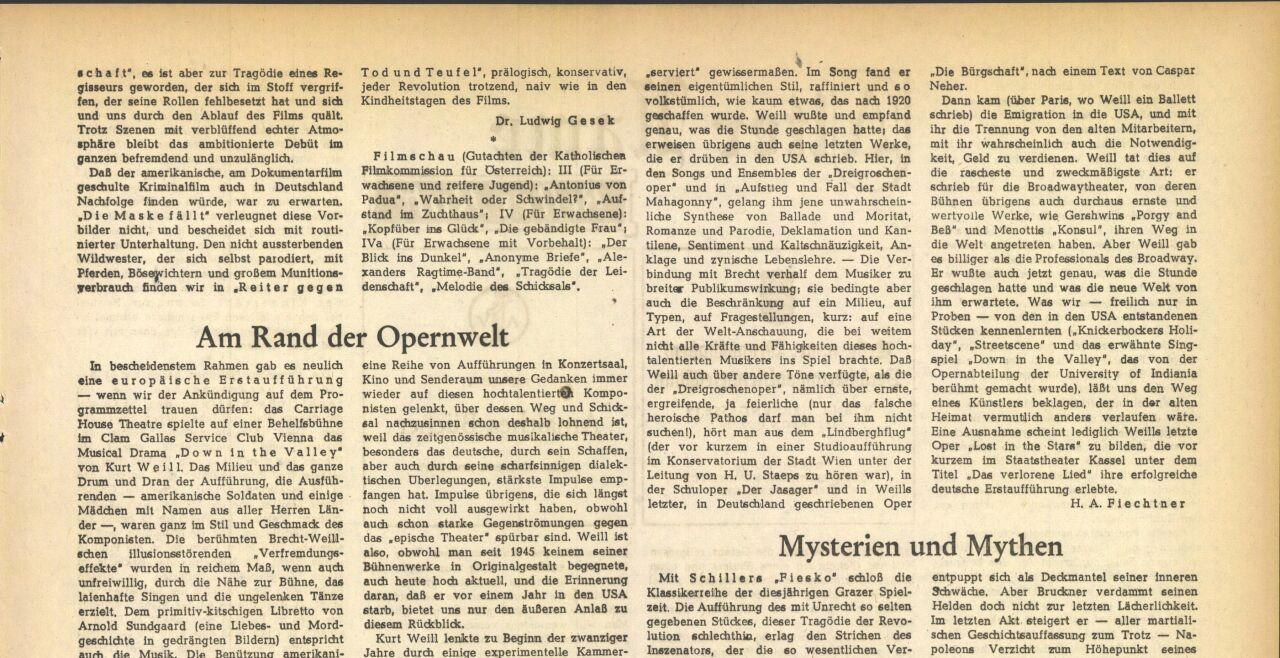
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mysterien und Mythen
Mit Schillers .Fiesko' schloß die Klassikerreihe der diesjährigen Grazer Spielzeit. Die Aufführung des mit Unrecht 60 selten gegebenen Stückes, dieser Tragödie der Revolution schlechthitt, erlag den Strichen des Inszenators, der die so wesentlichen Ver-schworenentypen zu Stichwortsprechern erniedrigte, den zweiten Teil des Dramas in Telegrammkürze mit billig verändertem Schluß (Erdolchung Fieskos neben der Leiche seiner Frau) am Zuseher vorbeiziehen ließ und hiedurch eine Rekordzeit von eindreiviertel Stunden für ein Schillersches Jugenddrama erreichte. Selbst einzelne sehr gute Leistungen der Schauspieler konnten hier nichts mehr retten.
Merkwürdig war der geringe Publikumserfolg von Ferdinand Bruckners Komödie .Napoleon I.“. Wir 6ind seit Shaw diese Kehreeitentragödien“ heroischer Menschen gewohnt, wir wissen auch um ihre Notwendigkeit: Zerstörung der romantizierenden Illusion, des theatralischen Heroismus'. Der .Übermensch“ wird in der Komödie zum .Allzumenschlichen“. Seine Gewalt nach außen
entpuppt sich als Deckmantel 6einer inneren Schwäche, Aber Bruckner verdammt seinen Helden doch nicht zur letzten Lächerlichkeit. Im letzten Akt steigert er — aller martialischen Geschichtsauffassung zum Trotz — Napoleons Verzicht zum Höhepunkt seines Lebens. Der Ubermensch ist wieder Mensch geworden. Der eiserne Griff um Europa lockert eich. Hierin, nicht in der äußerlich vielleicht angedeuteten Parallele zu nationalsozialistischen Machthabern, liegt wohl die wesentliche Gegenwartsaussage des Stückes. Peinlich berührten lediglich jene Szenen, in denen die Frauen um Napoleon Ihre Intimitäten nicht sehr geschmackvoll ausplauderten. Aber sie traten hinter das übrige Geschehen und die zum Til sehr geistreichen Dialoge zurück.
Die Aufführung von Zuckmayers „Gesang im Feuerofen', diesem Hymnus der Feindesliebe, wurde auch in Graz zum festlichen Ereignis. In der Bearbeitung und Inszenierung Herbert Herbes stand — im Unterschied zur Wiener Aufführung — das private Geschehen, die Handlung um die drei
liebenden Paare, stärker im Vordergrund, wodurch das Stück an Einheitlichkeit gewann, andererseits die Charaktere vielleicht zu sehr individualisiert, besser kompliziert wurden. Daß so mancher aus dem Publikum es nicht verstand oder nicht verstehen wollte, war insbesondere in Graz vorauszusehen; daß aber ein Teil der Presse, und gerade jener, von dein es am wenigsten zu erwarten gewesen war, diesen Kreisen noch öl ins Feuer goß, war zumindest unverantwortlich.
Mit der Feier von Anton W i 1 d g a n s' 70. Geburtstag hatte es in Graz seine Schwierigkeit. Einmal fiel von allen österreichischen Theatern nach dem „Verteilerschlüssel“ dem hiesigen die schwerste Aufgabe, die Aufführung des mythischen Gedichtes „K a i n“ zu, zum anderen konnte das Stück aus technischen Gründen erst verspätet herauskommen, erst als letzte Premiere des Schauspielhauses vor den Festspielen, also in der für ein 60 schweres Stück denkbar ungünstigsten Zeit. — Die vielen lauten Gefühlsausbrüche erscheinen unserer Zeit unaufrichtig, wie sehr uns auch einige dichterisch und ethisch besonders hochwertige Verse immer ins Gewissen sprechen. Es mag aber auch sein, daß die expressionistische Schreiform (die bei Wildgans noch immer metrisch gebändigt ist) durch das gleichbleibende Fortiesimo des ansonst guten Hauptdarstellers die erwähnte Wirkung auf den Zuhörer hatte.
Abseit6 von den Vereinigten Bühnen versuchten junge Grazer Autoren, ihre Stücke auf eigene Faust durchzusetzen: eine beispielhafte Form von Selbsthilfel Beide mit Mysterienspielen, von denen das eine, „Das zweite Gesicht“, von Emil Breisach in der Gegenwart spielt und starke Szenen aufweist. Der Inhalt selbst (eine etwas rührselige Geschichte vom Architekten ohne Auftrag und seiner erblindenden Gattin) blieb zu sehr — eine Gefahr unserer Gegenwartsdichtung — im Angedeuteten; allzu bekannte Probleme wurden aufgerollt, die Nebenrollen blieben fast Allegorien, während ein Drama doch erst durch die Individualität und Wahrscheinlichkeit der Handlung zum Symbol wird. Eine requisitenlose Regie (Theo Frisch-Ger-lach) nach Thornton Wilderschem Muster — nur mit Kerzenlicht — half durch ihre vornehme und originelle Art, zusammen mit teilweise sehr guten schauspielerischen Leistungen, dem Stück über die Klippen hinweg zu einem starken Erfolg. Ein anderes Mysterienspiel, von einer jungen Grazer Autorin ver-
faßt, bewies aufs neue die Gefahr religiösen Kitsches (Bekehrung eines Säufers und einer Dirne, Jedermannsche Sprachfassung), zumal wenn man bedenkt, daß das Stück schon wiederholt auf dem Land aufgeführt worden sein soll.
Die häufige Anwendung von Bezeichnungen wie Mythos und Mysterium scheint irgendwie das Nebulose, das über den Problemdichtungen von heute lagert, anzudeuten Aber so wie Bruckner in seinem „Napoleon“ den falschen Mythos um einen Heroen zerreißt, um den Menschen zu entpuppen, so nackt und einsam, daß wir zuletzt selbst Mitleid mit ihm haben, so beweist der „Gesang im Feuerofen“, daß ein wahrhaftiges Mysterium, wie die Uberwindung des Feindeshasses, nicht, hinter dem Schleier philosophischer, Anspielungen verborgen zu bleiben braucht, sondern sichtbar wirkliche Handlung werden kann, werden muß, um zu sein. Auf der Bühne wie im Leben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!