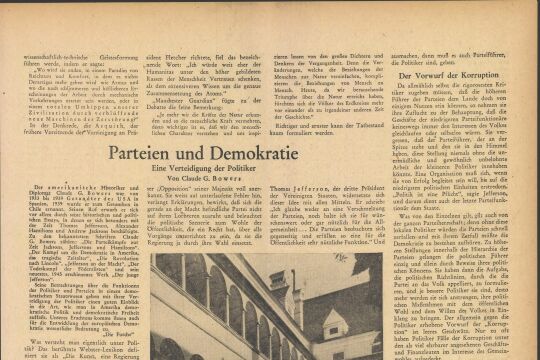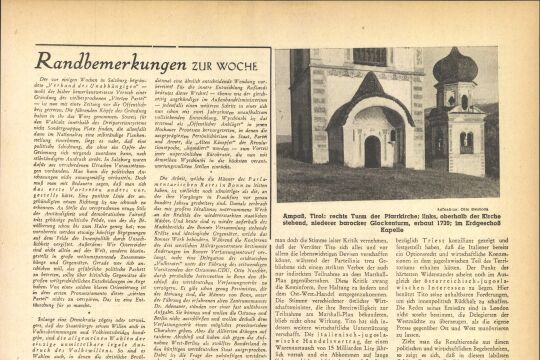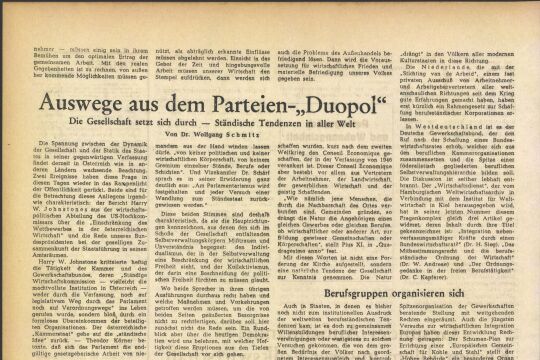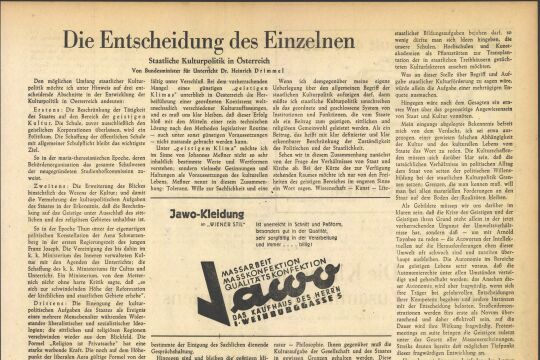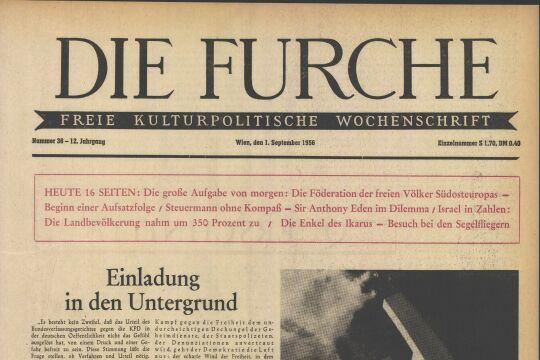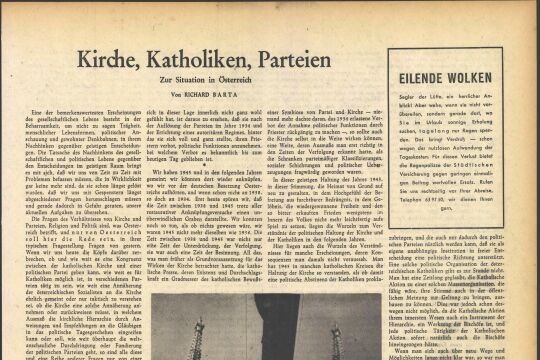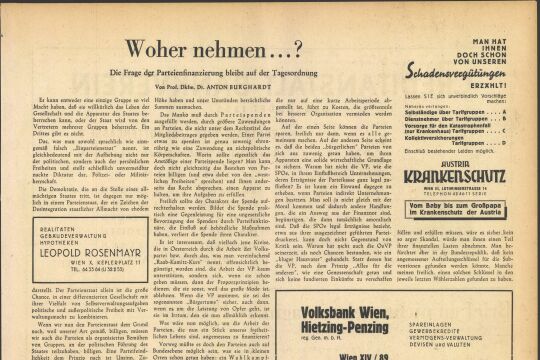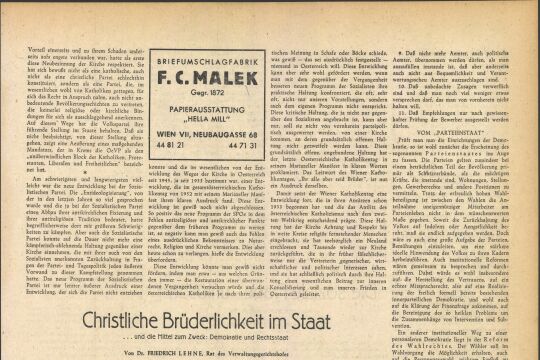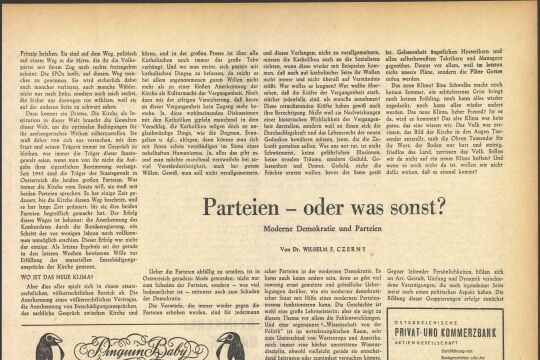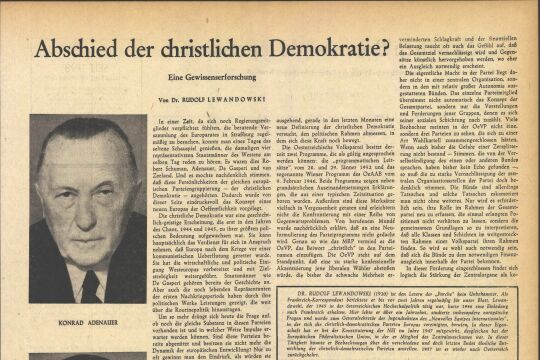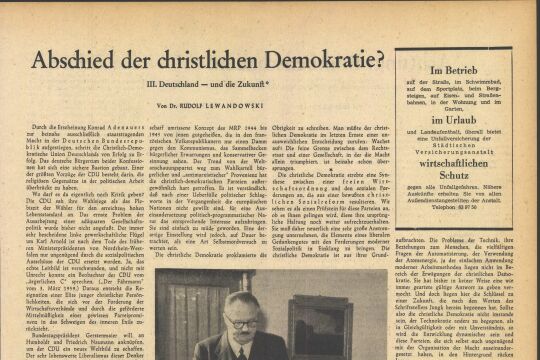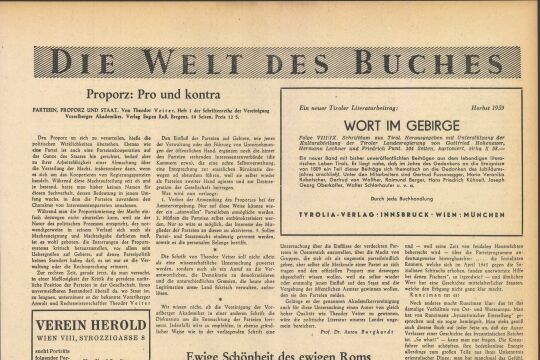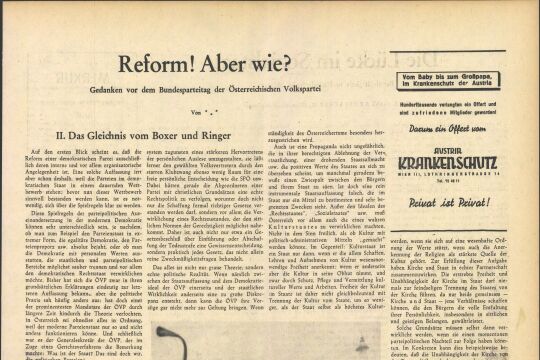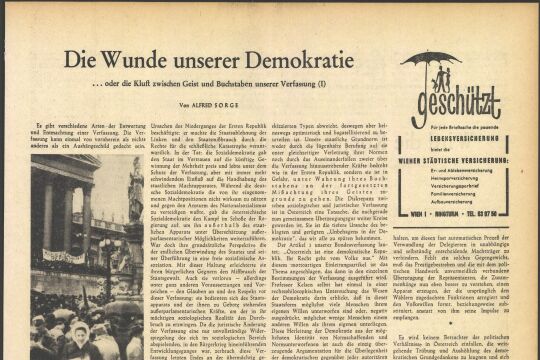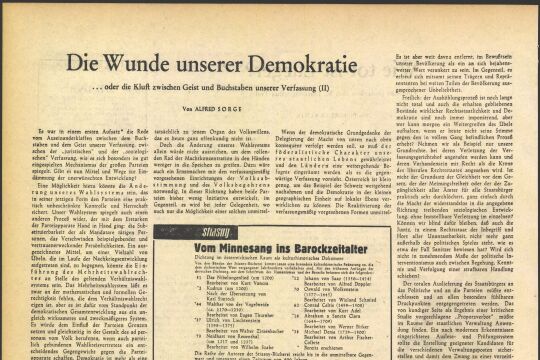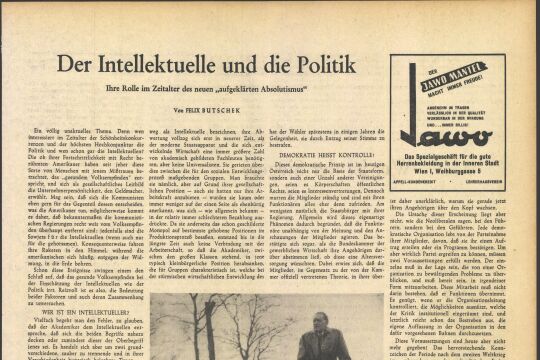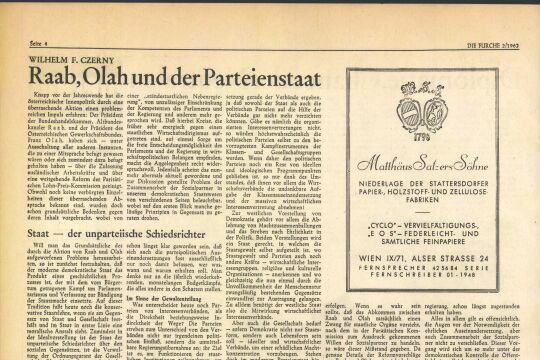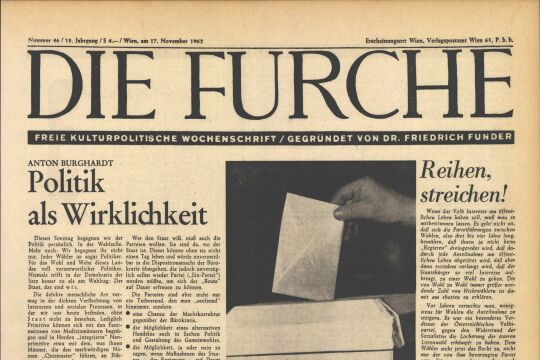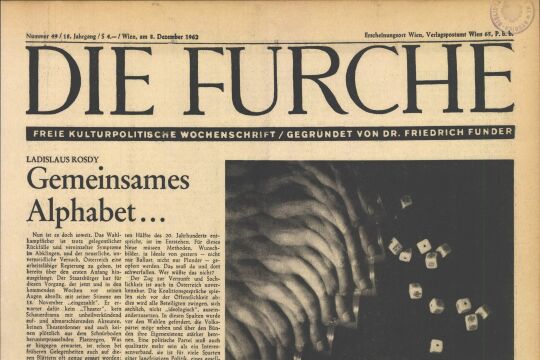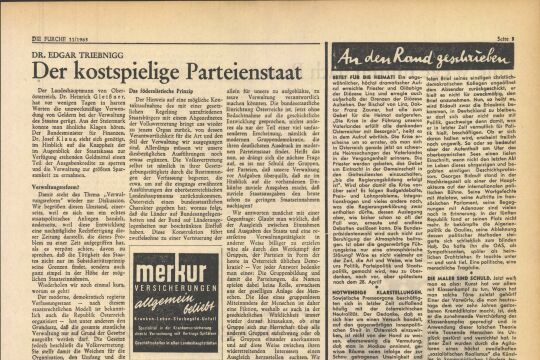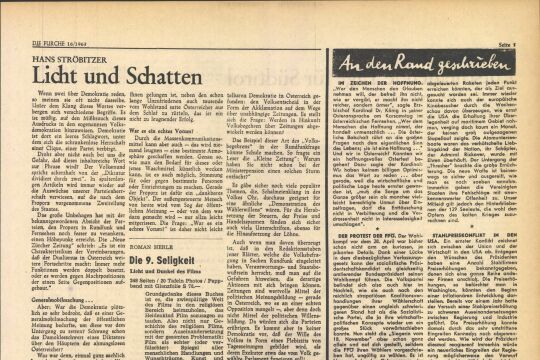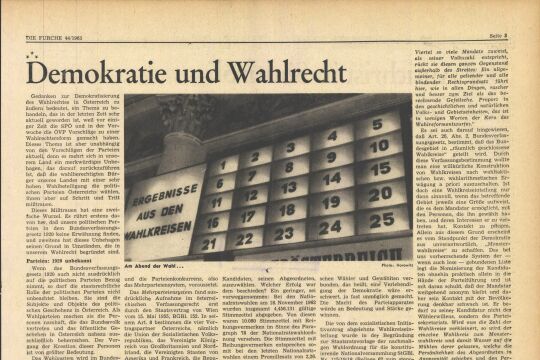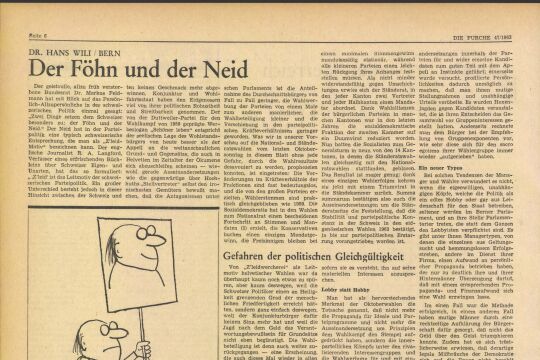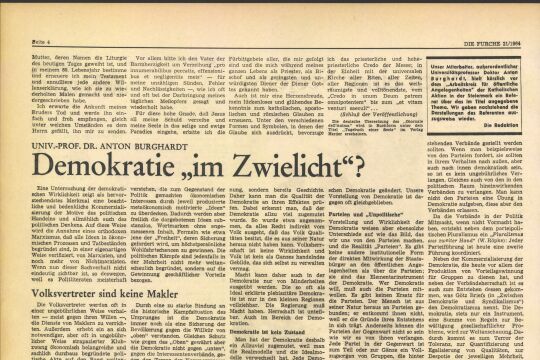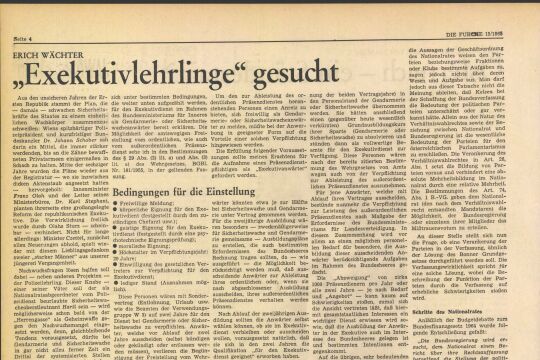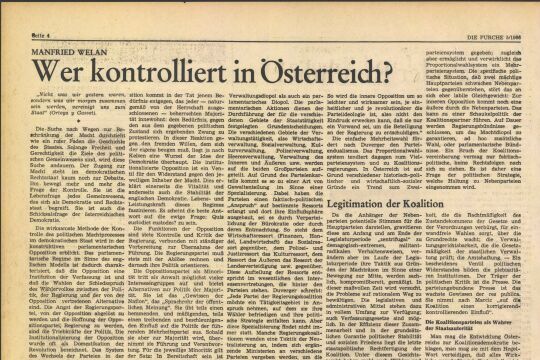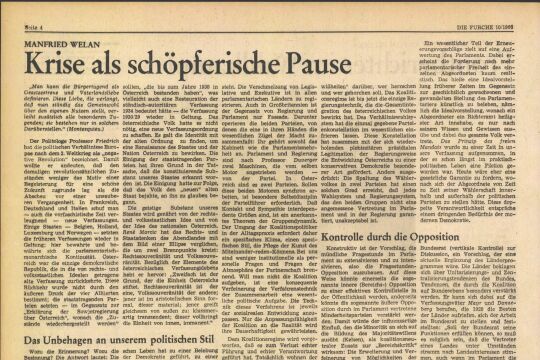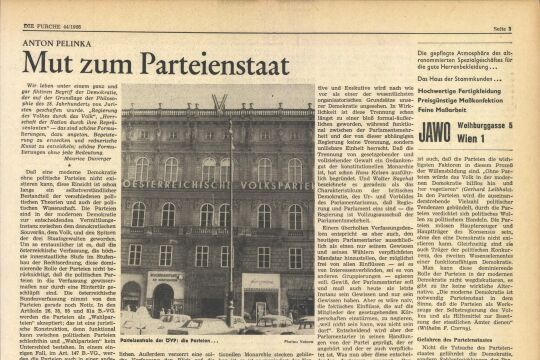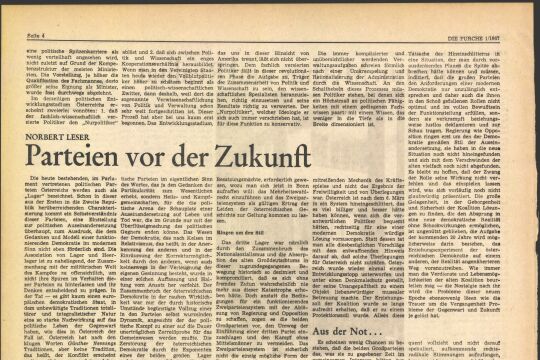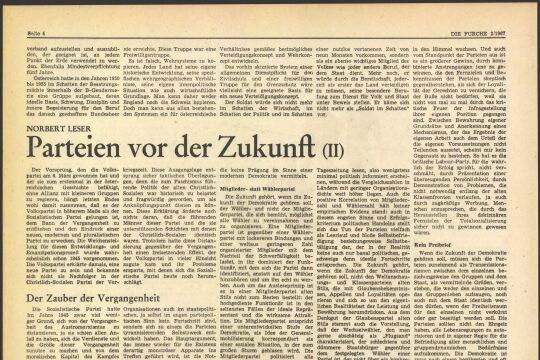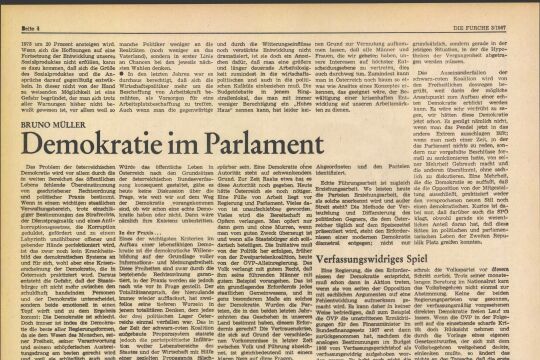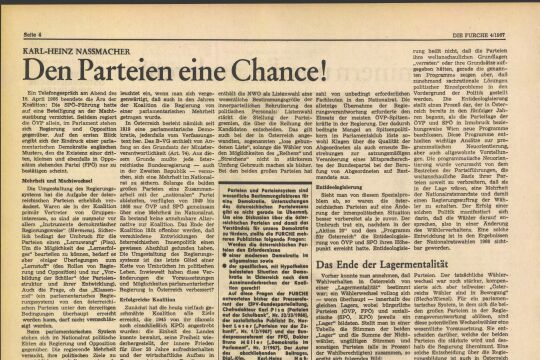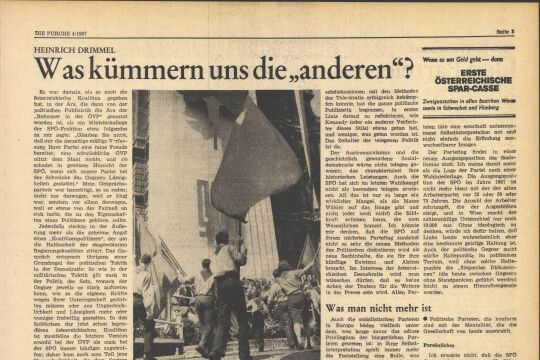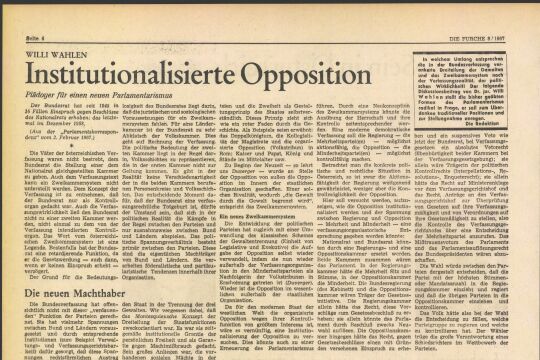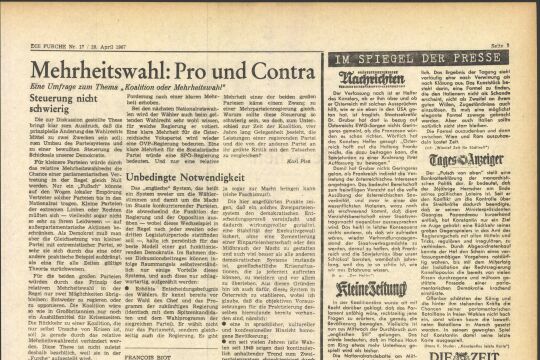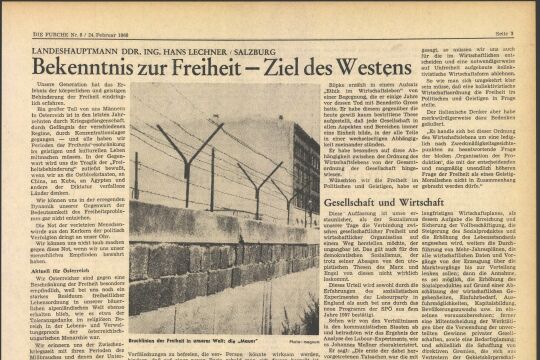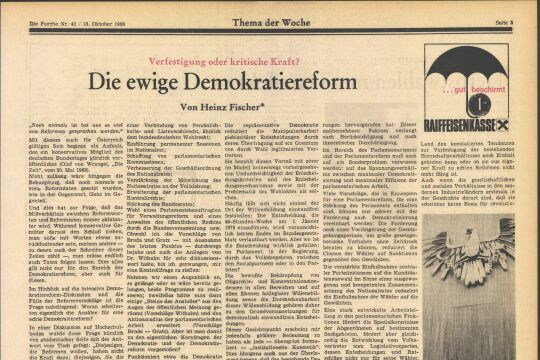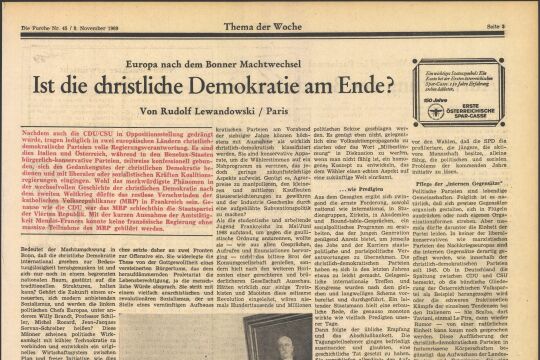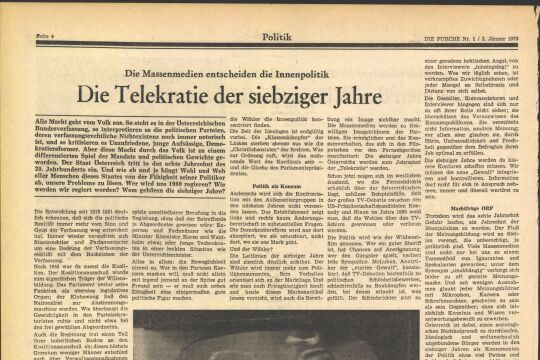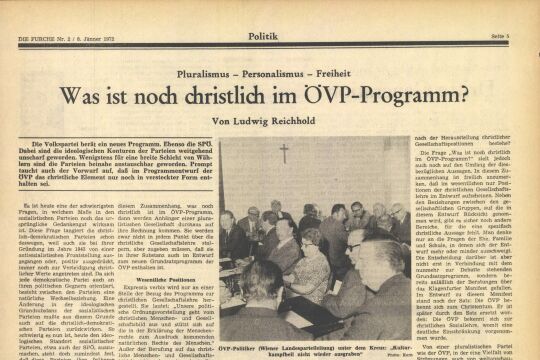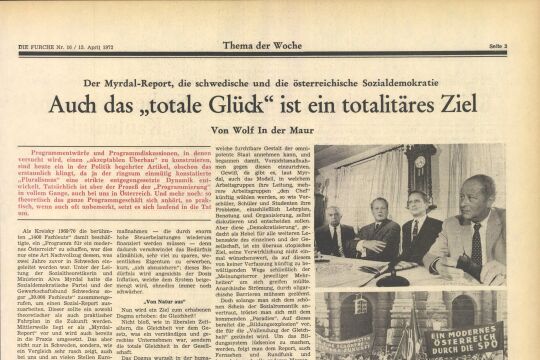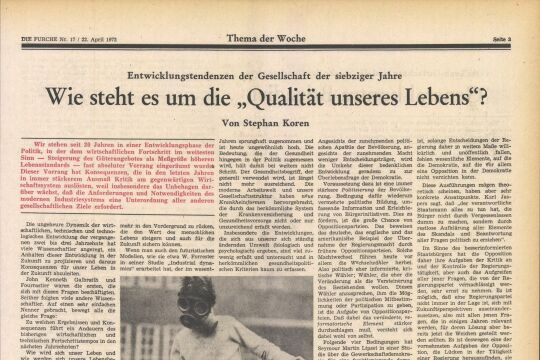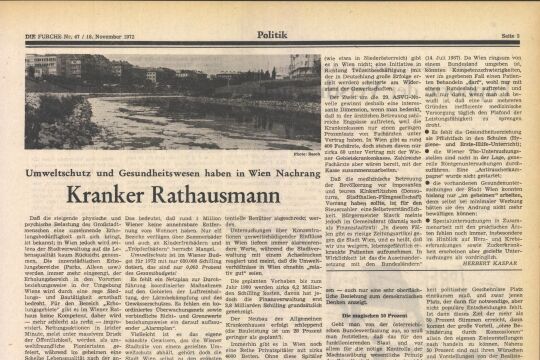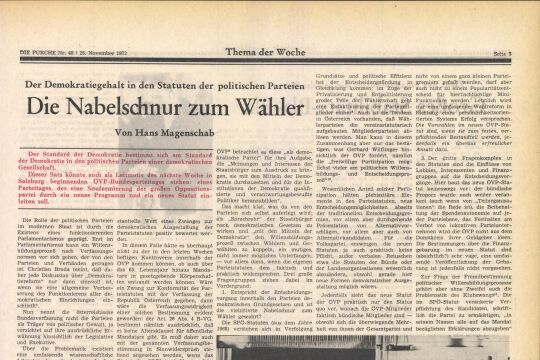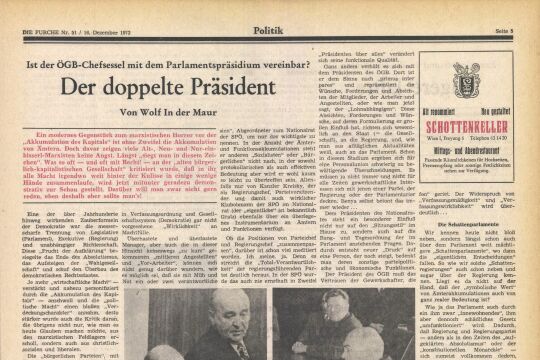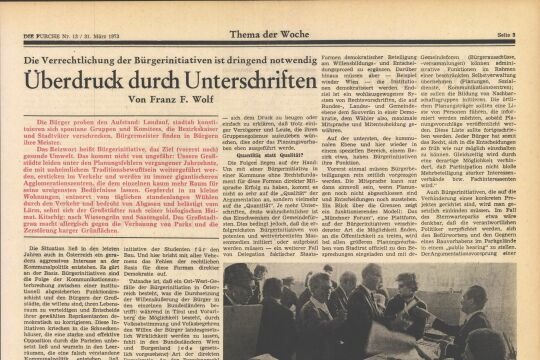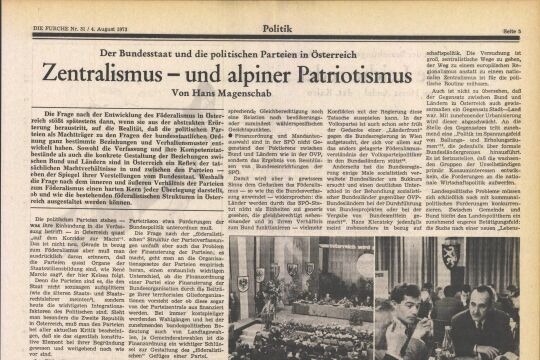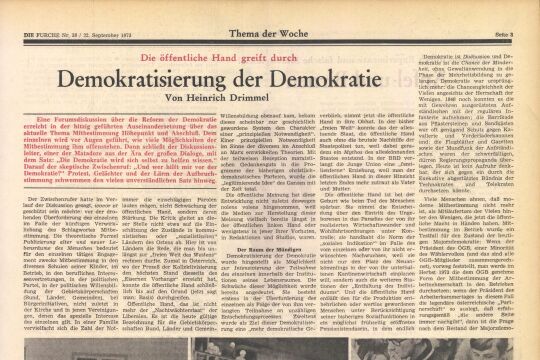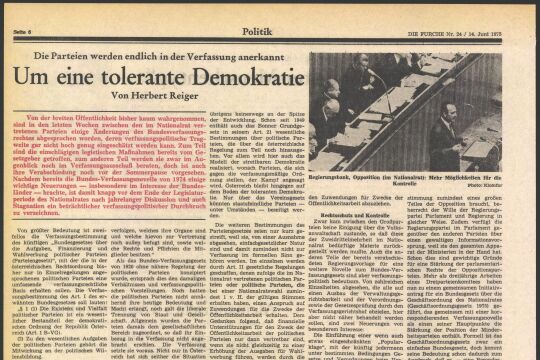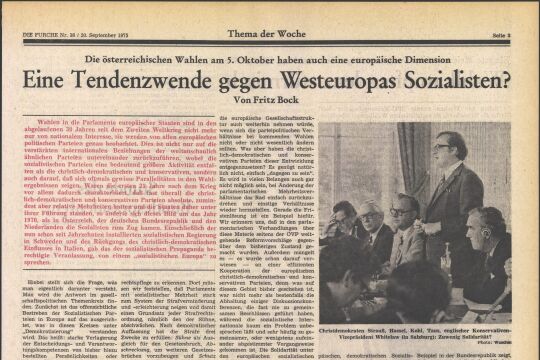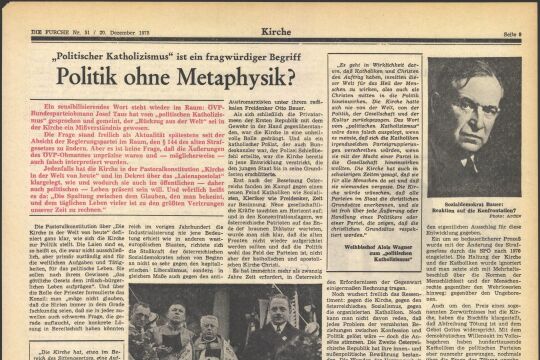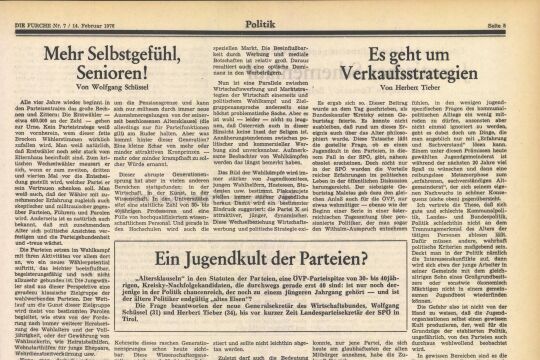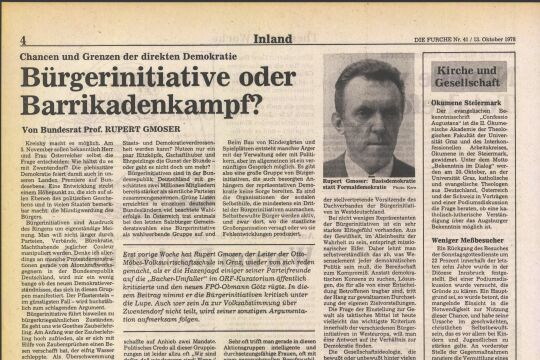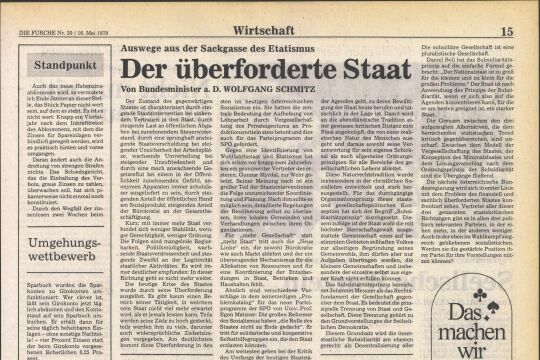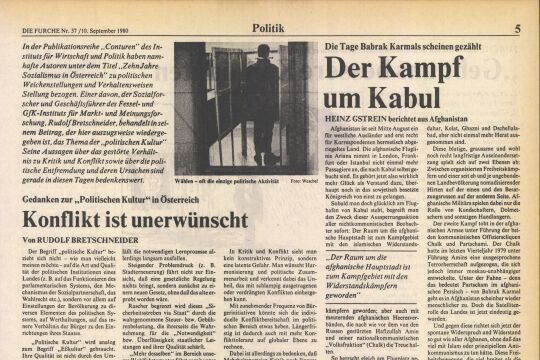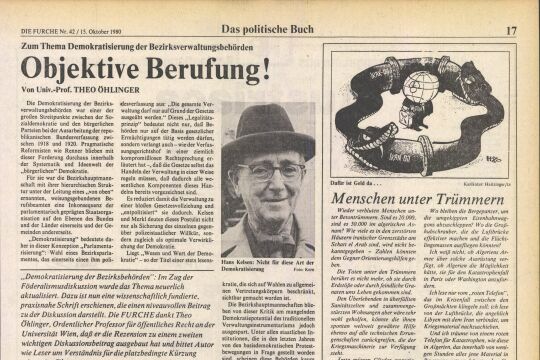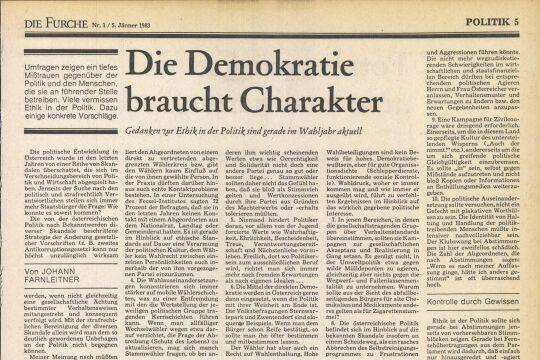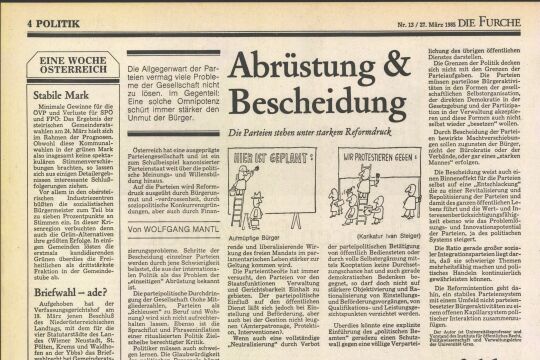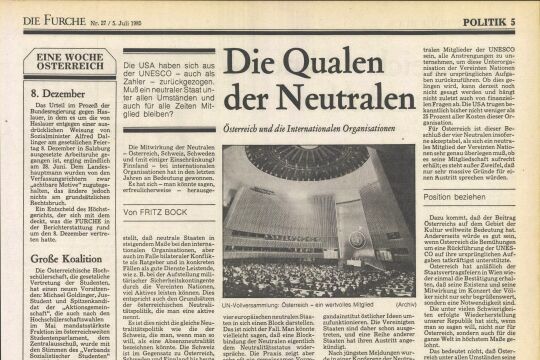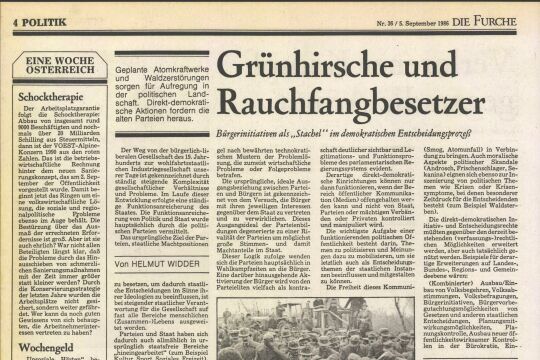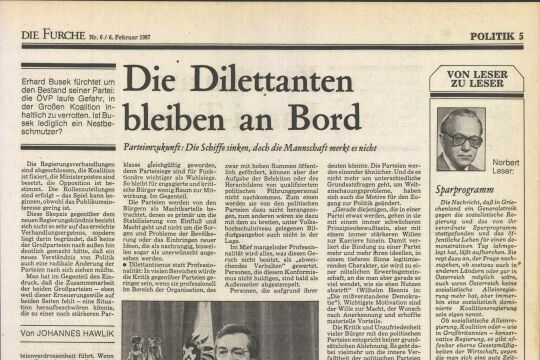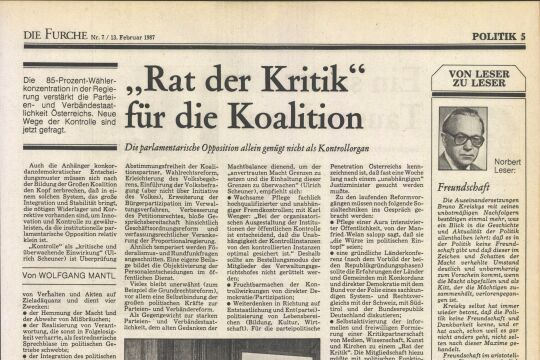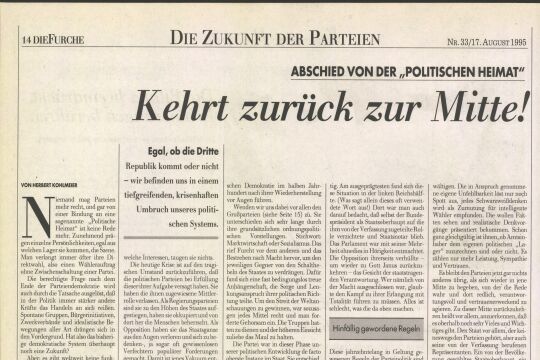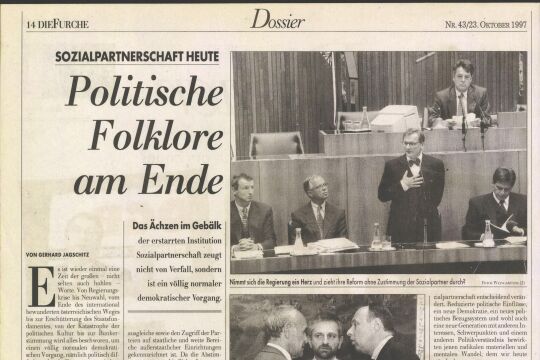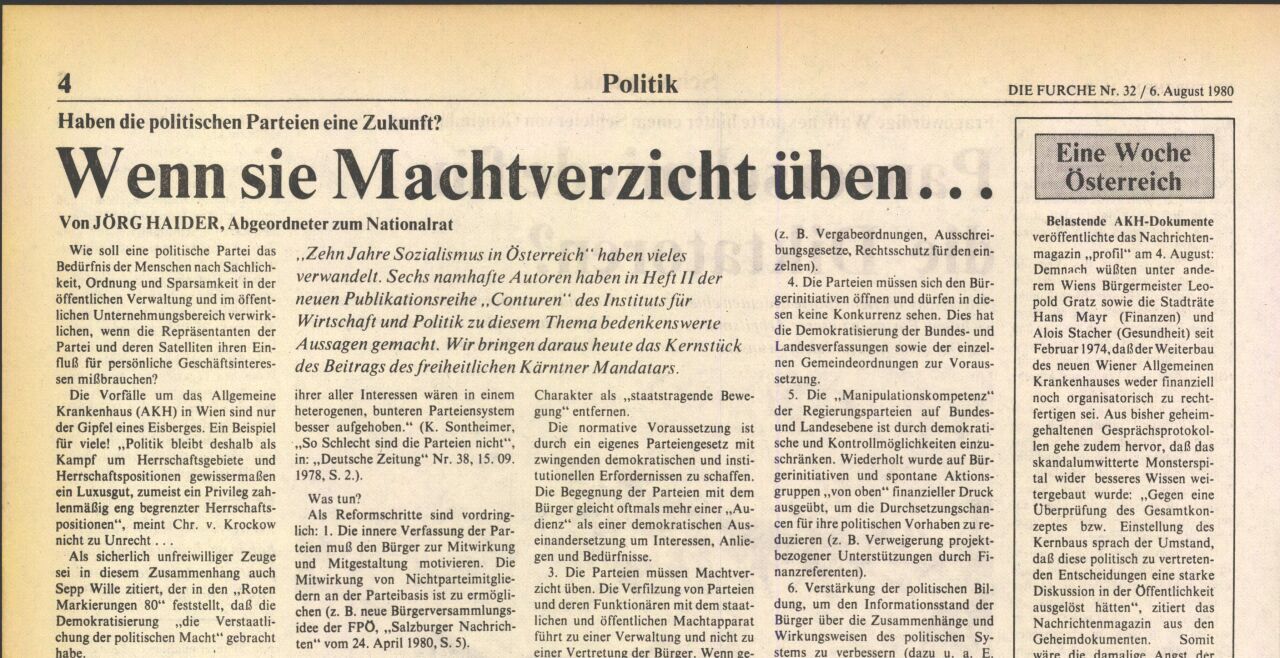
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wenn sie Machtverzicht üben...
„Zehn Jahre Sozialismus in Österreich" haben vieles verwandelt. Sechs namhafte A utoren haben in Heft II der neuen Publikationsreihe „Conturen" des Instituts für Wirtschaft und Politik zu diesem Thema bedenkens werte A ussagen gemacht. Wir bringen daraus heute das Kernstück des Beitrags des freiheitlichen Kärntner Mandatars.
„Zehn Jahre Sozialismus in Österreich" haben vieles verwandelt. Sechs namhafte A utoren haben in Heft II der neuen Publikationsreihe „Conturen" des Instituts für Wirtschaft und Politik zu diesem Thema bedenkens werte A ussagen gemacht. Wir bringen daraus heute das Kernstück des Beitrags des freiheitlichen Kärntner Mandatars.
Wie soll eine politische Partei das Bedürfnis der Menschen nach Sachlichkeit, Ordnung und Sparsamkeit in der öffentlichen Verwaltung und im öffentlichen Unternehmungsbereich verwirklichen, wenn die Repräsentanten der Partei und deren Satelliten ihren Einfluß für persönliche Geschäftsinteressen mißbrauchen?
Die Vorfälle um das Allgemeine Krankenhaus (AKH) in Wien sind nur der Gipfel eines Eisberges. Ein Beispiel für viele! „Politik bleibt deshalb als Kampf um Herrschaftsgebiete und Herrschaftspositionen gewissermaßen ein Luxusgut, zumeist ein Privileg zahlenmäßig eng begrenzter Herrschaftspositionen", meint Chr. v. Krockow nicht zu Unrecht...
Als sicherlich unfreiwilliger Zeuge sei in diesem Zusammenhang auch Sepp Wille zitiert, der in den „Roten Markierungen 80" feststellt, daß die Demokratisierung „die Verstaatlichung der politischen Macht" gebracht habe.
Genau das aber ist der springende Punkt. Im Ergebnis bewirkte die Demokratisierung nicht Dezentralisierung und Liberalität, Aufteilung und Kontrolle der Macht, sondern diese wurde unter Mitwirkung der politischen Parteien „verstaatlicht" und wird unter der Abfolge von Funktionärlisten, oftmals auch antielitärer Eliten, übertragen ...
Einen nicht unerheblichen Anteil an dieser Entwicklung haben der Wandel der Parteien von den alten Weltanschauungsparteien zu den sogenannten „Allerweltsparteien" und die materia-listischeGrundeinstellung vieler Bürger.
Die Programme decken im Sinne der weltanschaulichen Integration ein mög-
liehst breites Wählerpotential ab und reduzieren damit die Konfliktsbereitschaft in Grundsatzfragen, weil man keine möglichen Wählergruppen verlieren möchte...
Engagement und Initiative von Bürgern wird immer dann am meisten geschätzt, wenn solche überhaupt nicht vorhanden sind und keine Störung des eingefahrenen Parteialltags vorhanden ist . . .
Nach diesem Tatbestand ergibt sich eine zwingende Schlußfolgerung:
„Es geht in der jetzigen Situation nicht darum, daß die etablierten Parteien ihren Besitzstand verteidigen oder gar noch ausbauen sollen - sie täten umgekehrt gut daran, ihr allzu unbekümmertes Versorgungsdenken und ihre in allen öffentlichen Bereichen sich erstreckenden Durchdringungsstrategien kritisch zu überprüfen; es geht vielmehr darum, das unsere politische Stabilität verbürgende Parteiensystem zu erhalten; es geht darum, die großen Parteien vor dem Auseinanderfallen in mehrere Interessen- und ideologische Parteien alten Stils zu bewahren, und die Bürger, -auch die zeitweilig verdrossenen - vor dem Trugschluß zu warnen,
ihrer aller Interessen wären in einem heterogenen, bunteren Parteiensystem besser aufgehoben." (K. Sontheimer, „So Schlecht sind die Parteien nicht", in: „Deutsche Zeitung" Nr. 38, 15. 09. 1978, S. 2.).
Was tun?
Als Reformschritte sind vordringlich: 1. Die innere Verfassung der Parteien muß den Bürger zur Mitwirkung und Mitgestaltung motivieren. Die Mitwirkung von Nichtparteimitglie-dern an der Parteibasis ist zu ermöglichen (z. B. neue Bürgerversammlungsidee der FPÖ, „Salzburger Nachrichten" vom 24. April 1980, S. 5).
2. Die Parteien müssen wieder in Struktur und Auftrag ein Instrument der Vertretung des Volkswillens werden und sich von ihrem selbstgewählten
Charakter als „staatstragende Bewegung" entfernen.
Die normative Voraussetzung ist durch ein eigenes Parteiengesetz mit zwingenden demokratischen und institutionellen Erfordernissen zu schaffen. Die Begegnung der Parteien mit dem Bürger gleicht oftmals mehr einer „Audienz" als einer demokratischen Auseinandersetzung um Interessen, Anliegen und Bedürfnisse.
3. Die Parteien müssen Machtverzicht üben. Die Verfilzung von Parteien und deren Funktionären mit dem staatlichen und öffentlichen Machtapparat führt zu einer Verwaltung und nicht zu einer Vertretung der Bürger. Wenn gegenwärtig schon jede Einstellung einer Putzfrau im öffentlichen Dienst zum Politikum wird, ist dies ein Alarmsignal für das parteipolitische Ubermaß
(z. B. Vergabeordnungen, Ausschreibungsgesetze, Rechtsschutz für den einzelnen).
4. Die Parteien müssen sich den Bürgerinitiativen öffnen und dürfen in diesen keine Konkurrenz sehen. Dies hat die Demokratisierung der Bundes- und Landesverfassungen sowie der einzelnen Gemeindeordnungen zur Voraussetzung.
5. Die „Manipulationskompetenz" der Regierungsparteien auf Bundesund Landesebene ist durch demokratische und Kontrollmöglichkeiten einzuschränken. Wiederholt wurde auf Bürgerinitiativen und spontane Aktionsgruppen „von oben" finanzieller Druck ausgeübt, um die Durchsetzungschancen für ihre politischen Vorhaben zu reduzieren (z. B. Verweigerung projektbezogener Unterstützungen durch Finanzreferenten).
6. Verstärkung der politischen Bildung, um den Informationsstand der Bürger über die Zusammenhänge und Wirkungsweisen des politischen Systems zu verbessern (dazu u. a. E. Fraenkel, „Strukturdefekte der Demokratie und deren Uberwindung", in: „Deutschland und die westlichen Demokratien", 1964, S. 55).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!