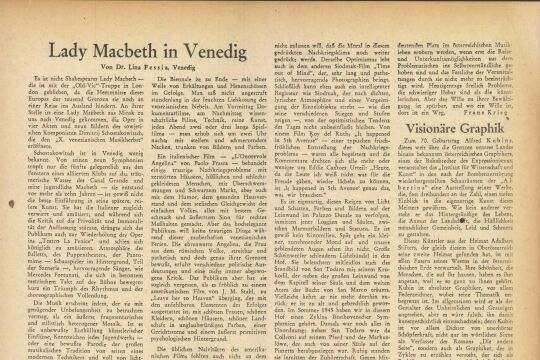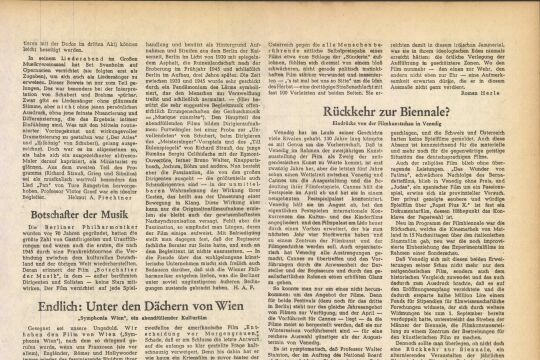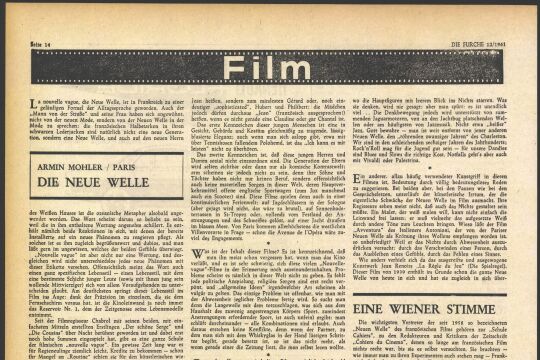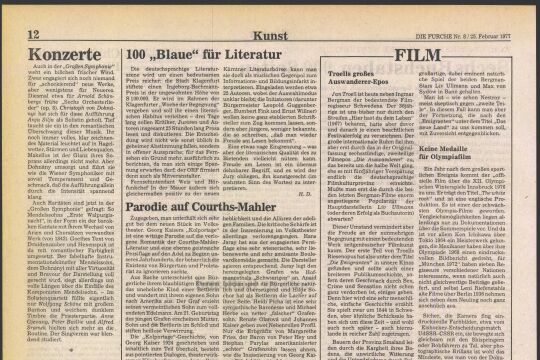Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
CHINA IST NAHE...
Während an dieser Stelle vor einem Jahr — fast auf den Tag genau — über die Filmkunstschau in Venedig 1966 zu lesen war, daß sie „ein unerhört aufschlußreiches und wertvolles Festival“ gewesen war, konnte Wiens sachkundige Filmpresse nichts anderes, als den Tod der Filmkunstschau am Lido zu prophezeien... Sie war auch demgemäß, um die Richtigkeit dieser Voraussage zu demonstrieren, heuer bei der „28. Most'ra Internazionale d'Arte Cinematograflca“ in Venedig kaum vertreten. Dabei war schon seit langem, mindestens seit fünf bis sechs Jahren, kein venezianisches Filmfestival so geschlossen, so reich an künstlerischen Eindrücken, so provozierend modern und so faszinierend gegenwartsnah wie das diesjährige achtundzwanzigste.
Filmfestivals gibt es heute nicht weniger als Theatersommerfestspiele — und die meisten von ihnen sind gleich unnötig; dies schafft schon eine bestimmte Beschränkung auf einige wenige, wirklich bedeutende und schon „eingeführte“. Dieses Wort birgt wieder weiter eine Gefahr in sich: „eingeführt“ bedeutet oft schon soviel wie konventionell, ständig sich wiederholend und daher langweilig — ein Moment, das auf alle großen und alteingesessenen, auf alle bereits traditionellen Filmfestspiele wie Cannes (das in einen Treffpunkt der Film-High-Society auszuweichen versucht), Berlin (das verzweifelt um eine neue Form ringt), Locarno (das eigentlich überhaupt gar nicht mehr existiert), Moskau (das unfehlbar ist, sich daher nie andern wird, weil es das nicht darf) und natürlich auch Venedig zutrifft.
Die Festspielleitung am Lido, der zu Unrecht vielgeschmähte, in Wahrheit aber überaus durchdacht arbeitende Prof. Luigi Chiarini, hat dies natürlich längst erkannt, vermutlich schon länger als die meisten heftig die Mostra kritisierenden „Fachleute“. Und seit Jahren wird langsam im Palazzo del Cinema eine Reform vorbereitet und allmählich durchgeführt (im Vorjahr waren die ersten Bemühungen dazu deutlich erkennbar, so man nur ein wenig vom Filmmetier verstand), die heuer die ersten Früchte brachte, Früchte, deren erste Lese schon köstlich war und noch reichere Ernten für die Zukunft verspricht. Die Parole lautete: „Weg von Schema und Klischee (der anderen Festivals) zu neuen und zeitgemäßen Formen!“ So bot Venedig in diesem Jahr ein eminent modernes Festival, das wie kein zweites sich mit den typischen Ausdrucksmöglichkeiten des Films der Gegenwart, der unmittelbaren Gegenwart des Jahres 1967, befaßte und in seinen verbindlichsten Themenstellungen präsentierte, nämlich im „jungen Film“ jeder Nation.
Zur Untermauerung der vorher angeführten These seien die wichtigsten Beispiele herausgegriffen: der „junge“ oder „neue Film“ (nicht mehr vergleichbar mit den Werken der französischen „nouvelle vague“, die aber doch als Vorkämpfern! aller nachfolgenden mehr oder weniger experimentellen Versuche zur Erneuerung des schon etwas steril gewordenen künstlerisch bemühten Films — nicht des kommerziellen, der ebenfalls im Laufe der letzten Jahre eine Veränderung, wenn auch anderer Natur, erlebt hat — anzuerkennen ist) war durch Erstlingswerke (Frankreich: „O Salto“ von Christian de Chalonge, „Le mur“ von Serge Roullet; deutsche Bundesrepublik: „Mahlzeiten“ von Edgar Reitz, „Spur eines Mädchens“ von Gustav Ehmck, „Tätowierung“ von Johannes Schaaf; England: „Dutchman“ von Anthony Harvey; USA: „Ciao“ von David Tucker, „Festival“ von Murray herner) oder durch Zweit- oder Drittwerke junger Regisseure („Jutro“ von Purisa Djordjeviö, Jugoslawien; „I sowersivi“ von Paolo und Vittorio Taviani sowie „La Cina e vicina“ von Morco Bei-
locchio, beide Italien) vertreten, die alle eine starke sozial-und gesellschaftskritische oder politisch-weltanschauliche Tendenz vertraten.
Ihnen gegenüber standen die Werke schon anerkannter oder sogar „berühmter“ Filmschöpfer, die aber zumeist alle ein bestimmtes „Engagement“ aufwiesen: Jean-Luc Godard mit „La Chinoise“ (Titel und Regisseur sagen schon genug über Inhalt und Gestaltung dieses von seinen Fans hymnisch gepriesenen, für seine kritischen Betrachter kaum noch erträglichen Filmspaßes aus!), Robert Bresson mit „Mou-chette“, Karel Kachyna mit „Die Nacht der Braut“ (CSSR), Zoltan Eabri mit „Das Ende der Saison“ („Utoszezon“, Ungarn) und Gyorgy Revesz mit „Drei Liebesnächte“ (ebenfalls Ungarn). In allen diesen Filmen war „China irgendwie nahe“ — in Anlehnung an das unübersetzbare Wortspiel von Bellocchios „La Cina e vicina“, ein Titel, der ein Programm darstellte und als Überschrift eines jeden diesjährigen Venedig-Festival-Artikels stehen könnte ...
Gewiß war nicht alles lauteres Gold, was verführerisch glänzte — und je glänzender ein Name dastand, desto mehr enttäuschte er bisweilen sogar; daß eine so kalte, literarisch oberflächlich bemühte, doch leere Verfilmung wie die von Camus' „Der Fremde“ in Venedig gezeigt wurde, mag durch den Namen des Regisseurs begründet sein: daß Lucchino Visconti im venezianischen Reigen nicht fehlen durfte, war genauso verständlich wie die Präsentation von Pier Paolo Pasolinis wunderschön-effektvoll photographierter Filmdeutung von „Edipo Re“, deren zeitlose Gültigkeit in bizarrem Folklorismus unterging (eine Manier, die sich schon in seinem faszinierenden „Menschenfischer“ anbahnte). Daß aber Nanni Loys lärmende und sentimentale italienische Familienschilderung „Der Vater der Familie“ im Rahmen dieses erlesenen Festivals auftauchte, ist ebensowenig entschuldbar wie etwa die Präsentation von Francois Reichenbachs schwülstig-langweiliger Dokumentation „Soy Mexico“, die man mit Freuden für eine Eisenstein-Mexiko-Sequenz eintauscht! Um so unverständlicher bleibt daher, daß Masaki Kobayashis in meisterhaft geometrisch-symmetrischer Büdkomposition gestaltete, von uralter Raumbeherrschung zeugende Samuraiballade „Rebellion“ von der Festivalleitung nicht angenommen wurde und daher in einem anderen Kino am Lido vorgeführt werden mußte — ein „Versehen“, das allerdings durch die Verleihung des Fipresci-Preises an diesen „Außenseiter“ wettgemacht wurde!
Doch über allen positiven und negativen Erscheinungen des Festivals stand ein Film, der mit Recht wie kein zweiter seit langen Jahren den „Goldenen Löwen“ von Venedig zugesprochen bekam, Luis Bunuels Alterswerk und bisher letzter Film „Belle de Jour“ (für Frankreich) — ein so erstaunliches, klares, reines und geschlossenes Werk, daß sicher viele Kritiker (gewohnt, den Meister in Symbolismen und surrealistischen Verzerrungen zu suchen) mit' ihm nichts anzufangen wissen. Ein vollkommen veränderter und neuer Bunuel zeigte sich hier dem Beschauer: Bis in die letzten psychologisch ergründbaren Tiefen der menschlichen Natur tauchend, reißt hier dieser wahrhaft Große der Filmkunst mit ebensolchem Mut wie einfacher und fast schlichter „Erkenntnis“ die Abgründe der Seele auf, schaudererregend und faszinierend zugleich...
Die Krone des Festivals, das ein so erlesenes Programm bot, wie man selten erleben durfte, und den hinreißenden Rahmen lieferte eine Retrospektive, die nicht miterleben zu können den Neid jedes echten Cineasten hervorrufen müßte: Francesco Savio, einer der letzten jener leider immer
mehr aussterbenden Generation von echten Filmhistorikern, übertraf mit seiner Übersicht über den „amerikanischen Wildwestfilm der Stummfllmzeit von 1903 bis 1927“ wohl alles bisher “auf diesem Gebiet Gezeigte; was diese grandiose Zusammenstellung Lehr- und Studienmaterial darstellte, ist nicht durch die Lektüre von unzähligen historischen Fachbüchern (deren Autoren gewöhnlich die Filmgeschichte gar nicht wirklich kennen, sondern nur wieder von anderen Quellen abschreiben) zu ersetzen!
Unfaßbar, was für neue und überraschende Erkenntnisse auftauchen, was für Zusammenhänge zu entdecken sind und welche Folgerungen sie zulassen! Hier wurde so klar wie nie zuvor der Beweis dafür geliefert, daß ohne Kenntnis seiner Geschichte jede Beschäftigung mit einem Medium nur Stückwerk bleiben muß, Dilettantismus, von überheblichen Allroundmanagern ausgeübt... Wohl auch aus diesem Grund sah man nur sehr wenig bekannte Gesichter bei dieser „überflüssigen“ Vorführungsreihe, die durch eine Auswahl von deutschen expressionistischen Stummfilmen — meist nach Drehbüchern von Carl Mayer — abgerundet wurde.
Das Alte und das Neue, eine herrliche Gegenüberstellung und ein wohlüberlegtes Programm, das zu denken geben sollte: Wie weit spannt sich der Bogen der Entwicklung des Films von seinen Anfängen bis zur Gegenwart!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!