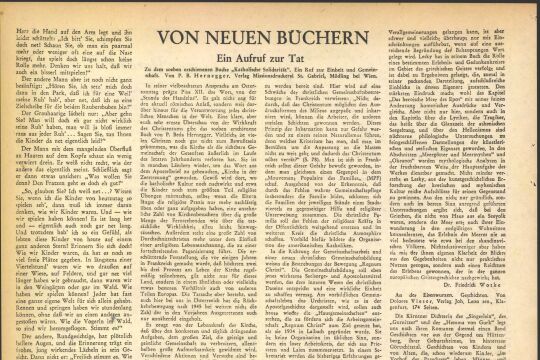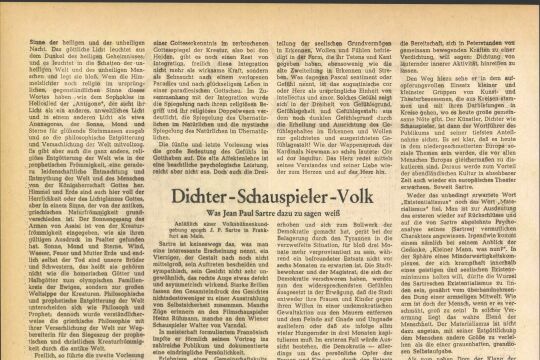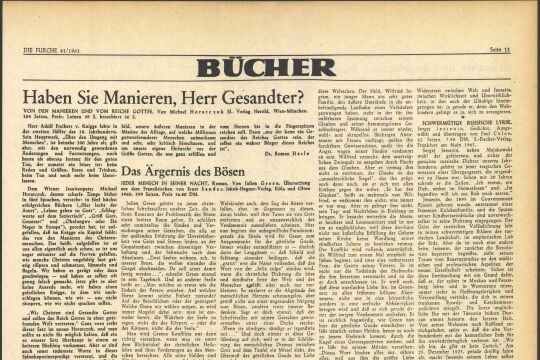Wenn der Sturm tobt, ist das Publikum mittendrin. Auf der Leinwand im Hintergrund toben die Wellen derart gewaltig, dass einem die Unbezwingbarkeit der Natur unmittelbar einleuchtet. Kein Wunder, dass es Schiffbrüchige gibt, die dann wie abgeräumte Traumschiff-Passanten über Prosperos Insel torkeln. Die meiste Zeit jedoch sehen wir eine beruhigte Seelandschaft mit Endlos-Horizont und Wolkenband. Die Natur ist wild und schön, lässt uns Regisseurin Deborah Warner wissen, aber sie ist bei weitem nicht alles. Deshalb wird das Naturereignis von mathematischen Formeln überlagert. Und die bleiben unzweifelhaft Menschenwerk.
Shakespeare misstrauen
So stellt Warner von Anfang an klar, dass sie nicht dem Zauber, dem Übernatürlichen und nicht zu Erklärenden, denen in Shakespeares späten Drama "Der Sturm" so großer Raum zukommen, das letzte Wort überlassen möchte. Sie setzt die Gegenkraft Vernunft in ihr Recht. Der Doppelnatur des Menschen als Wesen aus Natur und kritischem Geist verhilft sie auf der Bühne zu energischen Auftritten. Warner will sich nicht als Elfenbeauftragte des Meisters Shakespeare einspannen lassen, sie holt das Stück in das so merkwürdig zwischen strenger Logik und irrationalem Aberglauben pendelnde 21. Jahrhundert. Es geht um die Physik der Liebe und die wechselnden Witterungsverhältnisse der Politik, die Erotik der Macht und die Mathematik der Gefühle. Sturm und Formeln passen nicht zusammen, sie stehen im übertragenen Sinn für das Menschenmögliche, das eine gemeinsame Herkunft aus Herz und Kopf aufweist. Wir müssen uns Deborah Warner als eine misstrauische Leserin Shakespeares vorstellen, die ihm nicht einfach abkauft, was dieser mit all seiner theatralischen Verführungskunst auf die Bühne seiner Fantasie stellt. Sie mag nicht verhehlen, dass die Psychoanalyse längst erfunden wurde und die Geister, die der Dichter rief, inzwischen aus den wilden Wäldern, Bergen und Gewässern übersiedelt sind in die Tiefen der menschlichen Seele. Gerade in deren Abgründen fühlen sie sich ausgezeichnet aufgehoben.
Romanzen von Shakespeare sind vom Wunsch nach Versöhnung der Gegensätze und nach Bereinigung der Konflikte getragen. Das leuchtet auch Warner ein, die aus dem Stück politisches Kapital schlägt. Prospero ist der exilierte Herrscher, vertrieben von böswilligen Neidern und missgünstigen Intriganten aus den eigenen Reihen.
Auf einer Insel, fernab der Zivilisation, hat er sich sein eigenes Reich geschaffen. Dass er regiert, lässt sich schwer sagen. Er wird betreut von einem Sklaven, einem schroffen Kerl und sorgt sich um seine Tochter Miranda, ein zartes Unschuldskind -ein Gegensatzpaar.
Auf der Insel treffen jene Widersprüche aufeinander, die in der Gesellschaft den Sprengstoff sozialer Konflikte in sich bergen würden. Der ungeschlachte, ungebildete, sich als illoyaler Trotzkopf erweisende Rabauke, der primitive nach Vorteilen gierende Individualrebell Caliban, jeder Verantwortung ledig, steht gegen die sensible Miranda, die Verbindungsagentin des Guten und Schönen. Jens Harzer stellt einen von den edlen Werten einer Zivilisation unberührten Wilden dar, der in Sara Tamburini einen herzensguten, reichlich zappeligen Widerpart findet. Auseinandergehalten werden die beiden von Prospero, dem Peter Simonischek mit einem Rückgrat der Aufrichtigkeit eine gerade Statur verpasst. Er ist der stolze Weise von der Insel, verlotterter Denker und Friedensfreund, der sich am liebsten in seiner Welt der Bücher aufhält. Eigentlich steht er im Bunde mit höheren Mächten, versteht diese nach Belieben zu dirigieren, für Warner keine befriedigende Aussicht auf einen edlen Herrscher. Sie sieht ihn lieber als Stimme der Vernunft, was sie in seinen Monologen voll auskostet. Dann bekommen wir sogar eine Lehre mit auf den Weg. Prospero, der so übel Geschmähte, hält nichts von Rache, er ist ganz auf Vergebung gestimmt. In der Einsamkeit der Insel ist er zum Toleranzidealisten gereift. Und alle, das ist dem Shakespeareschen Romanzen-Konzept der wundersamen Erlösung aus Wirrnis und Verranntheit geschuldet, fügen sich den Einsichten eines eigenwilligen Politphilosophen, der Machiavelli überwunden hat.
Die, die nicht vom Fleck kommen
Man sieht der Inszenierung an, wie sie sich bemüht, den alten Stoff gegenwartsflott zu machen. Deshalb werden die fantastischen Elemente stark zurückgedrängt, um nur ja keine falsche Nähe zu einer Harry-Potter-Wirklichkeit aufkommen zu lassen. Hier handelt es sich um eine ins Befremdliche verschobene Gegenwart, was ja auch für Shakespeare so gegolten haben mag. Eine Seefahrt war das reine Abenteuer, kam einem Aufbruch mit offenem Ausgang gleich. Und Caliban, der Unbezähmbare, steht für den unberechenbaren Ureinwohner Amerikas, über dessen Eigenart den Europäern sagenhafte Nachrichten zugetragen wurden. Er ist der Untugendbold, sein Denken, sein Handeln attackieren die verfeinerten Gepflogenheiten einer Zivilisation, die ohnehin auf brüchigem Boden steht. Wer reiste, konnte etwas erzählen. Deborah Warner erzählt lieber von denen, die nicht vom Fleck kommen, den Inselexistenzen auf ihrem begrenzten Raum. Dort spielen sich die wahren Dramen ab, die Dramen der Erkenntnis und des Reifens, Prozesse einer Vervollkommnung, von denen die abgelenkten Individuen aus den Metropolen nur träumen können.
Die Aufführung auf der Pernerinsel in Hallein, einem wunderbaren Spielort der Salzburger Festspiele, kommt einer Geisteraustreibung gleich. Das Publikum zeigt sich begeistert.
Der Sturm Pernerinsel Hallein, 16., 18., 21. Aug.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!