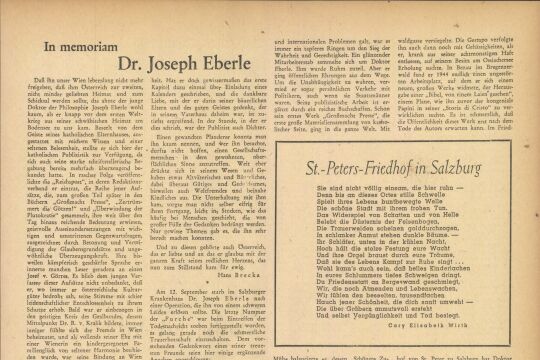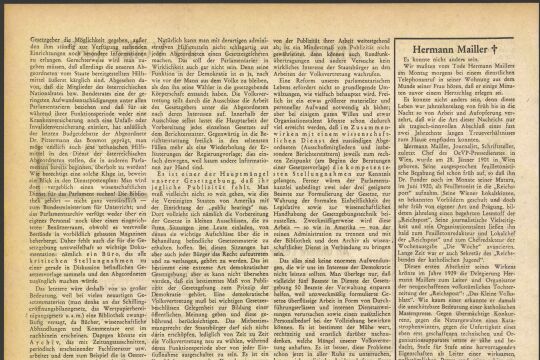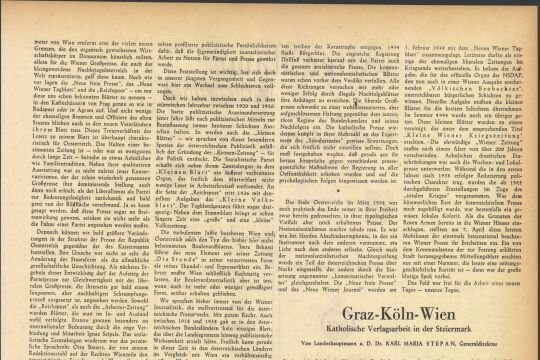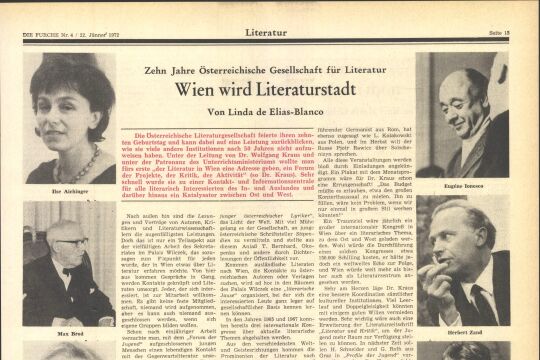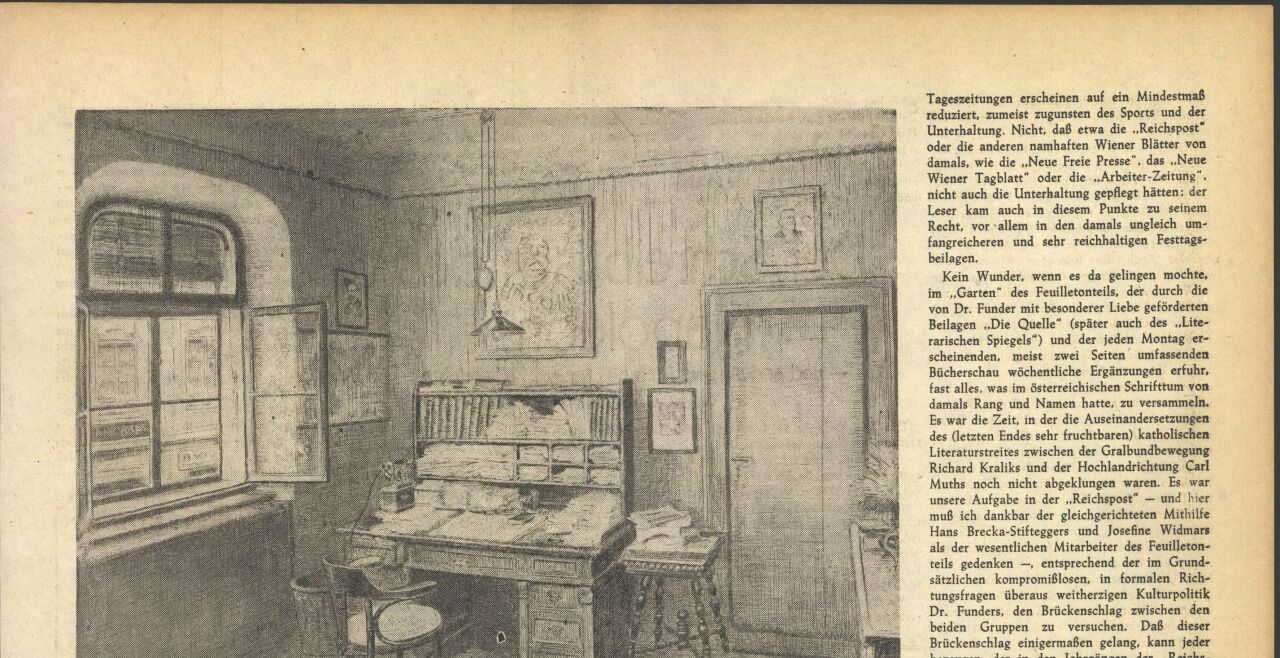
Das Jahrzehnt der „Reichspost“, in dem es mir vergönnt war, im Redaktionsstab Dr. Funders als Leiter des Feuilletonteils, daneben auch in mannigfachen anderen Aufgaben, so zeitweilig als redaktioneller Gestalter der seinerzeit vielgelesenen „Woche“, zu wirken, war bereits von der Unruhe der innen- und außenpolitischen Situation überschattet; gleichwohl darf ich dieses Jahrzehnt als das glücklichste und, wie ich glaube am meisten fruchtbringende eines dreißigjährigen publizistischen Lebens erkennen, sosehr das Ende des Blattes und der Tätigkeit unter dem Damoklesschwert der KZ-Haft ein unnatürliches und gewaltsames gewesen ist und sosehr dieses Ende den zeitweiligen Untergang der eigenen Meinung und damit auch der Werte zu bedeuten schien, deren Pflege unser aller — gern erfüllte — gemeinsame Pflicht gewesen war.
Im Herbst 1928 war ich aus der „Provinz“ gekommen, landschaftlich genommen aus der gleichen, deren Landeshauptstadt die Geburtsheimat Dr. Funders war, aus der Steiermark. Ich hatte fast ein Jahrfünft früher journalistischer Tätigkeit hinter mir. So kam ich, in den Jahren zuvor schon durch Berichterstattung und feuil- letonistische Mitarbeit dem Blatt verbunden, nicht ohne die Voraussetzung des weltanschaulich und erfahrungsgemäß Gemeinsamen zur „Reichspost“, das für eine rasche und ersprießliche Einordnung in neue Arbeitsbereiche nötig ist. Ich muß der außerordentlichen Kollegialität gedenken, die mich von Anbeginn in meiner neuen publizistischen Stellung in der Bundeshauptstadt aufs angenehmste berührte, ln solch erwärmendem Klima war ich zuerst Zimmerkollege unseres Gewerberedakteurs Maximilian Aschinger, den die Wiener als einen ihrer wissendsten und fleißigsten Heimatforscher schätzen durften, dann bald des unvergessenen, um den Wiederaufbau des österreichischen Pressewesens hochverdienten Kollegen Dr. Leopold Husinsky und des späteren Nationalrates Hans Maurer.
Diese dreißiger Jahre waren noch eine Zeit, in der die Wiener Blätter ihren Kulturteil mit Recht als Feuilleton im weiteren Sinn bezeichnen konnten: das Feuilleton in seiner ursprünglichen Form stand noch beherrschend im Vordergrund; s nahm stets das Bedeutendste der Kultursparte auf die Schaufensterfläche „unterm Strich" und pflegte, wenn nichts Gewichtiges an Referaten da war, sein Ureigenstes: die Plauderei, den kleinen Essay, auch den Vorabdruck aus einer bedeutsamen Neuerscheinung der schönen oder der wissenschaftlichen Literatur.
So war man als Kulturredakteur damals, vor den Jahren der Gleichschaltung und „Sprachregelung“, und vor jenen einer allzu raschen und voreiligen Anpassung an westliche Zeitungsformen, noch ein richtiger Feuilleton redakteur im Sinne eines Begriffs, den es heute nur noch bei wenigen Blättern der Tagespresse gibt; denn das Feuilleton der meisten heutigen Zeitungen ist mehr oder minder nur eine bequemere Form des Umbruchs der jeweiligen Kulturnachrichten, oft nur eine Ablagerungsstätte des Aktuellen, gleich, ob es gewichtiger oder nur ein „Füller“ ist; und die Zahl der dichterischen und essayistischen Beiträge in den anderen Rubriken und in den Beilagen der
Tageszeitungen erscheinen auf ein Mindestmaß reduziert, zumeist zugunsten des Sports und der Unterhaltung. Nicht, daß etwa die „Reichspost“ oder die anderen namhaften Wiener Blätter von damals, wie die „Neue Freie Presse“, das „Neue Wiener Tagblatt" oder die „Arbeiter-Zeitung", nicht auch die Unterhaltung gepflegt hätten; der Leser kam auch in diesem Punkte zu seinem Recht, vor - allem in den damals ungleich umfangreicheren und sehr reichhaltigen Festtagsbeilagen.
Kein Wunder, wenn es da gelingen mochte, im „Garten“ des Feuilletonteils, der durch die von Dr. Funder mit besonderer Liebe geförderten Beilagen „Die Quelle“ (später auch des „Literarischen Spiegels“) und der jeden Montag erscheinenden, meist zwei Seiten umfassenden Bücherschau wöchentliche Ergänzungen erfuhr, fast alles, was im österreichischen Schrifttum von damals Rang und Namen hatte, zu versammeln. Es war die Zeit, in der die Auseinandersetzungen des (letzten Endes sehr fruchtbaren) katholischen Literaturstreites zwischen der Gralbundbewegung Richard Kraliks und der Hochlandrichtung Carl Muths noch nicht abgeklungen waren. Es war unsere Aufgabe in der „Reichspost" — und hier muß ich dankbar der gleichgerichteten Mithilfe Hans Brecka-Stifteggers und Josefine Widmars als der wesentlichen Mitarbeiter des Feuilletonteils gedenken —, entsprechend der im Grundsätzlichen kompromißlosen, in formalen Richtungsfragen überaus weitherzigen Kulturpolitik Dr. Funders, den Brückenschlag zwischen den beiden Gruppen zu versuchen. Daß dieser Brückenschlag einigermaßen gelang, kann jeder bezeugen, der in den Jahrgängen der „Reichspost“ blättert: in ihren Spalten waren mit temperamentvollen Meinungsäußerungen, aber auch mit friedlich-schiedlichen Beiträgen ebenso Richard Kralik, Josef August Lux und Pater Adolf Innerkofler vertreten wie die Handel-Maz- zetti, Peter Dörfler und Franz Herwig, um einige der großen Vertreter des neuen katholischen Realismus in der Erzählungskunst zu nennen, es fanden aber auch die bedeutendsten Autoren aus dem „nationalen" Lager, soweit sie nicht durch ein parteipolitisches Bekenntnis regelmäßige Mitarbeiter anderer Blätter, wie der „Wiener Neuesten Nachrichten“ oder der „Deutschösterreichischen Tageszeitung“, waren, hier eine Heimstätte: Josef Friedrich Perkonig, Maria Grengg und Robert Hohlbaum, um nur einige der bekanntesten zu vermerken.
Die bald gewonnene persönliche Verbindung mit der „Leostube“ erleichterte diesen Brückenschlag; hier, in diesem Kreis um den priester- lichen Dichter Heinrich Suso Waldeck, der die meisten seiner humorvollen Geschichten für das Feuilleton der „Reichspost“ geschrieben, und viele seiner schönsten Gedichte zuerst in unserem Blatt veröffentlicht hat, ergab sich ein reiches Sammelbecken von literarischen und künstlerischen Begabungen, die ans Licht drängten und dann über die „Reichspost“ den Weg in die Oeffentlichkeit gegangen sind. Rudolf Henz vor allem und Friedrich Schreyvogl, Josef Neumair, Paula von Preradovic und Paul Graf Thun- Hohenstein, Erika Mitterer, Fanny Wibmer-Pedit, Ernst Scheibeireiter und Siegfried Freiberg, Oda Schneider und Gertrud Herzog-Hauser, Karl Borromäus Frank und Ferdinand Mayer-Eschen- bacher. Auch die bildenden Künstler und Musiker dieses Kreises sind auf diesem Wege zu Wort gekommen oder haben durch die zuständigen Referenten eine erste Würdigung erfahren: André Roder und Carry Hauser, Josef Lechthaler und Franz Krieg. Viele der Autoren aus den Bundesländern haben gleich wie die jungen Wiener Arbeiterdichter von damals ihre ersten Schritte in die Oeffentlichkeit der Bundeshauptstadt über den Feuilletonteil der „Reichspost" getan: die Vorarlberger Adalbert Welte und Eugen Andergassen, die Salzburger Karl Heinrich Waggerl, Georg Rendl und Franz Brau- mann, die Niederösterreicher Wilhelm Franke, Friedrich Sacher und Franz Tinhofer, die Kärntner Dolores Viesér, Guido Zernatto und Herbert Strutz — der durch eine Anzahl von Jahren sodann ebenso wie Otto Th. Brandt auch ein wertvoller literarkritischer Mitarbeiter gewesen ist —, aus der Steiermark Paula Grogger und Hans Haidenbauer, um von den Tirolern Josef Georg Oberkofler und Josef Leitgeb oder dem in Linz seßhaft gewordenen Untersteirer Julius Zerzer nicht zu reden, die bald mit ihren Beiträgen das von Max Mell, Franz Nabl, Richard Schaukal, Felix Braun und anderen hervorragenden Dichtern der älteren Generation geprägte Bild der literarischen Vielfalt mitgestaltet haben.
Es fehlt an Raum, die große Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter von Rang zu nennen, die gemeinsam mit den Vertretern der zeitgenössischen Literatur mit dazu beigetragen haben, die „Reichspost“ zu einem Organ von weitreichender Bedeutung zu machen. Die seriöse Kritik in allen Sparten war durch eine Reihe von Persönlichkeiten gewährleistet, die den Referaten unseren Blattes nicht nur im eigenen Leserkreis Gewicht und Geltung gaben; durch unseren Redaktionskollegen und Burgtheaterreferenten Hans Brecka-Stiftegger ebenso wi in der großen Zeit der Wiener Operette durch Otto Howorka, dann durch Viktor TrautzL Anselm Weißenhofer, Max Springer, Andrea Weißenbäck, Otto Repp und Roland Tenschert. Es sind so manche in diesen Jahren im Herold- Haus in der Strozzigasse aus- und eingegangen, die nicht mehr am Leben sind, denen man aber einen Kranz der Erinnerung flechten müßte, weil ihr referierendes Tagwerk mehr als nur für den Tag geschrieben war.
Ohne diesen weiträumigen Hintergrund publizistischer Möglichkeiten wäre die Aufgabe, die mir durch die Wahl zum Obmann des Verbandes der katholischen Schriftsteller in diesen Jahren gestellt wurde, wohl kaum zu erfüllen gewr-n: die organisatorische Sammlung der Kräfte des katholischen Schrifttums auf breitester Basi fortzusetzen und dem Verband auch die Repräsentanten der älteren Generation als aktiv Mitglieder zuzuführen: es seien hier nur Hans von Hammerstein, Richard von Schaukal und Franz Karl Ginzkey genannt. Die Beziehungen zur deutschsprachigen Literatur des Auslandes konnten sowohl über die „Reichspost" wie über den ein halbes tausend Mitglieder zählenden Verband in diesen dreißiger Jahren eine erfreuliche Intensivierung erfahren: Gertrud von Le Fort, Leo Weismantel, Ernst Thrasolt, Johannes Kirschweng und Maurus Carnot waren Mitarbeiter und wurden mit ihren Dichtungen und ihren Büchern der Leserschaft, über den Rundfunk auch der österreichischen Hörerschaft vorgestellt.
Doch zurück zur lichten Redaktionsstube im Herold-Haus: hier hat so mancher der Schaffenden in diesen Jahren der politischen und wirtschaftlichen Nöte — wie gering erschienen sie dem Zurückblickenden in der Zeit der unerbittlichen Härte, die nun folgte — vor dem Schreibtisch des Feuilletonredakteurs sein Bündel Sorgen abgeladen. Die Möglichkeit der Hilfe war bescheiden, sie war aber um vieles größer als in einer Redaktion von heute. Der Raum der Mitarbeit der schöpferischen Kräfte in den Tageszeitungen ist eingeschränkt, die Honorare haben zudem nicht Schritt gehalten mit den Lebenskosten. Im Rückblick eines Feuilletonredakteurs muß auch dies vermerkt werden, gerade angesichts des lebendigen Feuilletons der österreichischen Zeitungen von einst: die echten Feuilletonschreiber sterben aus, nicht weil es keine Leute mehr gäbe, die ein Feuilleton zu schreiben verstehen, sondern weil es bald keine Zeitungen mehr gibt, die ein Feuilleton brauchen. Das Gewicht der schöngeistigen und wissenschaftlichen Publizität hat sich auf die wenigen Zeitschriften verlagert, unter denen die „Oester- reichische Furche", als eine Nachfolgerin und Fortsetzerin des Feuilleton- und Beilagen teils der „Reichspost“, jene Stellung einnimmt und hält, die durch Jahrzehnte das führende Organ der österreichischen Katholiken eingenommen hat: als Zitadelle eines Geistes, der seine Kraft aus dem religiösen Leben nimmt, als Lichtquelle, die weithin die Landschaft des Zeitgeschehens erhellt.