
„West Side Story“ an der Volksoper: Wo das Musical wirbelt
Nach Leonard Bernsteins „Candide“ im MuseumsQuartier nun eine neue „West Side Story“ an der Volksoper: Sie setzt unter dem neuen Musikchef Ben Glassberg die Musicaltradition dieses Hauses erfolgreich fort.
Nach Leonard Bernsteins „Candide“ im MuseumsQuartier nun eine neue „West Side Story“ an der Volksoper: Sie setzt unter dem neuen Musikchef Ben Glassberg die Musicaltradition dieses Hauses erfolgreich fort.
Was hat der große Dirigent Wilhelm Furtwängler mit dem Musical an der Wiener Volksoper zu tun? Bei seinem Begräbnis 1954 in Heidelberg überraschte Ernst Marboe, der damalige Leiter der Österreichischen Bundestheaterverwaltung, Marcel Prawy mit der Absicht, ihn als Direktor der Wiener Volksoper vorzuschlagen. Daraus wurde zwar nichts, stattdessen wurde Prawy aber zum Chefdramaturgen berufen. In dieser Funktion etablierte der spätere „Opernführer der Nation“ dort gegen heftigen Widerstand das Musical. Dieses ist seither von der Wiener Volksoper nicht mehr wegzudenken. Sie wurde damit zur Wegbereiterin für die Erfolgsgeschichte dieses Genres auch an anderen österreichischen Bühnen.
Nur knappe sechs Wochen blieb an der Volksoper damals Zeit für die erste Musicalproduktion, Cole Porters „Kiss me, Kate“. Eine Brücke zwischen Amerika und Österreich zu schlagen, hatte sich Prawy mit seiner neuen Aufgabe vorgenommen. Das traf sich mit Marboes Wunsch, die Wiener Volksoper zu einem „Bayreuth der leichten Muse“ zu machen. Schon bei Porter setzte der neue Chefdramaturg auf eine Mischung österreichischer und amerikanischer Interpreten. Er engagierte den beliebten wie prominenten Wiener Burgmimen Fred Liewehr als Petruchio und die US-Amerikanerin Olive Moorefield, die bald zu einem der großen Wiener Publikumslieblinge avancieren sollte, für die Rolle der Bianca. Die Premiere am 14. Februar 1956 wurde ein Triumph. Insgesamt 183 Mal stand die Produktion auf dem Spielplan.
Was sollte danach kommen? Die Köpfe rauchten, eine Ausschreibung für ein österreichisches Musical brachte kein brauchbares Ergebnis. Da warf AmerikaKenner Ernst Marboe den Namen Leonard Bernstein in die Diskussion. Schon war das nächste Musical an der Volksoper gefunden: „Wonderful Town“. Es wurde nicht so gefeiert wie „Kiss me, Kate“. Das rief einige auf den Plan, das Musical wieder aus der Wiener Volksoper zu verbannen. Daraus wurde nichts. Bereits 1965 landete man mit „Porgy and Bess“ einen Renner der Sonderklasse. Drei Jahre später folgte die europäische Erstaufführung von Bernsteins „West Side Story“, seinem bis heute populärsten, weltweit am meisten gefeierten Bühnenwerk.
Mit Neugier erwartet
Fast hätte Marcel Prawy den Komponisten überreden können, sein Werk selbst zu dirigieren. Das ist ihm zwar nicht gelungen, den Erfolg der Serie – an die hundert Aufführungen – beeinträchtigte das nicht. Im März 1968, während seiner Proben für eine Neuproduktion des „Rosenkavalier“ an der Staatsoper, besuchte Bernstein eine Aufführung dieser „West Side Story“- Produktion. In einem dunkelblauen Anzug, aber ohne Krawatte, wie man in den Zeitungen lesen konnte.
Leonard Bernsteins „West Side Story“ und die Wiener Volksoper sind, selbst wenn sich die Programmpalette des Hauses in den vergangenen Jahrzehnten dank unterschiedlicher Direktoren gewandelt und verändert hat, längst zu einem Synonym geworden. Jede Neuinterpretation dieses Stücks erweckt daher eine dementsprechend große Neugier. So auch die jüngste, die seit dem Wochenende gespielt wird.
Dass dieses Mal das Interesse vorrangig dem Dirigenten galt, liegt auf der Hand: Am Pult stand der seit Jahresbeginn amtierende neue Chefdirigent, der 29-jährige Londoner Ben Glassberg. Sein Traum war es schon immer, diesen Bernstein zu dirigieren. Am Währinger Gürtel realisiert er ihn mit mehr als den üblichen Streichern, um damit einen noch opulenteren Klang zu erzielen: nämlich mit 25, anstelle der gewohnten zwölf. Das kommt dem Sound durchaus zugute. Dennoch könnte er sich zuweilen mehr Zeit nehmen, müsste er nicht in einer solchen Wirbelwindmanier durch die Partitur stürmen. Oder wollte er mit dieser, von geradezu ungebändigtem Elan bestimmten Lesart zeigen, dass das Volksopernorchester imstande ist, sich dieser Herausforderung auch mit ungewohnt zügigen Tempi virtuos zu stellen? Trotzdem klappt die Koordination zwischen Orchestergraben und Bühne vorzüglich. Die auch schauspielerisch gut geführten Sängerinnen und Sänger scheinen sich unter dem neuen Musikchef bestens aufgehoben zu fühlen.
Warum allerdings stetig zwischen Gesangsenglisch und Dialogdeutsch – die deutsche Dialogübersetzung stammt, selbstverständlich, von Marcel Prawy – geswitcht wird, erschließt sich nicht. Das stiftet bloß Verwirrung. Alles im englischen Original, dazu deutsche Übertitel – warum hat man sich nicht auf diese hier doch so naheliegende Lösung verständigt?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!







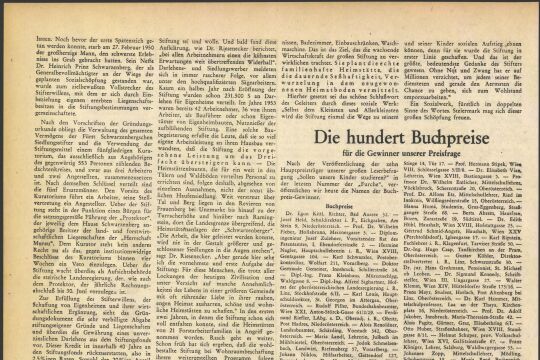





















































































_edit.jpg)






