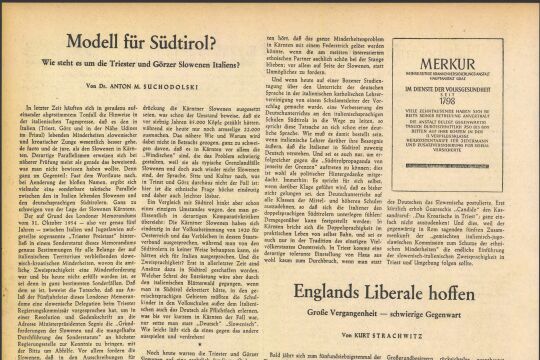Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Auf schwankendem Boden
Zwei wesentliche Merkmale kennzeichnen derzeit die innenpolitische Lage in Frankreich: die Einsamkeit des Staatspräsidenten Francois Mitterrand und die Ratlosigkeit der verschiedenen Parteien.
Zwei wesentliche Merkmale kennzeichnen derzeit die innenpolitische Lage in Frankreich: die Einsamkeit des Staatspräsidenten Francois Mitterrand und die Ratlosigkeit der verschiedenen Parteien.
Frankreich gefällt sich augenblicklich im innenpolitischen Narzißmus. Die Medien berichten zwar weiterhin recht ausführlich über das internationale Geschehen, mit besonderem Interesse für die amerikanische Präsidentenwahl und die innerdeutschen Beziehungen; die Regierung vernachlässigt ihrerseits keineswegs die besorgniserregende Europapolitik.
Die Parteien - nach einer Formel des ehemaligen Premierministers Raymond Barre der politische Mikrokosmos—befassen sich jedoch ziemlich ausschließlich mit ausgeklügelten taktischen Manövern, die die Position von
Präsident Mitterrand entweder stärken oder schwächen sollen.
Als Francois Mitterrand gewählt wurde, besaß er eine solide Hausmacht. Sozialisten und Kommunisten betrachteten es als ihre selbstverständliche Pflicht, ihn zu unterstützen. Verhältnismäßig schnell rollten die Kommunisten, halb freiwillig, halb gezwungen, auf ein Nebengeleise.
Auf die Sozialisten konnte sich der Präsident aber weiterhin verlassen. Es wurde ihm sogar häufig vorgeworfen, im Gegensatz zum Geist der Verfassung der Fünften Republik zu sehr der Exponent seiner Partei zu sein und ihr zu gestatten, sich in seinen Entschei-dungsprozeß maßgebend einzumischen.
Nach und nach unterlag er jedoch der Verlockung der präsidialen Allmacht, während er gleichzeitig versuchte, nicht nur der Präsident einer Koalition, sondern aller Franzosen zu sein. Seine Aussprachen mit der Führung seiner Partei verloren ihren beratenden Charakter und dienten nach einer konsultativen Ubergangsperiode schließlich nur noch der Information über seine Beschlüsse.
Diese Einsamkeit, verbunden mit einer immer deutlicher werdenden Selbstherrlichkeit, wurde Mitterrand nicht nur durch sein Temperament, sondern auch durch die Realitäten aufgezwungen, die sich der Verwirklichung seines sozialistischen Wahlprogramms widersetzten.
Die sozialistische Partei mußte diese Haltung des Präsidenten in eine Krise führen. Ihr Schicksal bleibt natürlich entscheidend bedingt durch den Erfolg oder den Fehlschlag Mitterrands. Die Führung steht vor der schwierigen Aufgabe, den aktiven Mitgliedern, von denen sie abhängt, einen Kurswechsel verständlich zu machen, den sie nicht erwartet hatten und der ihren Vorstellungen völlig zuwiderläuft.
Für das Parteivolk war die Linksunion mit den Kommunisten mehr als ein taktisches Manöver. Es hat daran geglaubt. Nur Phantasten mögen noch hoffen,' daß sich die Kluft zwischen Mitterrand und den Kommunisten wieder überbrücken läßt.
Selbst wenn es den Sozialisten gelingt, den jetzigen Tiefstand zu überwinden, besitzen sie nicht mehr die geringste Aussicht, die Regierungspolitik maßgebend zu bestimmen. Die Verantwortlichen der Partei sind hellsichtig genug, um zu wissen, daß Mitterrand nach der nächsten Parlamentswahl 1986 auf das Bündnis mit einem Teil der bürgerlichen Parteien angewiesen sein wird, wenn er nicht zurücktreten will.
Den Sozialisten droht daher der Verlust ihrer Identität, den sie schon einmal mit dem Niedergang bezahlen mußten: als sie nämlich in der Vierten Republik nicht nur mit der linken, sondern auch mit der rechten Mitte die Verantwortung für eine Politik übernahmen, die von ihren theoretischen Idealen weit entfernt war. Es müßte fast ein Wunder geschehen, damit es der Parteiführung gelänge, eine Demobilisierung der Mitglieder zu verhindern.
Die Kommunisten sind nicht glücklicher. Die Linksunion war für sie der Ausweg aus einem Getto und verband sich für sie mit der Auflockerung einer als nicht mehr zeitgemäß anerkannten Ideologie. Bei den militanten Mitgliedern stieß dieses Experiment stets auf Mißtrauen. Sein Fehlschlag gibt seinen Gegnern recht.
Nur darf sich die Partei von einer Rückkehr zu ihrem traditionellen, revolutionären Kurs nicht viel versprechen. Ihr Stimmenverlust ist in nicht geringem Maße eine Folge grundlegender Veränderungen der französischen Gesellschaftsstruktur. Eine mit der Sowjetunion verbundene marxistisch-leninistische Partei ist im heutigen Frankreich zum Anachronismus geworden.
Um sich einigermaßen zu behaupten, muß sie die Ideologie in den Hintergrund drängen und für ihre Zwecke die jeweilige Sozialkonjunktur ausbeuten. Sie würde jetzt gerne gegen Mitterrand Sturm laufen, aber ihre oppositionellen Parolen finden vorläufig innerhalb der Arbeiterschaft nur geringes Echo.
Die Parteiführung übersieht nicht das Mißverhältnis zwischen höchstens 100.000 militanten Mitgliedern und den Motivationen ihrer bisherigen vier Millionen Wähler, noch das zweite Mißverhältnis zwischen der kleinen Minderheit kommunistisch geschulter Gewerkschaftsfunktionäre und der insgesamt nur etwa zu einem Viertel gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer.
Auf Seiten der Opposition sind lediglich die Gaullisten ziemlich problemlos. Sie verfügen über einen soliden Apparat. Ihr Ziel ist die Rückkehr zur Macht. Sie kennen weder Rivalitäten noch Führungskämpfe, sondern stehen geschlossen hinter ihrem Präsidenten Jacques Chirac, dessen Person allerdings weitgehend das Programm ersetzt oder zumindest in den Hintergrund treten läßt.
Hierin liegt aber auch ihre Schwäche, zumal es in der gaullistischen Bewegung stets einen nach links blickenden und einen konservativen Flügel gab. Nicht einfach ist ferner die Abstimmung mit den notwendigen Partnern, denn trotz ihrer Dynamik vermögen die Gaullisten die Macht nicht allein zu erobern.
Die Union für die Französische Demokratie UDF ist mehr denn je ein Sammelbecken ohne innere Harmonie. Ihr politischer Regenbogen erstreckt sich von der christlich-sozialen Doktrin bis zu einem Liberalismus, der die Grenze des Reaktionären erreicht.
Um die Gunst der UDF bewerben sich sowohl Giscard d'Estaing wie Raymond Barre. Hierzu kommt als Außenseiter der ehrgeizige Generalsekretär des konservativen Flügels Leotard. Diese Rivalitäten sind natürlich der politischen Glaubwürdigkeit nicht dienlich.
Dazu kommt als letzte Hypothek die Nationale Front des rechtsextremen Jean-Marie Le Pen. Sie ist ohne Zweifel eine Gefahr für die Demokratie, gleichzeitig aber auch ein politischer Faktor, den niemand vernachlässigen will und der daher zu taktischen Stellungnahmen zwingt.
Mitterrand spielt mit dem Gedanken, sich seiner zur Schwächung der Opposition zu bedienen, während jene vor der unmöglichen Aufgabe steht, zu ermitteln, ob ihr Le Pen in Zukunft noch mehr Stimmen wegnimmt oder ob ihn die gemäßigten und lediglich vorübergehend stark verärgerten Wähler wieder verlassen.
Neuerdings überwiegt die Tendenz, der Nationalen Front die Beteiligung an der Verantwortung nicht zu verweigern und ihr eine gewisse Kooperation anzubieten. Dies wird mit der doppelten Hoffnung begründet, die Bewegung zu entradikalisieren und ihren bisherigen Wählern verständlich zu machen, daß sie das gleiche Ziel erreichen können, wenn sie wieder für die traditionellen Parteiert stimmen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!