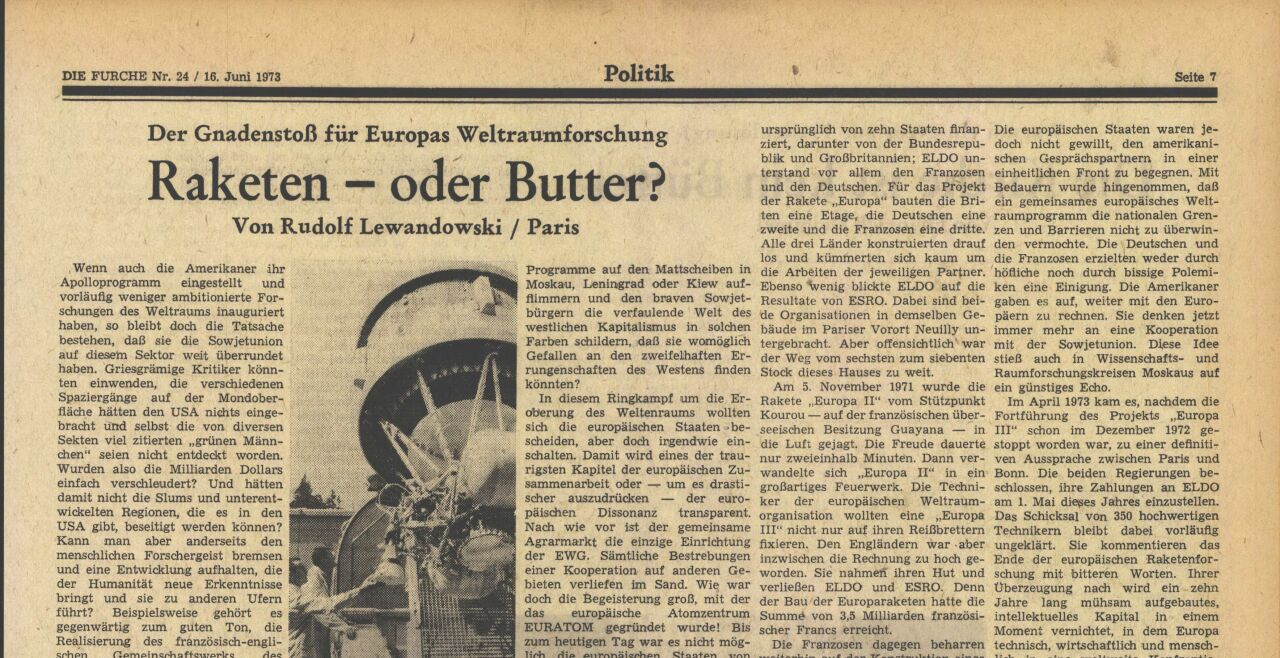
Gedämpftes Licht, folkloristische Musik, Festreden und Nationalhymnen; nur der Gumpoldskirchner in den Gläsern ließ darauf schließen, daß diese schweizerische Nationalfeier in Wien stattfand. Es war am 1. August 1949, und vom Cobenzl aus hatte man einen prächtigen Rundblick über die Stadt. Eben hatte Ingenieur Tscherflnger, der Präsident des Schweizervereins, die alten Eidgenossen hochleben lassen, als der damalige Wiener Bürgermeister Theodor Körner das Wort ergriff und Freunde und Diplomaten in Verlegenheit brachte: „Wir feiern den
Jahrestag jener Tat, die die Österreicher leider erst einige Jahrhunderte später setzten. Ich meine die Vertreibung der Habsburger...“
Körners Bemerkung wurde allseits als Taktlosigkeit empfunden. Inzwischen weiß man, daß sie überdies auch noch falsch war, denn soeben hat ein schweizerischer Historiker die Begleitumstände des sogenannten Rütli-Schwures vom Jahre 1291 dn einem neuen Licht dargestellt. Professor Marcel Beck zerzauste die alte Legende in einer wissenschaftlich fundierten Fernsehsendung, und so ist aus dem angeblichen Frei-heitsdurst und Heldentum des Jahres 1291 nur noch ein Bedürfnis nach Selbstschutz geworden.
„Eines steht jedenfalls fest: König Rudolf I. von Habsburg war den Innerschweizern schon vor seiner Thronbesteigung im Jahre 1273 gewogen“, stellte Professor Beck fest, und er ist überzeugt, daß Rudolf auch als König in den sogenannten Waldstätten beliebt geblieben war, hatte er doch den gesamten Einwohnern von Schwyz zugestanden, „daß sie nur von ihm, seinen Söhnen oder von den Richtern des Tales belangt werden sollten“. Am 15. Juli 1291 aber starb König Rudolf, und nun herrschte große politische Unsicherheit. Niemand konnte voraussagen, ob die Kurfürsten sich wirklich auf einen einzigen König einigen würden. Ohne diese Einigkeit aber mußte man neue Unruhen befürchten, und die Innerschweiz erinnerte sich noch allzu gut an die Zeit vor Rudolf, als Fehden, Mord und Totschlag im Lande herrschten. „Um solchen Gefahren zu begegnen“, sagte Professor Beck, „schlössen die Leute der drei Täler am 1. August 1291 ihren berühmt gewordenen Bund. Er sollte den Landfrieden aus eigener Kraft sichern und einen freien Gerichtsstand erhalten, letzteres sicher in Anlehnung an ein Privileg, das Schwyz am 19. Februar 1291 noch von König Rudolf erhalten hatte und
das unter anderem verfügte: „Unsere Hoheit hält es für unangebracht, daß irgend jemand unfreier Herkunft Euch zum Richter gesetzt werde.“
Es gibt wohl kaum eine schweizerische Schulklasse, die nicht im Laufe der Jahre einmal an „die Wiege der Heimat“, das Rüth, gepilgert wäre, wo der erhabene Eid geleistet wurde. Geschichtliche Studien lassen nun allerdings auch daran zweifeln, ob der Rütli-Schwur überhaupt auf dem Rüth stattgefunden habe. Die alte Chronik vom Jahre 1470, das sogenannte „Weiße Buch von Samen“, nennt auf jeden Fall einen anderen Ort. Auch Professor Beck kann diese Frage noch nicht eindeutig beantwor-worten, hingegen sagte er unmißverständlich: „Gesichert aber ist die Tatsache, daß der Bund keine Revolution, keine Auflehnung gegen Habsburg war. Er war Selbstschutz gegen die Schwierigkeiten einer möglicherweise bevorstehenden königlosen Zeit oder einer Doppelwahl.“
Die königlose Zeit aber dauerte nicht lange. Am 5. Mai 1292 hatte das Reich in der Person von Adolf von Nassau wieder einen unbestrittenen Herrscher erhalten. Die alten Rechte, Ruhe und Ordnung und Frieden waren gesichert, was nach Professor Beck eine verständliche Folge hatte: „Der Bundesbrief von 1291 verlor seine Bedeutung und wurde vergessen. Die Originale von Uri und Unterwaiden gingen verloren. Nur in Schwyz blieb er erhalten, war aber dort bis 1760 sozusagen unbekannt. Auch die gesamte mittelalterliche Chronistik erwähnt ihn nicht. Erst die neueste Zeit hat aus ihm eine Reliquie gemacht.“
Für viele Patrioten, vielleicht auch solche, die bei jener denkwürdigen Augustfeier auf dem Cobenzl anwesend waren, ist eine Welt zusammengebrochen. Denn schließlich geht es ja nicht nur um den Rütli-Schwur als solchen, sondern auch um all das, was sich später, dem geltenden Geschichtsbild entsprechend, darauf aufgebaut hat. Zum Beispiel die berühmte Schlacht von Morgarten vom Jahre 1315, in der — so hieß es in Tausenden von vaterländischen Reden — „das Bündnis von 1291 mit Blut besiegelt wurde“.
Professor Beck hat auch für Morgarten eine Erklärung. Am Fuße der Mythen herrschte Landmangel, was das Volk in einen Gegensatz zum landreichen Kloster Einsiedeln brachte. Am 6. Jänner 1314 schließlich -überfielen • die | Schwyaer .die Abtei und plünderten sie völlig aus. Dies rief die Habsburger auf den Plan, da sie seit 1283 als Vögte Ein-siedelns zum Eingreifen verpflichtet waren. Diesmal kam ihnen die Aktion aber besonders gelegen. Der Habsburger Friedrich der Schöne war nämlich 1314 nur von einem Teil der Kurfürsten zum deutschen König gewählt worden. Ludwig der Bayer hatte als Gegenspieler ebenso große kurfürstliche Unterstützung erhalten, und die Eidgenossen hatten sich aus Bauernschlauheit ebenfalls für Ludwig entschieden. So konnten die Habsburger nun eine Strafexpedition mit einer politischen Aktion verbinden, doch die Schwyzer und ihre Verwandten aus Uri und Unterwaiden konnten das eher konventionell ausgerüstete und vom Königsbruder Herzog Leopold von Österreich angeführte Ritterheer dank ihrer überlegenen Infanterietaktik vernichtend schlagen. Professor Beck kam zum Schluß: „Morgarten war also primär nicht die gemeinsame Verteidigung der bedrohten Freiheit, sondern der für Schwyz glückliche Höhepunkt einer langen Auseinandersetzung mit Einsiedeln, in der es keineswegs ohne Fehl und Tadel dastand. In unserem Zusammenhang sind deshalb der rein lokale Konflikt zwischen Einsiedeln und Schwyz und seine Ursachen wichtiger als die Bedeutung, die Morgarten später als erster Befreiungskrieg erhielt.“
Der kritische Historiker Marcel Beck brachte die Anfänge der Eidgenossenschaft nicht mit einem schwülstig-theatralischen Akt, sondern vielmehr mit der allgemeinen Entwicklung in Zusammenhang. Der Sonderfall Schweiz sei nur deshalb entstanden, weil im Spätmittelalter rings um die dreizehnörtige Eidgenossenschaft fürstliche Gewalt wieder die Oberhand gewonnen habe.
Der überzeugte Europäer Marcel Beck aber unterstrich:,, Doch wir sind, auch in unserer geschichtlichen Entwicklung, stets ein Teil Europas gewesen. Vom historischen Standpunkt aus wäre daher eine Integration in ein republikanisches Europa letztlich begründet. Das Rüth kann und darf uns auf dam langen Marsch zu einem vereinigten Europa nicht im Wege stehen.“
