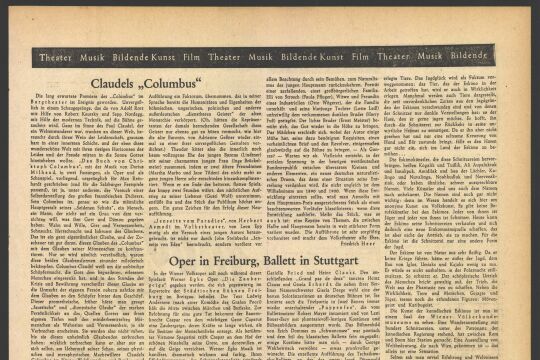Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zerbrechliche Welt
„Spiel der Erinnerung“ nennt Tennessee Williams seine amerikanische Elegie „Glasmenagerie“. Es ist Tom, der Sohn (in dem der Dichter selber auftritt), der hier als Ansager und Betroffener verklärenden Rückblick hält auf die Jahre der Jugend, seine Flucht aus der Enge der mütterlichen Wohnung in die Ferne der farbigen Abenteuer. Es geschieht so gut wie nichts in diesem Stück, und es kann auch gar nichts geschehen. Mutter, Sohn und Tochter sind eingesponnen in ihre Träume; denn die Zeit ist ihnen abhanden gekommen, wie sie der Zeit abhanden gekommen sind. Höchste Steigerung ist nicht ein dramatischer Konflikt, sondern jener lyrische Dialog, da die scheue, zerbrechliche Laura mit Jim, dem Gast, auf dem Boden hockt und in ihm die Verwirklichung ihrer Mädchenträume zu erblicken glaubt, so daß es den smarten, nüchternen Burschen für einen Augenblick in die Verzauberung ihrer Liebe hineinreißt. Da leuchtet der Glanz echter Poesie um den Alltag amerikanischer Kleinbürger. Die drei bewegen sich wie im Wachtraum, und wie ein Traumspiel, zart und unheimlich, sollte dieses Stück auch inszeniert werden. Bei Williams waltet das Gegenteil von Desillusionie-rung des Theaters. Er verzaubert die Realität, um der eigentlichen Wirklichkeit nahezukommen.
Die Aufführung im Akademietheater unter der Regie von Willi Schmidt war streckenweise zu realistisch, zu stofflich, zu wenig entmaterialisert. Kaum je, daß die hauchzarten Märchenfiguren aus Lauras weltentrückter Glasmenagerie ins Spiel kamen. Paula Wessely schwelgte als Amanda Wingfield (die eigentliche Zentralfigur des Stückes) in sentimentalen Erinnerungen an die Vergangenheit, war grausam geschwätzig und zärtlich-betulich. Was ihr aber völlig fehlte, war eine gewisse morbide Schrulligkeit. Es ging von ihr nicht der Eindruck einer im Innersten gestörten Kraft aus. Herb, verhalten und rührend (von der Regie nur manchmal zu sehr gedämpft) wirkte Annemarie Düringer als das verkrüppelte Mädchen Laura. Eindringlich und impulsiv spielte Helmut Griem den Sohn, den heimlichen Dichter mit der Fernsehnsucht, und Ernst Anders gab mit unbekümmerter und sympathischer Gutmütigkeit den Jim. Bühnenbild und Kostüme entwarf der Regisseur. Es gab starken Beifall für Stück und Darsteller. *
Das Programmheft des Theaters in der Josefstadt ist angefüllt mit historischen Texten und Bildern zu dem Schauspiel „Themas Morus“ des Engländers Robert,; Bolt (Jahrgang 1925). Der Politiker und Humanist Sir Thomas More ist der Held, Heinrich VIII. sein Gegenspieler. Zwar wählte der Autor die Form des üblichen Bilderbogens (2 Akte in 15 Bildern), in denen er uns das Schicksal des Thomas More vorführt, der sich weigerte, die Scheidung des Königs von Katharina von Aragon, den Bruch mit Rom und die Gründung der anglikanischen Hochkirche gutzuheißen und dafür am Ende seinen Kopf verwirkte. Aber es wurde trotzdem kein historisches Kolossalgemälde mit überladenem Zeitkolorit daraus. Geradlinig und unabänderlich vollzieht sich das Märtyrerschicksal, die Tragödie dessen, der um nichts in der Welt gegen sein Gewissen handelt. Es gibt kaum eine überraschende Handlung in dem Stück, dessen Stärke in der intellektuellen Gespanntheit der Dialoge liegt, die freilich gegen Schluß, als hartnäckig Argument gegen Argument steht, merklich nachläßt.
Erasmus von Rotterdam rühmt in einem Brief an Ulrich von Hutten die „freundliche und liebenswürdige Heiterkeit“ im Antlitz von Thomas More. Genau so fröhlich, ernst, klug und würdig spielt ihn Leopold Rudolf, für den das Stück wohl in der Josefstadt auf den Spielplan und von Michael Kehlmann in Szene gesetzt wurde. Kurt Sowinetz als Mann aus dem Volk gibt einen unentwegten, allen politischen Situationen chamäleonartig sich anpassenden Mitläufer. Franz Gary charakterisiert in einer kurzen Szene erstaunlich treffend den unberechenbaren König. Vilma Degischer als Mores Gattin findet nur wenig Gelegenheit zur Entfaltung. Die übrigen Darsteller (Elfriede Ramhapp, Klaus Wildbolz, Lukas Ammann, Georg Lhotzky, Guido Wieland, Karl Fochler, Fritz Schmiedel) füllen ihre Rollen mehr oder minder aus. Hervorragend die Bühnenbilder von Gottfried Neumann-Spallart. Der freundliche Beifall galt vor allem Leopold Rudolf. *
Kaum zu beschreiben, wieviel Humor und durchaus nicht billigen Optimismus der Holländer Toon Hermans in seiner „One Man Show“ im Theater an der Wien, unterstützt von einem kleinen Orchester, einer stummen Aktrice und einigen Helfern hinter der Bühne, allabendlich verbreitet. Clown und Poet dazu, bestreitet dieser große Komödiant sein zweieinhalbstündiges Programm in einer unvergleichlichen Mischung von Naivität und Raffinement, improvisiert, parodiert, zaubert eine ganze Galerie von lächerlichen und rührenden Mitmenschen auf die Bühne und bringt sogar das Kunststück zuwege, so ausgefallene Dinge wie ein hart- und ein weichgekochtes Ei mimisch darzustellen. Man dankte mit enthusiastischem Beifall.
Im Internationalen Künstlerklub im Österreichhaus mühten sich zwei junge Künstler: Gudrun Geier und Norbert Beilharz, um Kurzszenen aus Jean Coc-teaus „Taschentheater“. Die Darbietung dieser . esoterischeaisMqOploge nnd Gfct: .schichten läßt doch 'einige ,Zweifpi an dem Darstellbarkeit dieser ein Minimum an dramatischer Substanz aufweisenden eher epischen Gebilde aufkommen. Vielleicht wäre eine Rezitation oder Lesung am Vortragspult einer Aufführung vorzuziehen. Für die Einstudierung zeichnet Hans-Georg Rehr verantwortlich. Der Beifall galt den beachtlichen Bemühungen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!