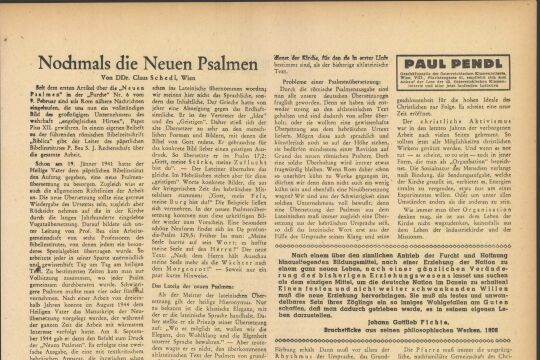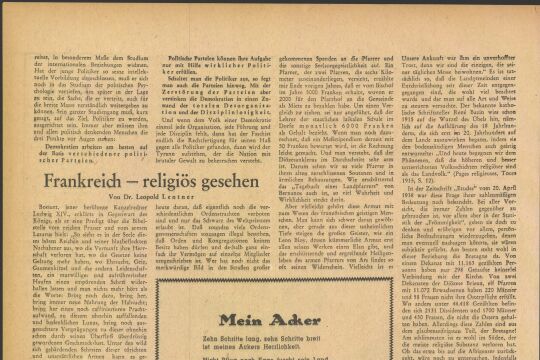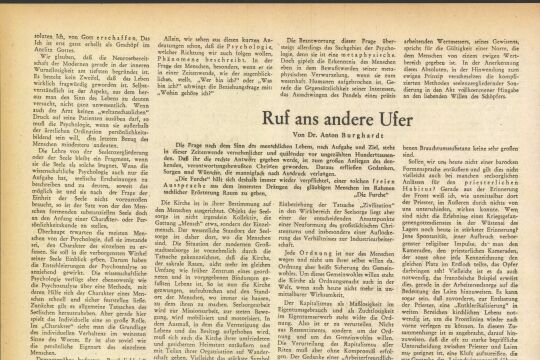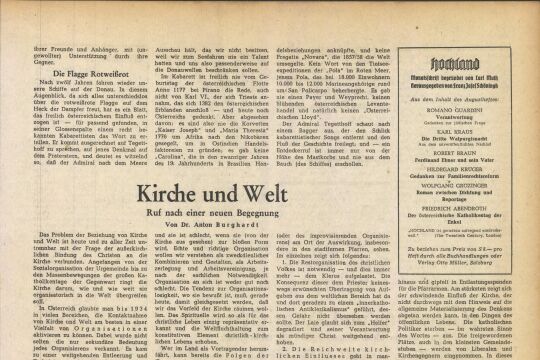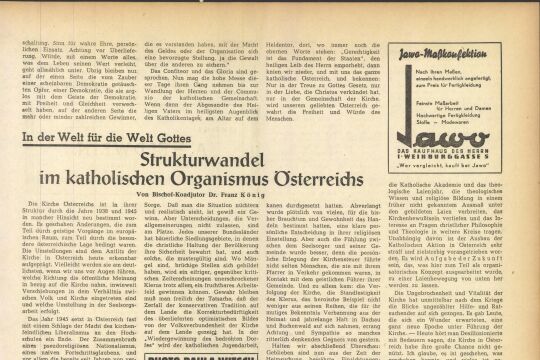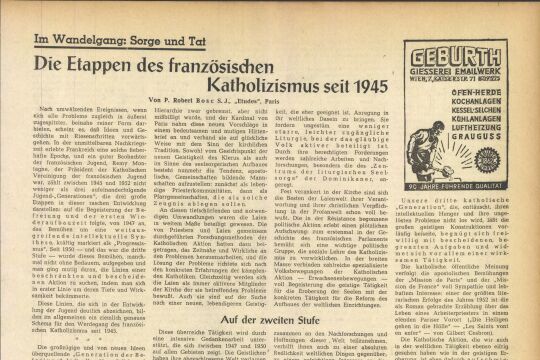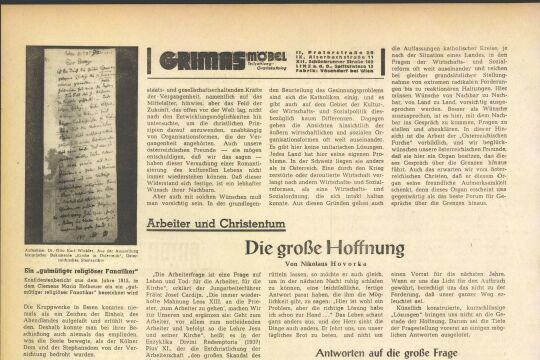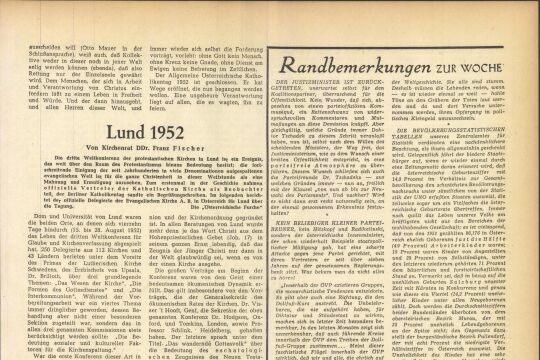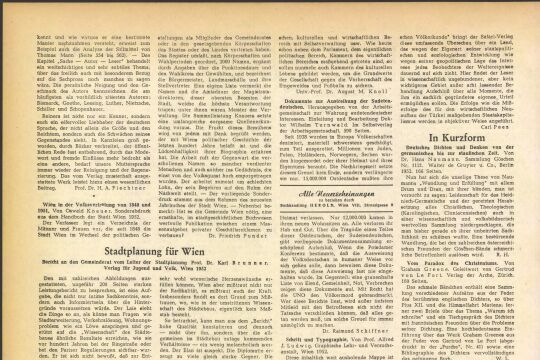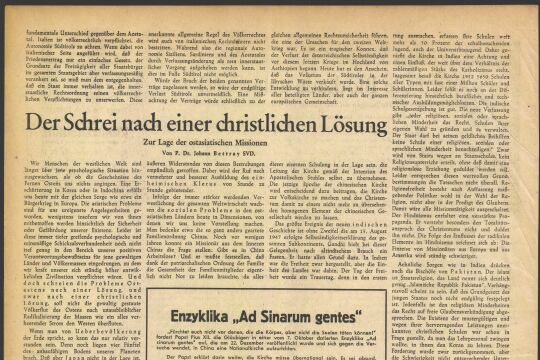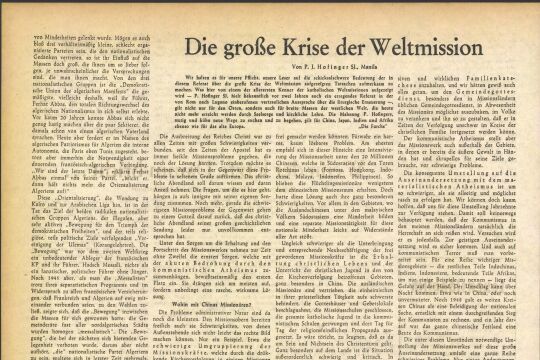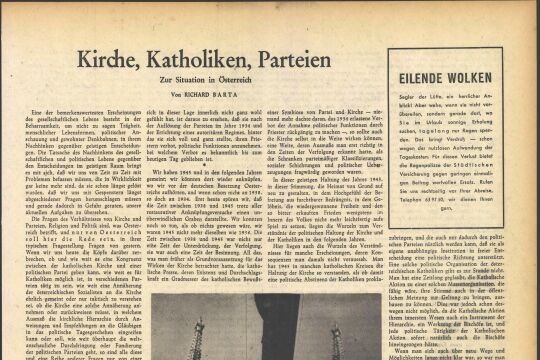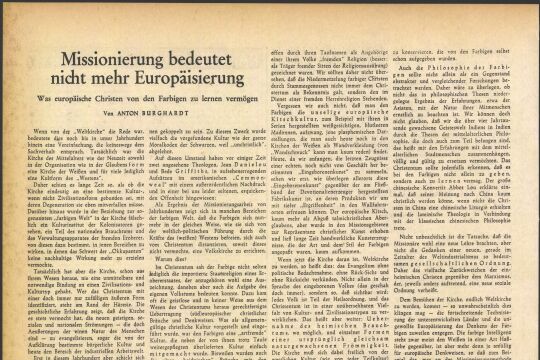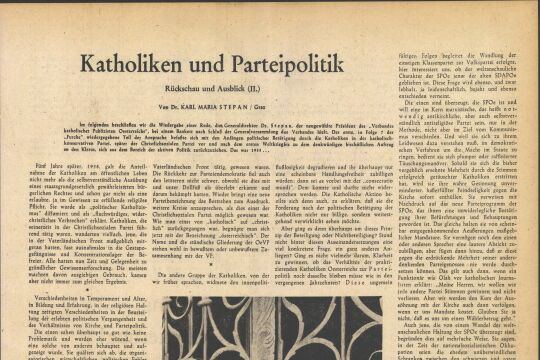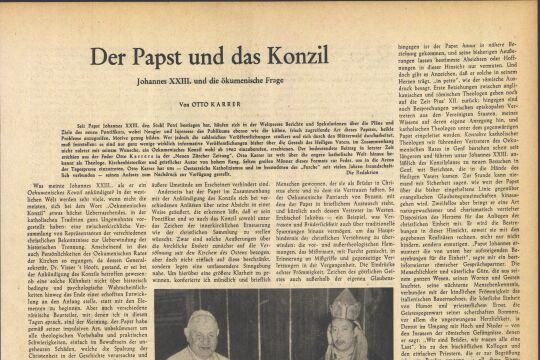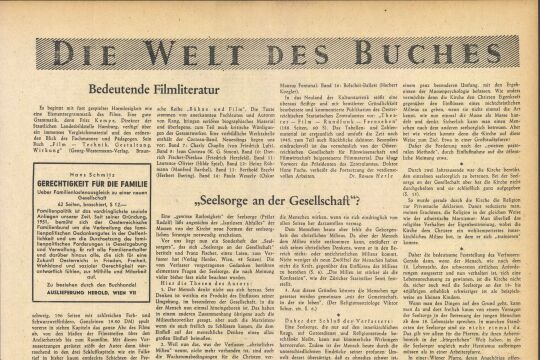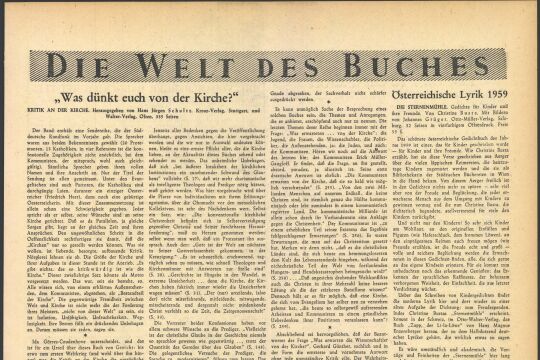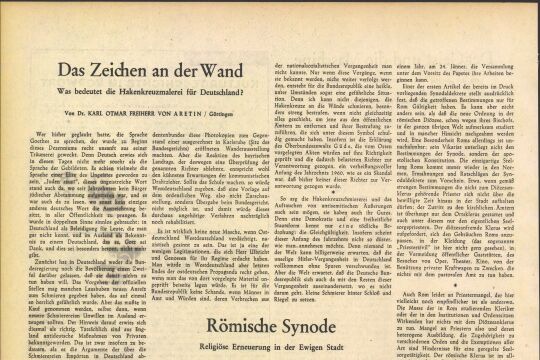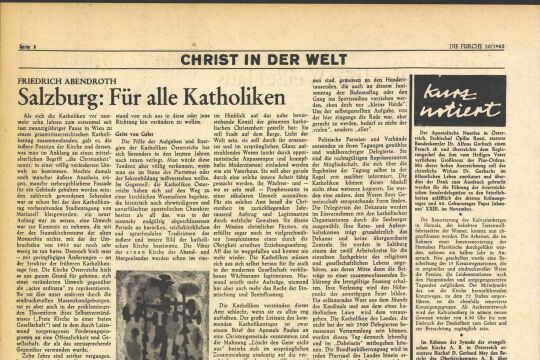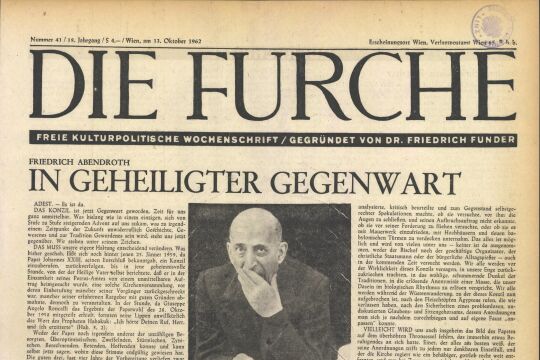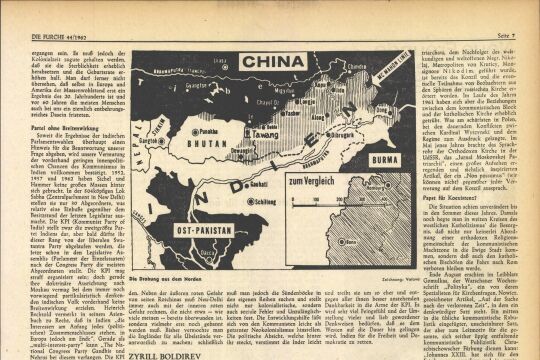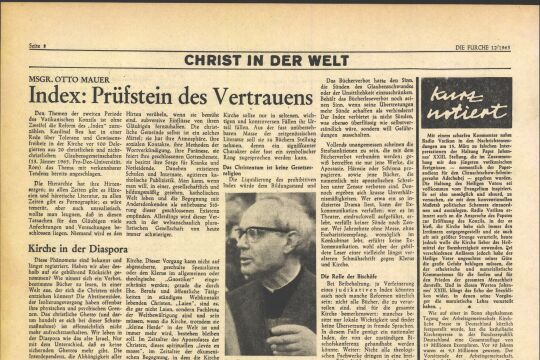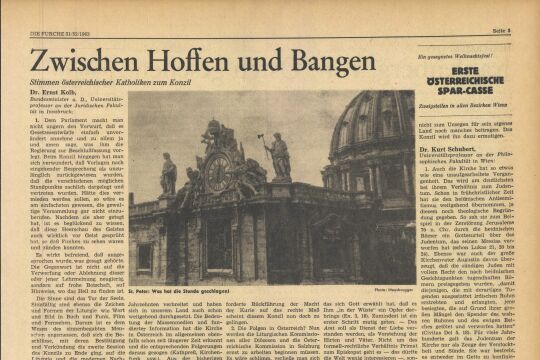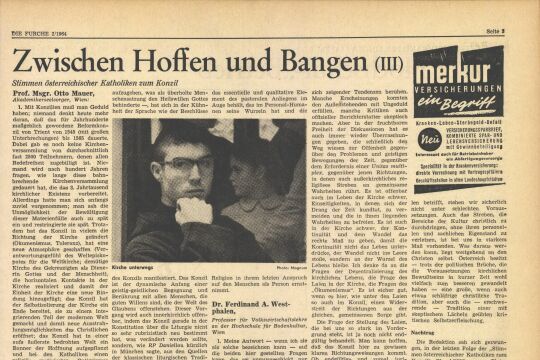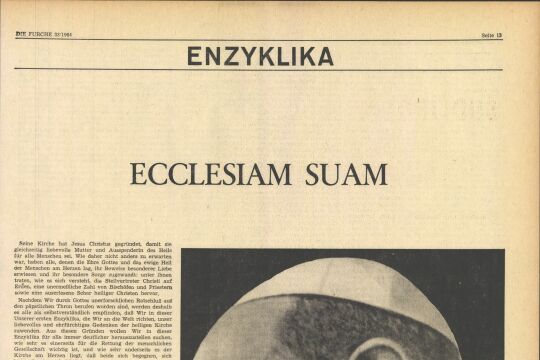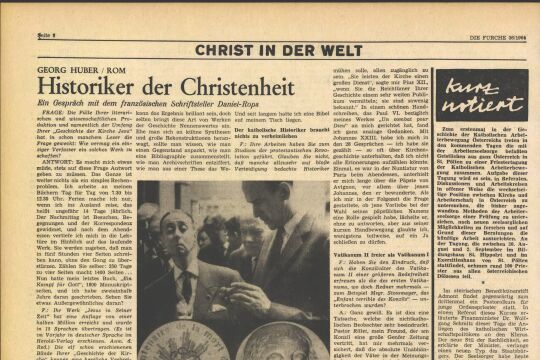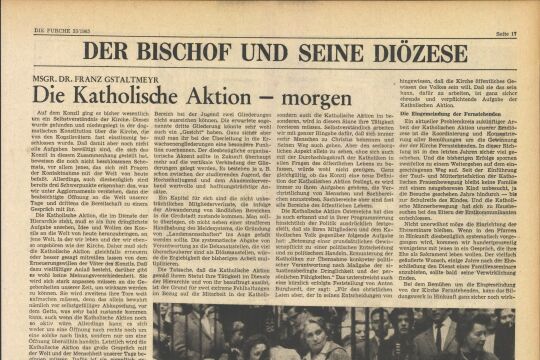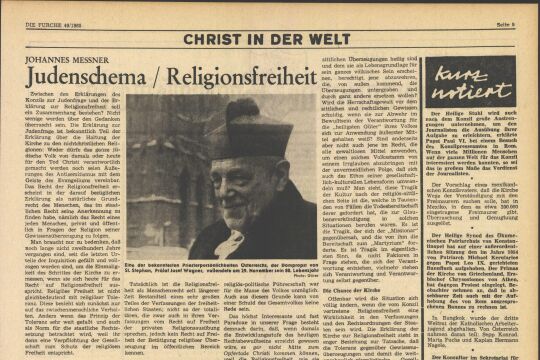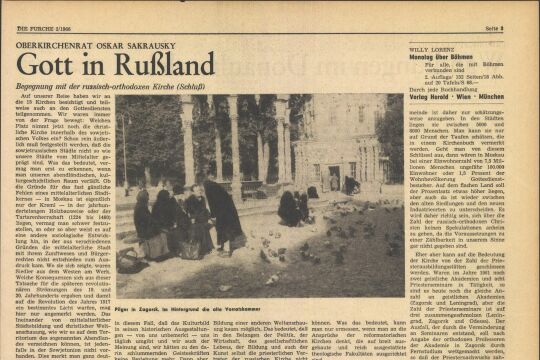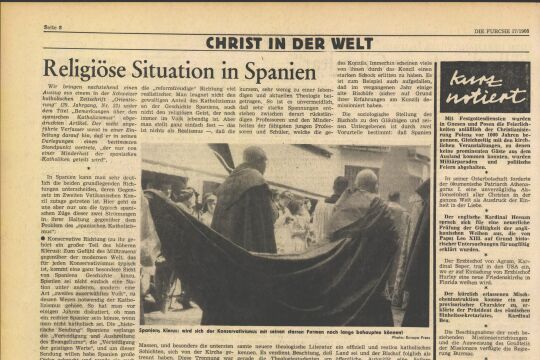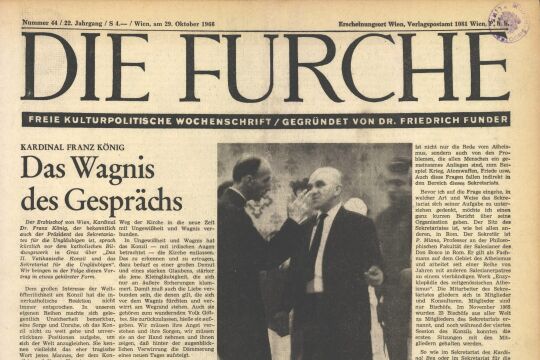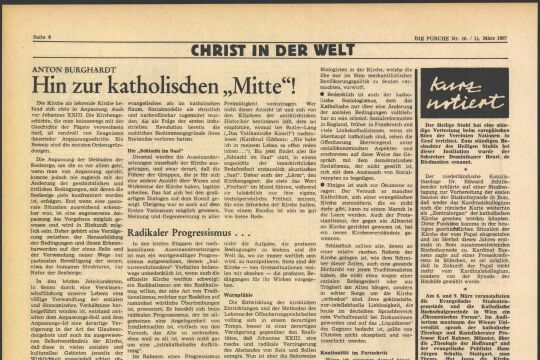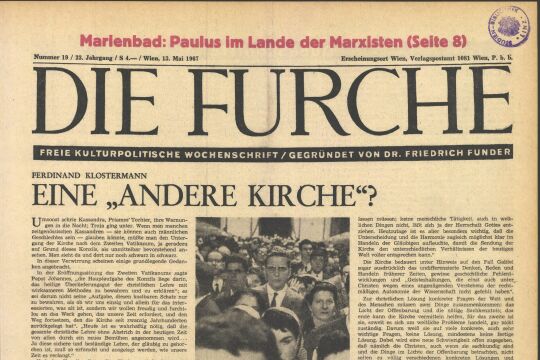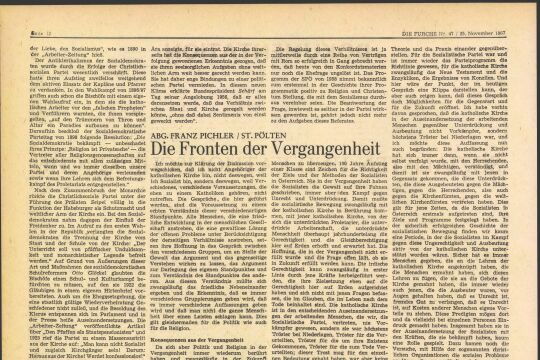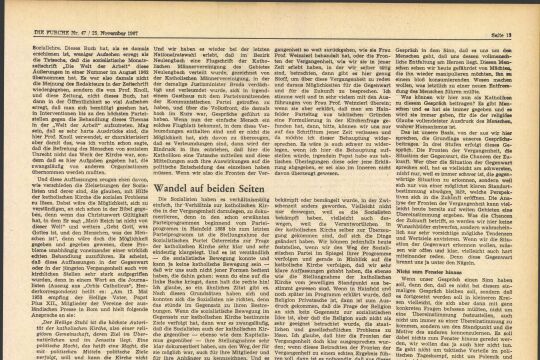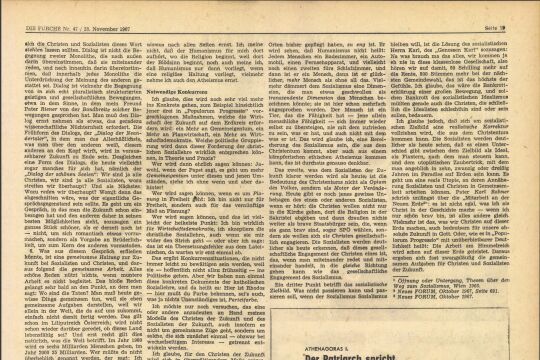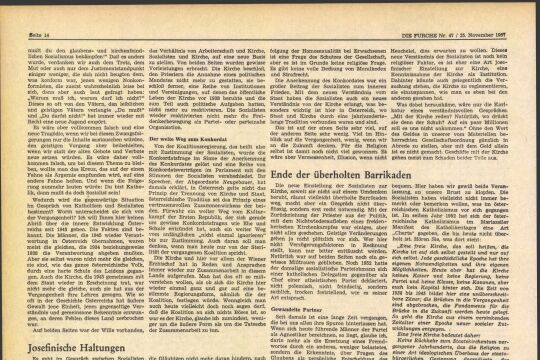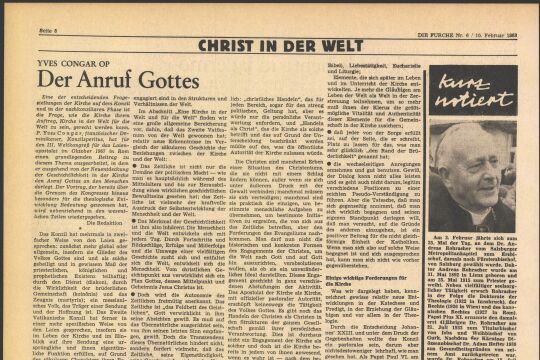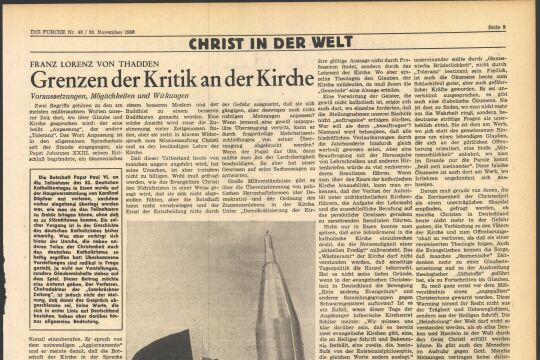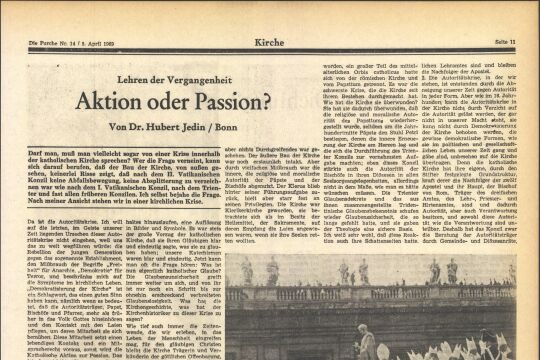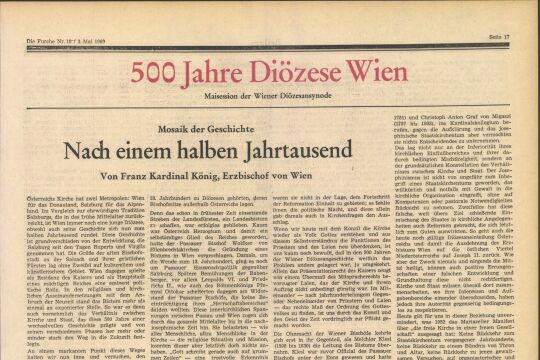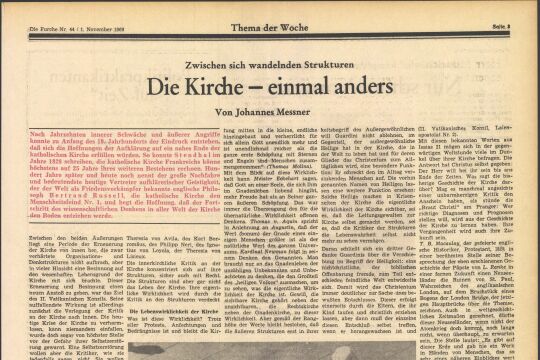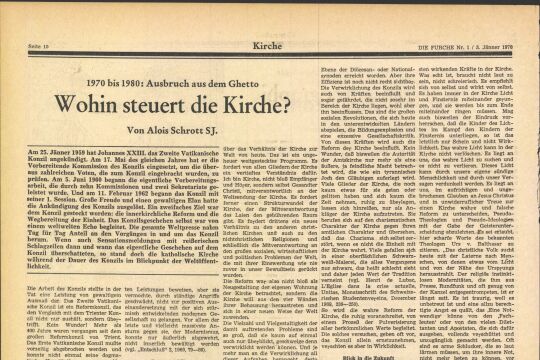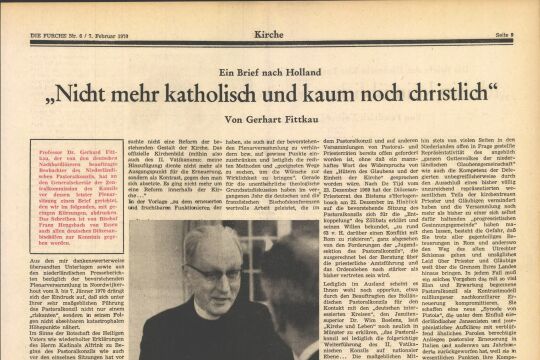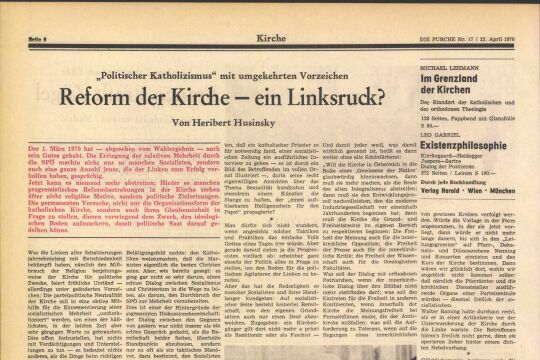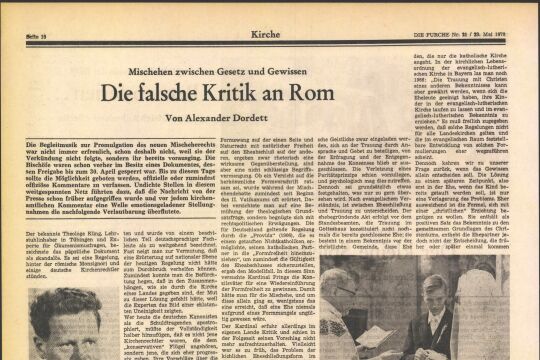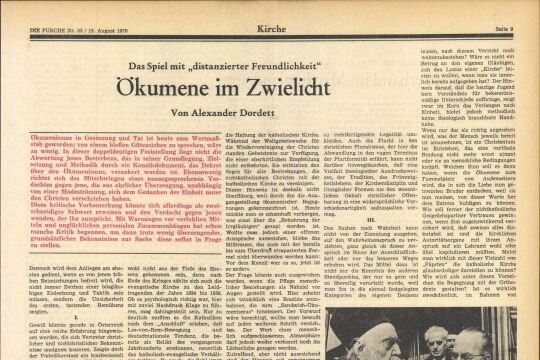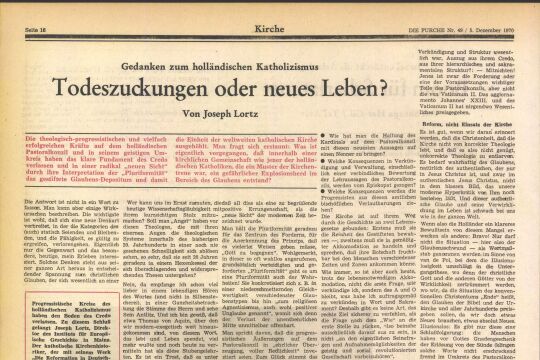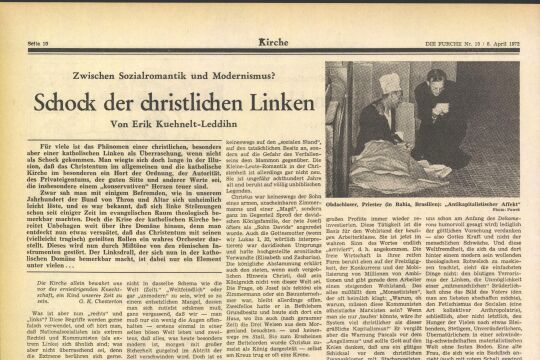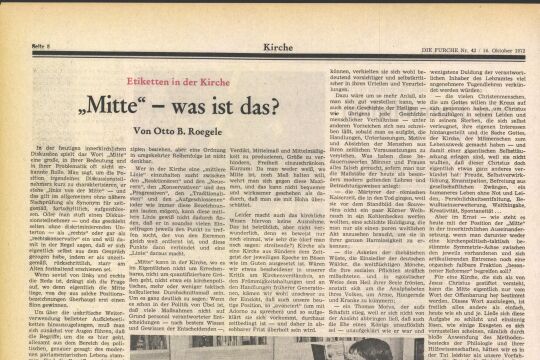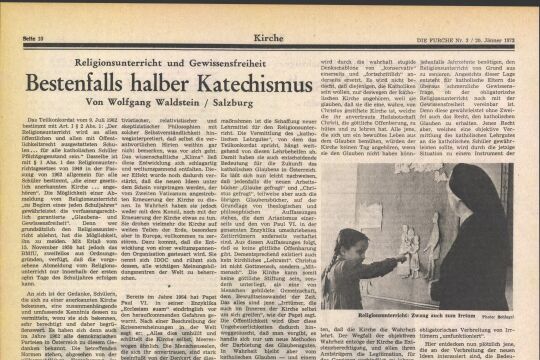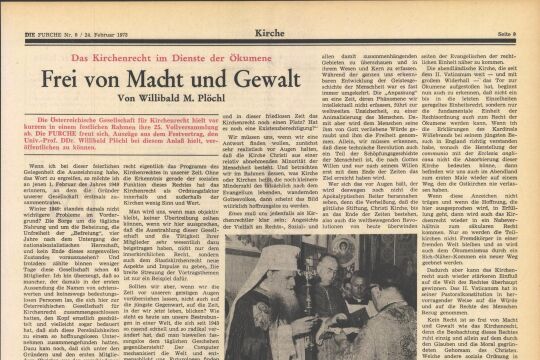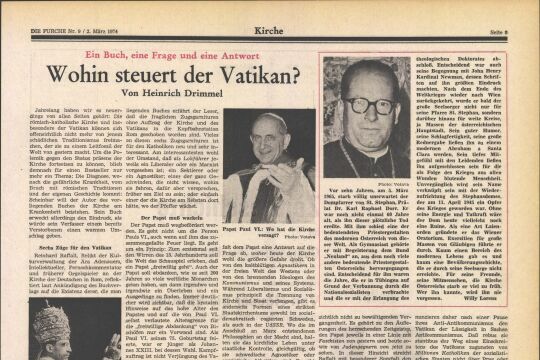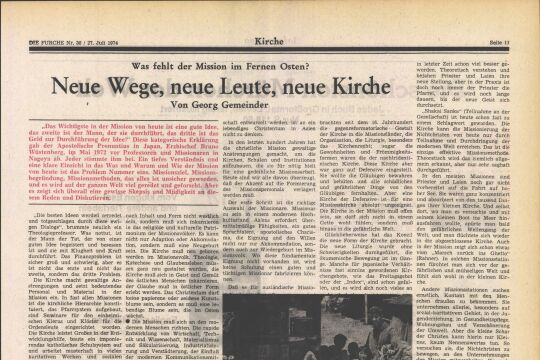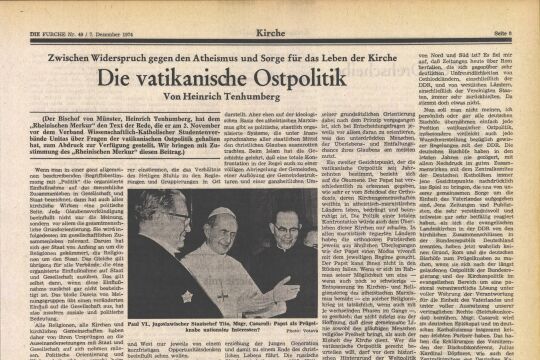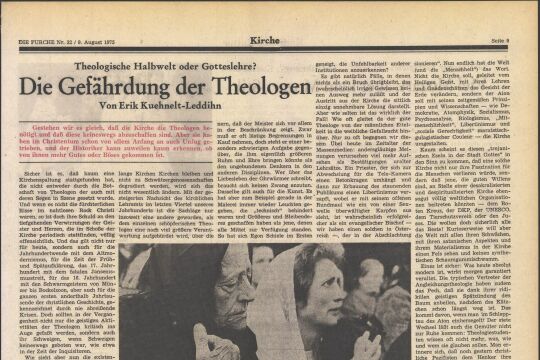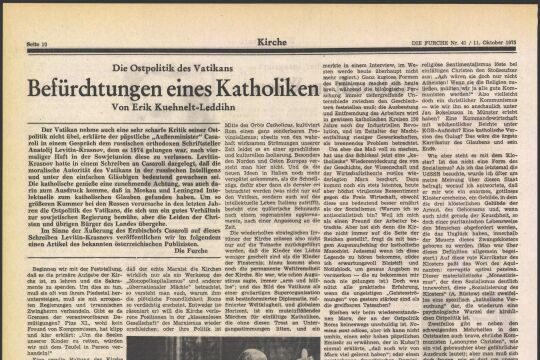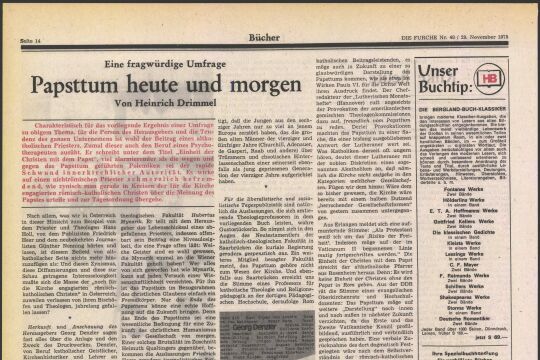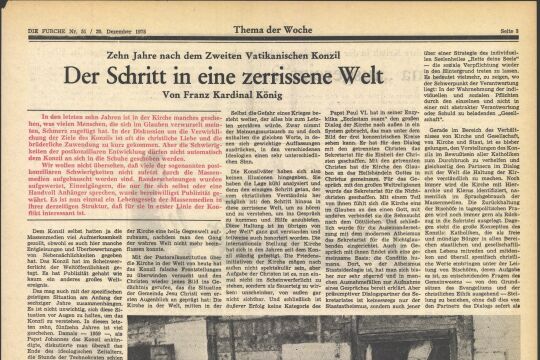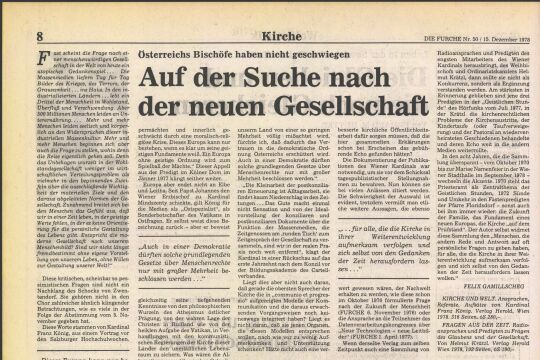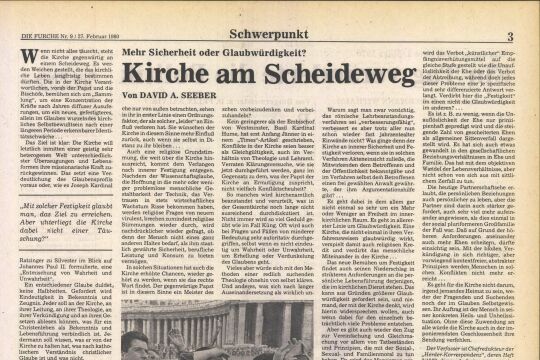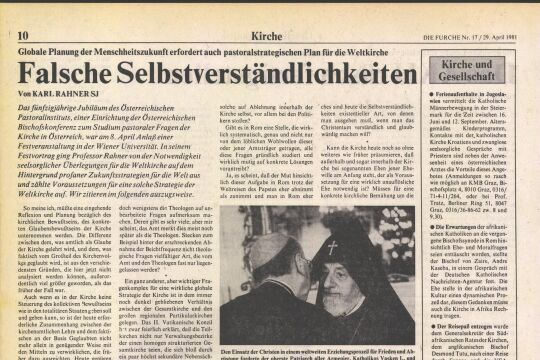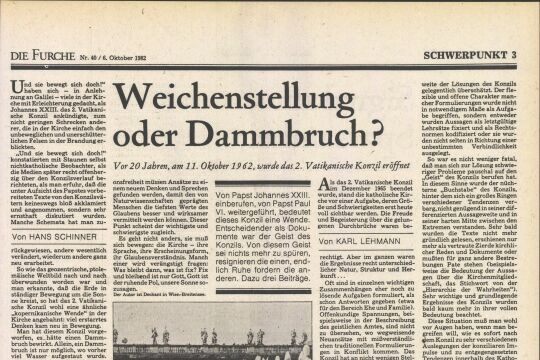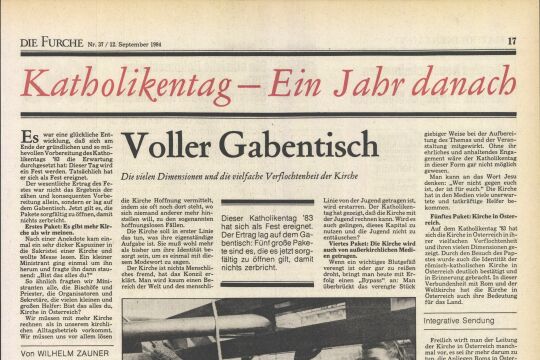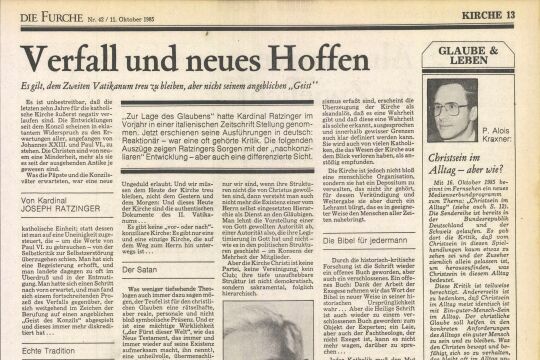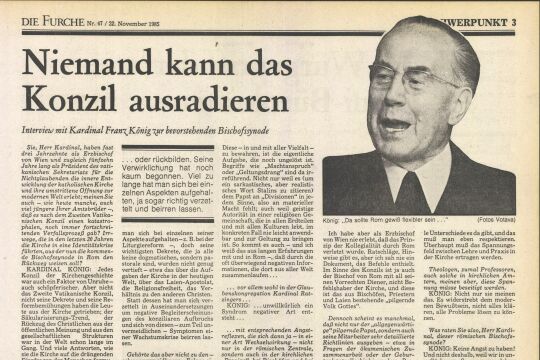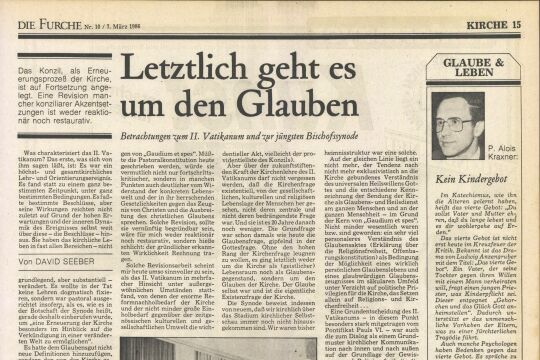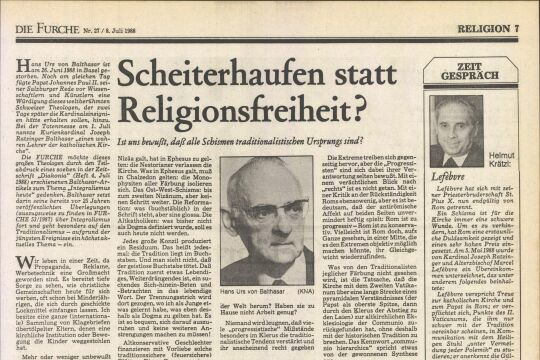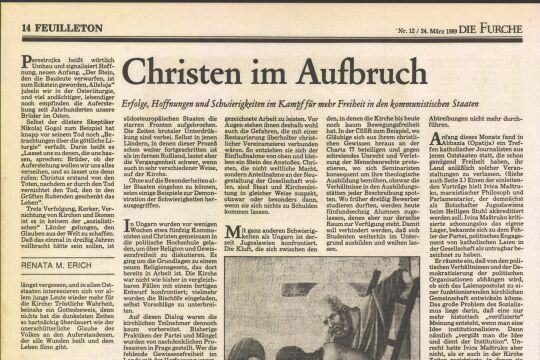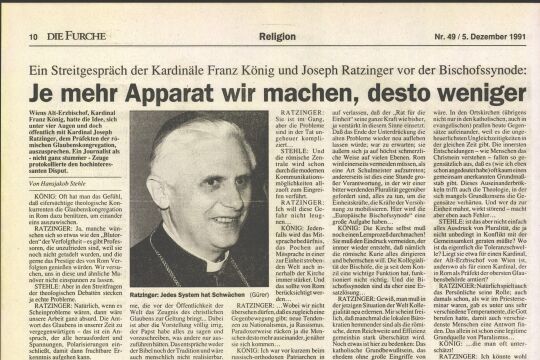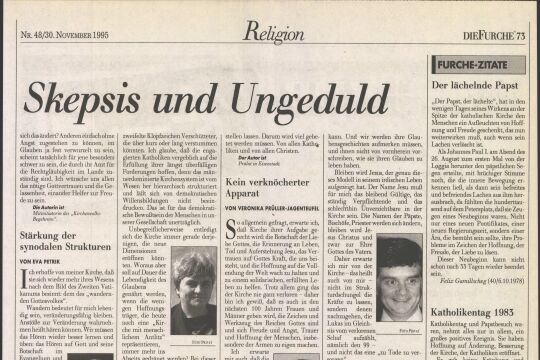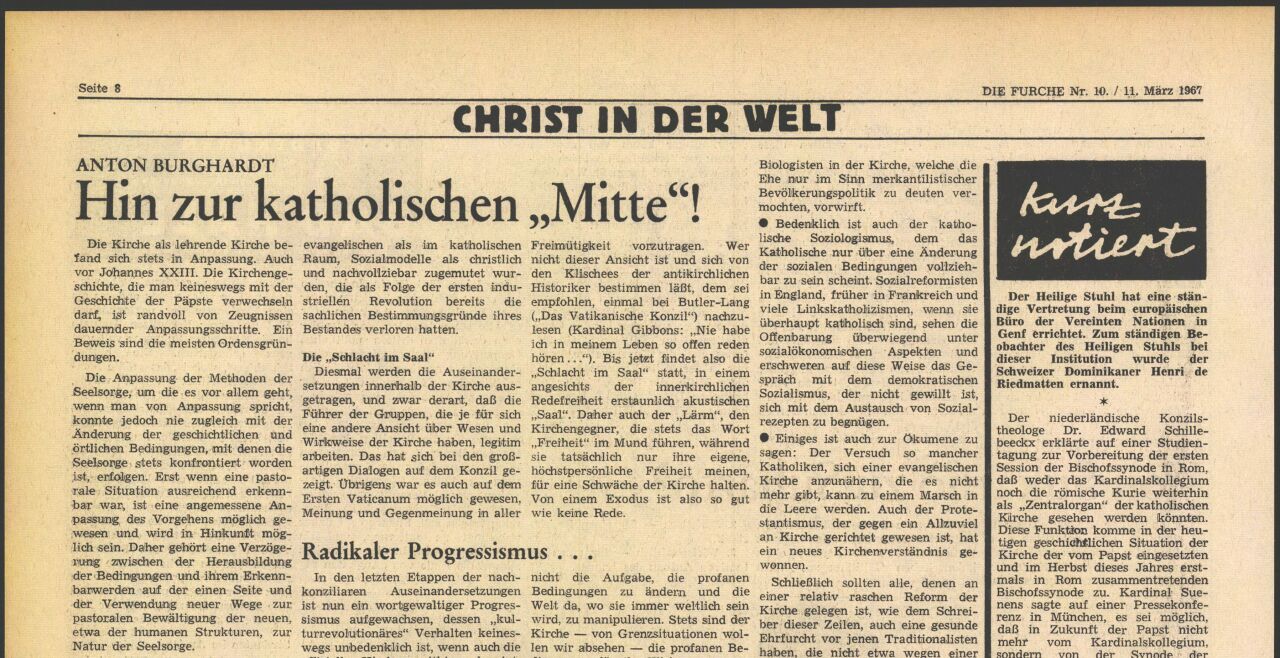
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Hin zur katholischen „Mitte“!
Die Kirche als lehrende Kirche befand sich stets in Anpassung. Auch vor Johannes XXIII. Die Kirchengeschichte, die man keineswegs mit der Geschichte der Päpste verwechseln darf, ist randvoll von Zeugnissen dauernder Anpassungsschritte. Ein Beweis sind die meisten Ordensgründungen.
Die Anpassung der Methoden der Seelsorge, um die es vor allem geht, wenn man von Anpassung spricht, konnte jedoch nie zugleich mit der Änderung der geschichtlichen und örtlichen Bedingungen, mit denen die Seelsorge stets konfrontiert worden ist, erfolgen. Erst wenn eine pasto-rale Situation ausreichend erkennbar war, ist eine angemessene Anpassung des Vorgehens möglich gewesen und wird in Hinkunft möglich sein. Daher gehört eine Verzögerung zwischen der Herausbildung der Bedingungen und ihrem Erkennbarwerden auf der einen Seite und der Verwendung neuer Wege zur Pastoralen Bewältigung der neuen, etwa der humanen Strukturen, zur Natur der Seelsorge.
In den letzten Jahrhunderten, in denen durch eine Verwissenschaftlichung unseres Lebens eine völlige Verwandlung der sozialen und ökonomischen Verhältnisse herbeigeführt worden ist, entstand zwischen dem Anpassungs-Soll und dem Anipassungs-Ist eine derartige Verzögerung in der Art des Glaubensdargebots und auch im ausgewiesenen Selbstverständnis der Kirche, daß diese in vielen sozialen und kulturellen Gebieten jenseits der Wirklichkeit angesiedelt schien, obwohl doch die Kirche „das gleiche Erdenlos mit der Welt“ hat (Konzilsdekrete 4/40). Wie kann aber eine Kirche „Sauerteig“ und „Seele der menschlichen Gesellschaft“ Werden, wenn viele und allzu viele ihrer höchsten Vertreter den Christen und indirekt auch den NichtChristen Verhaltens- und Sozialmodelle anbieten, welche „die Menschenfamilie und -geschichte“ keinesfalls „menschlicher“ gestalten können? Teile einzelner päpstlicher Rundschreiben (zum Beispiel „mirari vos“) sind ein Beweis für diesen Sachverhalt, der sich im großen Abfall des 19. und auch noch des 20. Jährhunderts widerspiegelt.
Daher war das, was . Johanr nes XXIII. „zur Artikulierung seines Refoirmprogramms“ die Anpassung nannte (für viele unter den gläubigen Christen eine (1) s. „Orbis Caltholicus“ 1/1967 S. 1 ff. ungemein schmerzliche), Nachholanpassung deren Programmschritte wegen des Abstandes der Kirche zur Wirklichkeit in vielen Regionen andere Ausmaße und Beschleunigungen haben mußten, als das bisher praktizierte zögernde Nachrücken an eine jeweilige Wirklichkeit, die, als man sie zu erkennen glaubte, ohnedies schon wieder Geschichte geworden war. Jedenfalls schien vielen das Vorhaben von Johannes XXIII. „revolutionär“. In erster Linie jenen, die in ihrem weltlichen Stolz auf bestimmte, ihrer materiellen Versorgung sehr nützliche Sozialstrukturen festgelegt waren und bisher, wenn sie sich in Rechtfertigungsnot befunden hatten, auf kirchliche und sogenannte kirchliche Lehrmeinun-gen hatten berufen können.
In der Kirche als einer lebendigen Organisation hat es auch stets das gegeben, was man vereinfachend die Progressisten und die Traditionalisten nennt. Die Vereinfachung ginge freilich zu weit, wollte man davon ausgehen, die Kirche sei nur eine Einheit des Widerspruchs zweier gegensätzlich wirkender Kräftegruppen. Wenn wir vom Bestand zweier Richtungen in der Kirche ausgehen, können diese Richtungen nur gedacht werden, wenn eine starke katholische Mitte vorhanden ist, auf die hin die Auseinandersetzungen, wenn sie noch das Zeichen des Katholischen tragen dürfen, stets zustreben. Der große „Auszug“ aus der Kirche hat meist dann stattgefunden, wenn die katholische Mitte schwach gewesen ist. Das war bei der Geburt der evangelischen Kirchen ebenso wie beim Massenausmarsch der Fabrikarbeiter, denen, mehr noch im evangelischen als im katholischen Raum, Sozialmodelle als christlich und nachvollziebar zugemutet wurden, die als Folge der ersten industriellen Revolution bereits die sachlichen Bestimmungsgründe ihres Bestandes verloren hatten.
Diesmal werden die Auseinandersetzungen innerhalb der Kirche ausgetragen, und zwar derart, daß die Führer der Gruppen, die je für sich eine andere Ansicht über Wesen und Wirkiweise der Kirche haben, legitim arbeiten. Das hat sich bei den großartigen Dialogen auf dem Konzil gezeigt. Übrigens war es auch auf dem Ersten Vaticanum möglich gewesen, Meinung und Gegenmeinung in aller
Freimütigkeit vorzutragen. Wer nicht dieser Ansicht ist und sich von den Klischees der antikirchlichen Historiker bestimmen läßt, dem sei empfohlen, einmal bei Butler-Lang („Das Vatikanische Konzil“) nachzulesen (Kardinal Gibbons: „Nie habe ich in meinem Leben so offen reden hören ...“). Bis jetzt findet also die „Schlacht im Saal“ statt, in einem angesichts der innerkirchlichen Redefreiheit erstaunlich akustischen „Saal“. Daher auch der „Lärm“, den Kirchengegner, die stets das Wort „Freiheit“ im Mund führen, während sie tatsächlich nur ihre eigene, höchstpersönliche Freiheit meinen, für eine Schwäche der Kirche halten. Von einem Exodus ist also so gut wie keine Rede.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!