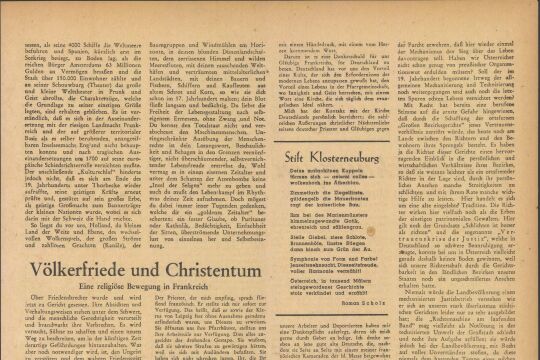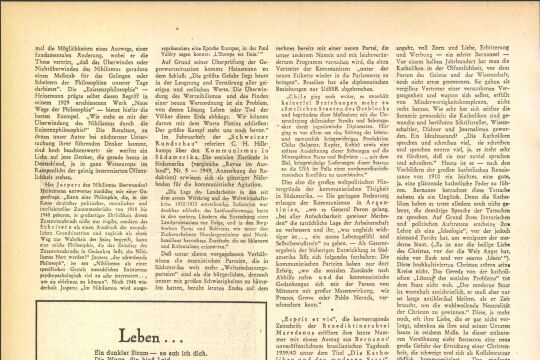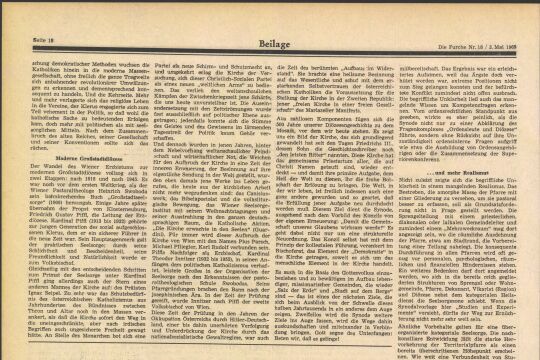Während Berichte über Sensationsprozesse im In- und Ausland stets auf das Interesse des breiten Publikums rechnen können, wird es selten genug mit tieferen Problemen der Rechtsprechung befaßt. Was sich hinter den Kulissen etwa der Bühnen abspielt, kann fast noch eher als der Ablauf jener Szenen auf höchste Anteilnahme rechnen, welche die Frucht aller jener personellen und technischen Vorbei eitungen darstellen — ganz anders aber im Bereiche der heutigen Gerichtsbarkeit, obwohl die Dramatik der Szene oft jener auf den Brettern kaum nachsteht. Der Durchschnittsbürger will von der Welt , der Jurisprudenz nichts mehr wissen, obwohl es Zeiten gegeben hat, wo das gesellschaftliche Leben und das Gerichtswesen so vermählt einhergingen, daß es keine Geheimnisse und keine Geheimnistuerei geben konnte. Heute freilich scheint es manchmal, als wären sie hüben und drüben zufrieden, wenn der eine vom anderen nichts Rechtes weiß — die Juristen, sie bilden einen eigenen Beruf, sie leben, geistig gesprochen, im Getto — und, wie gesagt, es scheint, daß dieser Zustand auf allseitige Zufriedenheit stößt.
Wie immer die Erklärung für diese Erscheinung sein mag — jedenfalls kommt es selten genug vor, daß sich die Oeffentlichkeit mit den Nöten und Problemen jener drüben wohnenden Kreise befaßt; kürzlich aber nahm die gesamte Tagespresse verhältnismäßig ausführlich von einer Problematik Notiz und übermittelte sie ihren Lesern als Ereignis ersten Ranges, welche gerade zu den subtilsten und selbst im Bezirke der Jurisprudenz eigenartigsten zählen dürfte. Sie verlieh einer Frage Publizität, welche alles eher denn vom Manne' auf der Straße Verständnis heischen könnte, sollte man glauben. Allein dies rechtfertigt wohl, den Vorhang vor den Bereichen des modernen Gerichtswesens einmal beiseitezuschieben und das zu jenen Pressemeldungen Erforderliche zu ergänzen.
Am 27. März und am 2. April fanden sich die Vertreter der österreichischen juristischen Elite zu einer Enquete über die Frage zusammen, wie der Gefąhr vę rgeĮ eugt werden., Hpnnj jJąĮ ,-die drei österreichischen Hochstgeriphte, ajuj .(?in T’ der Oberste Gerichtshof, der Verfassungs- gerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof, über ein und dieselbe Materie verschieden urteilen, also divergierende Entscheidungen treffen. Daß dies überhaupt möglich ist und vorkommt, muß hier als Axiom vorausgesetzt werden — es dürfte übrigens genügen, daran zu erinnern, welche Konfusion es in der Ersten Republik für die mit dem Eherecht befaßten Stellen bedeutete, daß zwischen dem Obersten Gerichtshof und dem Verwaltungsgerichtshof eine niemals bereinigte Meinungsdifferenz darüber herrschte, ob der Landeshauptmann (von Wien) Dispens vom Eheband erteilen könne.
Auch heute ist es ein praktischer Anlaß, der die Gemüter zuerst der Fachkreise, dann der Gerichte und Rechtsanwender und zuletzt der Oeffentlichkeit zu erregen beginnt, und zwar handelt es sich hauptsächlich um die Frage, wa von dem noch immer vorhandenen Gesetzesmaterial aus der NS-Zeit in Geltung steht — oder, genauer gesagt: welche Stellen befugt sind, über Geltung oder Nicht-mehr-Geltung solcher Normen bindend abzusprechen — bzw. letztlich (denn hieraus ist der Streit entsprungen) — ob die Gerichte oder nur die gesetzgebende Gewalt zur einschlägigen Entscheidung berufen seien. Daß es sich hierbei nicht um müßige Spekulationen handelt, sondern um Geisteskämpfe von eminent praktischer Bedeutung, haben die je nach der bezüglichen Auffassung ergangenen Gerichtsentscheidungen gezeigt, wenn sie auf fragliches Rechtsgut aus der NS-Aera noch oder nicht mehr Bedacht nahmen und, je nachdem, zivile oder strafrechtliche Tatbestände entschieden, welche für einzelne Parteien, aber auch für ganze Bevölkerungsgruppen namhafte Konsequenzen nach sich zogen. So wurde unter dem Gesichtspunkte, daß die Gerichte nach selbständiger Vorprüfung auf gewisse arbeitsrechtliche Bestimmungen (Arbeitsplatzwechsel u. a.) nicht Bedacht nahmen, weittragende, moderner Auffassung entsprechende Auslegung möglich. Aber nicht genug damit: es gibt und gab seit 1945 literarische Fachstimmen, welche aus der Beibehaltung der Doktrin, daß die Gerichte kein selbständiges Prüfungsrecht hätten, ernsteste Gefahren voraussehen für den Bestand der Republik selbst — und sie verweisen überzeugend darauf, daß irgendwelche NS-Geheimerlässe, welche geeignet sein könnten, den Staatsbestand geradezu aufzulösen, in der Rechtsprechung eines Tages Anwendung finden könnten, wenn die Gerichte nicht selbständig ein Vorprüfungsrecht ausüben dürften. (Schreiber dieser Zeilen trat seit 1947 ständig für die Auslegung der bundesrechtlichen Normen ein, welche den Gerichten das Prüfungsrecht gestatten würden, nämlich des § 1 des Rechtsüberleitungsgesetzes 1945.)
In den letzten Jahren haben nun die drei Höchstgerichte, also der Oberste Gerichtshof, der Verfassungs- und der Verwaltungsgerichtshof, in verschiedenen an sie herangetragenen Fällen jeder zu dem hier angedeuteten Problem als Voraussetzung für die Lösung des dort kon- kręt anhängigen Rechtsfalles Stellung beziehen müssen, woraus sich als Ergebnis eine hoch bedeutsame Meinungsverschiedenheit zu erkennen gab: Während der Verfassungsgerichtshof (wohl hierin geführt von seinem Mitglied, Universitätsprofessor Dr. Wolff) sich der von mir seit Jahr und Tag vertretenen Meinung anschließend dekretierte, daß die Gerichte befugt seien, selbständig zu prüfen, ob eine von ihnen als Entscheidungsgrundlage allenfalls heranzuziehende Norm aus der NS-Zeit noch in Geltung stehe, legten der Oberste Gerichtshof und der Verwr.I- tungsgerichtshof unabhängig voneinander die hier maßgebliche Bestimmung (§ 1 Rechtsüberleitungsgesetz 1945) gegenteilig aus: nach ihnen darf nur der Gesetzgeber (Parlament, unter Umständen die Regierung) bindend entscheiden, ob eine noch nicht sonstwie förmlich aufgehobene Vorschrift aus der NS-Zeit weitergelte bzw. den gerichtlichen Entscheidungen zugrunde gelegt werden müsse.
So sehen wir uns also wieder der Erscheinung gegenüber, daß in einer viel mehr noch als bei den Divergenzen in der Zweiten Republik allgemein bedeutungsvollen Frage über ein und dieselbe Rechtsfrage selbst auf höchster Ebene Meinungsverschiedenheit herrscht. Und nun wird es mir wohl gelungen sein, allgemein verständlich zu machen, daß und warum verantwortungsbewußte Männer den Versuch unternommen haben, derartige Meinungsdifferenzen nach ihren Urgründen zu erforschen und die Wurzeln der alarmierenden Erscheinung aufzudecken.
Leicht verständlich, daß es bereits zu verschiedenen Lösungsvorschlägen gekommen ist und daß die erste, man wird sagen dürfen: die primitivste Lösung darin gesucht werden will, eine Oberinstanz über den drei Höchstgerichten ad hoc zu schaffen, einen Senat, der zusammentreten soll, wenn solche Differenzen auftauchen und es einer einheitlichen Entscheidung bedürfte. Eine Variante aus .dieser ersten Lösungsidee mag die ebenfalls vorgeschlagene sein, niemand anderen als den Gesetzgeber selbst mit der Aufgabe zu betrauen, in solchen Fällen den Streit autoritär zu entscheiden, ein Gedanke, der im englischen Rechtswesen auf den ersten Anschein eine gewisse Parallele hätte, weil dort unter Umständen das Parlament selbst als Höchst- und Letztinstanz rechtsprechend tätig wird. Ebenso finden sich auch für einen Senat in obigem
Sinne Vorläufer in der Gerichtsverfassung der österreichisch-ungarischen Monarchie, sogenannte „Austrägal-Senate“ — immerhin stießen alle diese Vorschläge, welche letztlich ja doch auf die Schaffung einer weiteren Letztinstanz für die Rechtsprechung hinauslaufen, soviel ersichtlich, nicht auf allgemeine Zustimmung: jenes Kollegium hervorragender Juristen, welches bisher darüber öffentlich diskutierte, hat sich vertagt, um eine weitere Prüfung der einschlägigen Problematik durch ein engeres Komitee zu ermöglichen.
Nicht daß ich hier etwa eine Lanze für die Verteidigung jener These des Verfassungsgerichtshofes einzulegen beabsichtige, welche — wie erwähnt — meine eigene Rechtsmeinung und Auslegung im konkreten Falle ndes § 1 Rechtsüberleitungsgesetz) übernommen hat! Gleichwohl aber halte ich, und hierin glaube ich mich mit dem interessierten Leser einer Meinung zu fühlen, an der These fest, daß es nur eine wenig befriedigende Lösung der aufgezeigten Divergenzschwierigkeit bedeutete, wenn einer, sei es von den drei Höchstgerichten. verschiedenen Stelle, sei es einem dieser drei Gerichte selbst übertragen, die Entscheidungsmacht in die Hände gelegt würde! Man beachte den Akzent: Macht! und man wird leichter verstehen, was ich andeuten will: Ich glaube nämlich, und wiederum habe ich das Gefühl, damit eine auch dem Mann von der Straße geläufige Meinung wiederzugeben, daß es nur eine einzige richtige Entscheidung in Dingen der Gerichtsbarkeit geben kann. Ist dem aber so, dann würde es wenig befriedigen, wenn über Appell sozusagen an das Schwert der Justiz ihr Zepter zum Ruhen käme; es sei denn, Schwert und Zepter lägen in von vornherein berufener Hand. Eine sehr hintergründige, etwa gar eine politische oder gar ketzerische Rechtsphilosophie? Etwa gar der Ruf nach dem gesalbten Monarchen?
Ich will diese Vorwürfe auf sich beruhen lassen — jedenfalls zwingt die bisherige ungelöste Schwierigkeit mit jenen Divergenzen, den Dingen mehr als bisher auf den Grund zu gehen —, und ich meine, daß der Gruild nicht in persbfia- len oder bürotechnischen VerhältnisseriäJleiri zu suchen sein kann — eine maßgebliche Stimme unter jenen Diskussionsrednern allerdings glaubte, die Lösung dadurch erwarten zu können, daß die drei Gerichte Unter demselben Dache (des Justizpalastes auf dem Schmerlingplatz) Quartier nehmen! —, sondern im Grunde des Rechtes überhaupt, des Rechtes und der Rechtsprechung.
Das Recht geht vom Volk aus, sagt unsere revolutionäre Verfassung von 1920 — mag sein, aber das Volk ist von Gott geschaffen, Gott ist als Schöpfer auch schon deshalb der Urgrund allen Rechtes. Er ist also der Grund, auf den es hinabzusteigen gilt, wenn Unruhe und Sorge r!s Folge von Fehlkonstruktionen und menschlichen Mängeln offenkundig geworden sind.
Wenn ich also sagte, daß es nur eine einzige richtige Entscheidung geben kann — in welcher Gerichtssache immer —, so hat diese These ihre Rechtfertigung wohl auch in dem Gedanken an die göttliche Herkunft des Rechtes, der Grundnorm, des Naturrechtes, wie diese oder jene Bezeichnung es benennt, und dies läßt es von vornherein widersinnig erscheinen, daß es über ein und dasselbe Verhältnis zwei verschiedene Richtersprüche geben kann, welche beide Anspruch auf alleinige Gültigkeit erheben könnten. In diesem Sinne nur, nicht in politischem, wenn auch die personelle Heiligkeit des gesalbten Monarchen solchen Gedanken in vielem die menschlich mögliche Entsprechung geboten haben mag, in diesem Sinne also möchte ich jenen wackeren Männern, welche nunmehr bemüht sein werden, einen befriedigenden Lösungsvorschlag zur Vermeidung höchstgerichtlicher Rechtsprechungsdivergenzen herauszuarbeiten, zu bedenken geben, daß die gesamte staatliche Gerichtsbarkeit, so säkularisiert sie sich auch heute gibt, noch immer letztlich Religionsübung ist! Als solche gekennzeichnet allein durch den priesterlichen Talar der Richter, durch die allein der Rechtsprechung zugehörige Eidesgewalt, durch die Historie ihrer Ursprünge und Abspaltung vom priesterlichen Amt.
In diesem Sinne müßte daher, soll das heute stark ramponierte Ansehen der Rechtsprechung wieder auf seine volle Höhe gebracht werden, auf seinen lebendigen Zusammenhalt mit dem sozialen Leben wie ehedem, bei den nun zu treffenden Entscheidungen daran gedacht werden. daß es um Dinge geht, welche durch eine bloß rechtspositivistische Lösung nicht verbessert werden könnten.