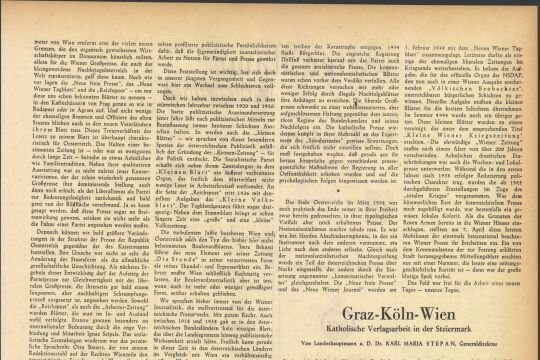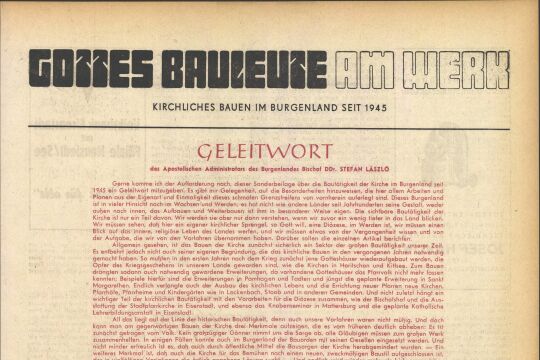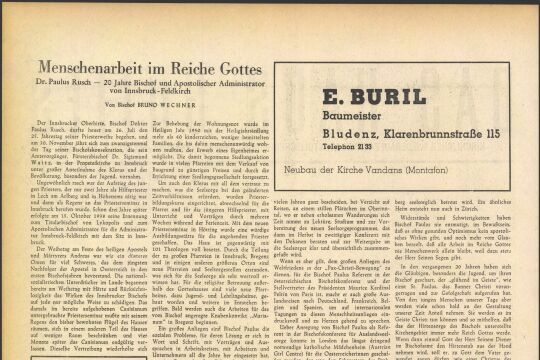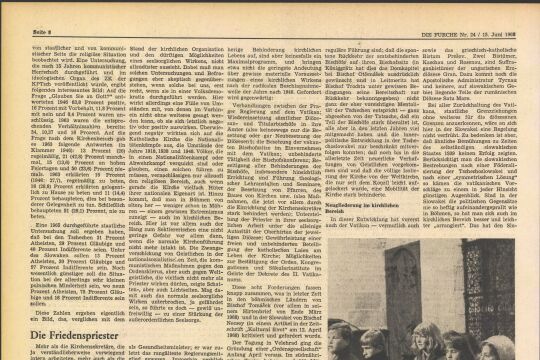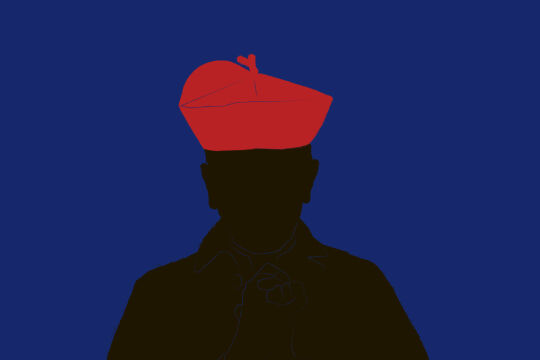Weber und Kapellari: Nachschau am Ende zweier Bischofs-Ären
Johann Weber war in der Steiermark das Urbild eines Hirten - Egon Kapellari in Kärnten der Seelsorger als Aufkärer. Zwei Rückblicke.
Johann Weber war in der Steiermark das Urbild eines Hirten - Egon Kapellari in Kärnten der Seelsorger als Aufkärer. Zwei Rückblicke.
Es waren keine spektakulären Großtaten, mit denen sich Bischof Johann Weber in die Geschichte einschrieb. Als "Leutebischof" wird er in Erinnerung bleiben, als einer, der in Umbruchszeiten die Menschen um sich scharte, der ihre Sorgen kannte, der ihnen Hoffnung gab und sie ermutigte, ihren Glauben in schwierigen Zeiten zu leben.
Einige Kirchenbauten, viele pastorale Initiativen, die Aufstockung des Personals durch Frauen und Männer aus dem Laienstand: all das unterscheidet die Grazer Diözese nicht wesentlich von anderen, das lag in der Zeit. Und gegen Ende hin kam ebenso wie überall das Sparen und Einschränken, vorausgesagte magere Jahre warfen ihre Schatten voraus. Unter großen finanziellen Opfern wurde das Priesterseminar umgebaut. Der Wunsch, durch die Renovierung dieses bedeutenden Bauwerkes auch eine Renaissance der Priesterberufungen einzuleiten, geht nicht in erhofftem Ausmaß in Erfüllung.
Die Priesterfrage gehört zu jenen Themen, an denen sich Bischof Webers Herz blutig rieb: in seinen ersten Bischofsjahren legten einige Dutzend Kapläne ihr Amt nieder. Ein Hauptmotiv dürfte die nach dem II. Vatikanum gehegte Hoffnung auf die Aufhebung des Pflichtzölibates gewesen sein. Insgesamt ging die Zahl der Priester drastisch zurück, die Überalterung des Klerus nimmt bedrohliche Formen an. Dies Bischof Weber anzulasten, wäre allzu billig. Der Wind des Zeitgeistes wehte der Kirche ins Gesicht: Säkularisierung, Aufbegehren gegen Obrigkeiten lassen sich zum Teil mit dem Jahr 1968 verknüpfen: die Studentenunruhen als ein Zeichen des gesellschaftlichen Umbruches, in dem die alten Feudalverhältnisse auf gesellschaftlicher Ebene zu bröckeln begannen, die Enzyklika "Humanae vitae", die im Verbot der Empfängnisverhütung durch so genannte künstliche Mittel gipfelte, sind als Ursachen ebenso zu nennen wie die Frauenbewegung, der Übergang von der Agrargesellschaft zum Industriezeitalter und weiter zur globalisierten Marktwirtschaft, die Singularisierung und viele andere Erscheinungen der Gegenwart. Sie alle zehrten die volkskirchlichen Strukturen aus.
Mit Erfolg auf die Liebe gesetzt
Der steirische Oberhirte empfand dies als persönliche Herausforderung und versuchte mit allen seinen Kräften, dem Trend gegenzusteuern. Seinem Einsatz ist es vermutlich zu verdanken, dass nicht noch größere Einbrüche zu verzeichnen sind. Er setzte mit Erfolg auf die Liebe, die ihm von allen Seiten zufloss: es werden die großen Feste sein, die mit ihm assoziiert werden. Die Stadt Graz hat durch sie stark profitiert: das erste Stadtfest 1978 wurde zum Modell für weitere, der steirische Katholikentag 1981 als Fest der Brüderlichkeit, der "Tag der Steiermark" 1993 und die "Zweite Europäische Ökumenische Versammlung" 1997 seien als Beispiele genannt, wie Stadt und Land, Jung und Alt, Skeptische und Begeisterte zusammen feiern und Frohbotschaft ohne große Worte lebendig werden lassen können.
Die Priesterfrage gehört zu jenen Themen, an denen sich Bischof Webers Herz blutig rieb: in seinen ersten Bischofsjahren legten einige Dutzend Kapläne ihr Amt nieder.
Tiefe Gräben, die zu Beginn seines Episkopates in der steirischen Kirche zwischen fortschrittlichen und konservativen Priestern und Laien herrschten, wurden zugeschüttet, dürften aber als Bruchlinien in der Zukunft verstärkt die Landschaft prägen. In kleinen Zirkeln werden Bischof Webers menschenfreundliches Ernstnehmen der Sorgen und Leiden an starren kirchlichen Normen als Zugeständnisse an den Zeitgeist und als Aushöhlung des Glaubensgutes gewertet.
Das öffentliche Austragen von Konflikten, entschiedenes Durchgreifen lag ihm nicht, Polarisierungen waren ihm von Herzen zuwider. Er lenkte durch die Bestellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die er an sich band, und auf die er sich verlassen konnte. So bestellte er etwa Franz Küberl zum steirischen Caritas-Direktor. Dieser knüpft ein Netz unersetzlicher sozialer Einrichtungen, die Caritas wird zum leidenschaftlichen Anwalt der an den Rand Gedrängten und zum Aushängeschild der Diözese. Dass im Caritas-Präsidenten Franz Küberl der wohl einflussreichste Laie Österreichs heranwachsen konnte, ist Bischof Webers neidloser Förderung zu danken, die ihm Raum zur Entfaltung gab.
In einer Zeit tiefer Depression wurde dem Grazer Bischof der Vorsitz in der Österreichischen Bischofskonferenz aufgebürdet. Die Causa Groer - der Kardinal schweigt zu Missbrauchsvorwürfen - endete mit dem Rückzug des Wiener Erzbischofs. In der Bischofskonferenz gab es unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten über die Linie der österreichischen Kirche, Medien weideten sich an der Selbstzerfleischung, längst überwunden geglaubte Pfaffenklischees lebten auf und führten zu einer hausgemachten Austrittswelle aus der Kirche. Da wird der Gendarmensohn aus einem Grazer Arbeiterbezirk zum Troubleshooter und meisterte diese Krise mit einem genialen Schachzug: Er initiierte den "Dialog für Österreich", in dem die Anliegen des Kirchen-Volksbegehrens, einer Initiative reformfreudiger, besorgter und zorniger Christinnen und Christen, aufgegriffen werden, und wo die Stimmung völlig umschlug; auf dem Salzburger Delegiertentag 1998 sah man wieder lachende, hoffnungsvolle Gesichter. Da er kurz zuvor den Vorsitz in der Bischofskonferenz abgegeben hatte, ist ihm das spätere Einschlafen dieses Reformprozesses nicht anzulasten.
Der Zeit seines Wirkens als Bischof in einfachen Verhältnissen lebende leutselige Mann aus dem Volk, der als "Bruder Bischof" die Herzen eroberte, aber darüber nie seinen geistlichen Anspruch verriet, der Pfarrer im bischöflichen Ornat und der nachdenkliche Mahner, der seine Möglichkeiten realistisch einschätzte, hat bei mindestens zwei Generationen gleichsam ein Urbild, einen Archtetyp von Bischof geprägt, inmitten der Menschenmassen herzlich lachend, Zutrauen weckend, mit offenen Armen auf die Menschen zugehend. Das wird in erster Linie von ihm bleiben, daran wird sein Nachfolger im Amte gemessen werden - und auch zu tragen haben.
So dürfte es sich (bei allem Ärger über die Vorgehensweise) als eine kluge Entscheidung Roms erweisen, mit Bischof Egon Kapellari einen Mann bestellt zu haben, der selbst bereits zwei Jahrzehnte eine Diözese geleitet und ein eigenes Profil entwickelt hat.
Karl Mittlinger ist Direktor des katholischen Bildungshauses Mariatrost in Graz.
Was bleibt von Egon Kapellari?
Am Beginn seiner Amtszeit stand eine Handlung von Symbolwert. 54 Jahre nach der Verhüllung des Boeckl-Freskos im Dom zu Maria Saal ordnete der frisch ernannte Bischof dessen Freilegung an. Das Gemälde, das "Jesu Gang über den See Genezareth" darstellen sollte, hatte 1928 einen Sturm der Entrüstung entfacht, da man in den Gesichtszügen des heiligen Petrus Lenin zu erkennen glaubte. Mit der Aufdeckung des Freskos war Herbert Boeckl auch in seiner Heimat rehabilitiert und mit ihm in gewisser Weise die gesamte Moderne.
Das Maria Saaler Fresko kann zugleich als Sinnbild für die Unmöglichkeit von Egon Kapellaris Kärntner Mission genommen werden. Sein 20-jähriges Wirken im Spannungsfeld zwischen Aufklärung und Seelsorge gleicht nämlich einem waghalsigen "Gang über den Wörthersee", bei dem sich der Bischof immer wieder nasse Füße holte, aber nie drohte unterzugehen.
Neben dem traditionellen Ressentiment gegenüber der zeitgenössischen Kunst war Kapellari im Land der Karantanen noch mit zwei weiteren konfrontiert: jenem gegenüber der slowenischen Minderheit und dem gegenüber der Kirche selbst. Glaubt man Michael Maier, seinem langjährigen Weggefährten als Generalsekretär der Katholischen Aktion und Chefredakteur der örtlichen Kirchenzeitung, dann ist Kärnten bis heute "ein heidnisches Land" geblieben.
Sein hoher Respekt vor dem Amt, den er auch für sich selbst einforderte, hat Kapellari stets den Dialog suchen lassen, was ihm von Kärntens führenden Politikern die gute Nachrede eines "Brückenbauers" eintrug.
Diese kühne These darf zumindest für das politische Establishment ernst genommen werden. Ausfälle gegen die Kirche gehörten hier nämlich auch nach dem Krieg zum guten "nationalen" Ton, sowohl in der Ära des "höhergradigen Hitlerjungen" Leopold Wagner als auch unter einem Landeshauptmann Haider.
Vor allem der nach eigenen Worten "christlich eingestellte" FP-Chef pflegte die antiklerikale Provokation, nicht nur am Aschermittwoch, wenn Bischof Kapellari zum Gottesdienst und Künstlerempfang ins Bischofshaus lud, sondern auch bei diversen Sonnwendfeiern. Während auf deutschen Bergeshöhen gegen "windische Messen" gepoltert wurde, spielte der Bischof im Stillen Löschmeister. Sein hoher Respekt vor dem Amt, den er auch für sich selbst einforderte, hat Kapellari aber stets den Dialog suchen lassen, was ihm von Kärntens führenden Politikern die gute Nachrede eines "Brückenbauers" eintrug.
Wunder durch spröden Realismus
Manche sahen in seiner Kooperationsbereitschaft aber auch eine Schwäche, die auf allzu großer Angst vor öffentlichen Konflikten beruhte. Ein hemdsärmeliger Don Camillo war der gebürtige Leobner tatsächlich nie. Auch kein Don Quijote, der es mit Bärentaler Windmühlen aufgenommen hätte. Aber sein etwas spröder Sinn für Realismus hat in Kärnten so manches kleine Wunder bewirkt.
Während vor ihm jeglicher Versuch der kirchlichen Selbstdarstellung von der herrschenden Politik unterdrückt wurde, erlebte seine Ära eine Reihe von glanzvollen Großveranstaltungen: das Hemma-Jubiläum samt Papstbesuch 1988, die erste (inoffizielle) Landesausstellung im Stift St. Paul oder zuletzt die Schau "Ich - Gegenüber" auf der runderneuerten Straßburg. Dass im Zuge der Hemma-Feiern eine Debatte darüber entflammte, ob die Stifterin des Gurker Domes eine Kärntner oder eine slowenische Heilige sei, wirft ein bezeichnendes Licht auf das kulturelle Klima im Lande.
Zu dessen Verbesserung hat Kapellari maßgeblich beigetragen. Am 1. Jänner 1982, dem Todestag seines Vorgängers Joseph Köstner, hatte Kapellari erstmals mit einer slowenischen Radioansprache aufhorchen lassen. Zehn Jahre später konnte der Hüter von rund 470.000 katholischen Seelen in einem "Hirtenwort" feststellen, dass "Konflikte in Südkärntner Pfarren betreffend das Ausmaß der deutschen und der slowenischen Sprache bei gottesdienstlichen Handlungen seltener geworden sind".
An den "heidnischen" Vorbehalten gegenüber dem Klerus konnte auch Kapellari wenig ändern. Wie jede andere Diözese des Landes litt auch die seine unter den jüngsten Heimsuchungen der österreichischen Kirche. Kapellaris bewusster Verzicht auf Popularität - die Treue zu Papst und Lehramt war dem gelernten Juristen stets wichtiger - machte die Situation nicht einfacher. Kirchenaustritte, Überalterung des Klerus sowie ständige Finanzkrisen - das Budget der Diözese entspricht gerade jenem des Klagenfurter Stadttheaters - waren die unausweichliche Folge.
Statt Volkstümlichkeit verlieh Kapellari seinem Amt ein intellektuelles Format, das zwar die Landesgrenzen sprengte, aber gerade dadurch Frischluft ins Land brachte. Seine Bücher über Kunst und Liturgie (zuletzt: "Aber Bleibendes stiften die Dichter", vgl. furche 9/01, Seite 6), die Gründung der St. Georgener Gespräche sowie zahlreiche von zeitgenössischen Künstlern gestaltete Kirchen sind Zeichen eines aufklärerischen Bemühens, das hin und wieder auch mit sich selbst in Konflikt geraten konnte.
Als die FPÖ im Zuge des letzten Landtagswahlkampfes gegen den Künstler Cornelius Kolig zu Felde zog - dieser hatte den Auftrag erhalten, die von Nazis zerstörten Fresken seines Großvaters im Kärntner Landhaus zu revitalisieren - hüllte sich der Bischof lange Zeit in Schweigen. Nach Fertigstellung des Werkes entschied er sich - trotz heftigsten Gegenwind eines Wiener Kleinformates - schließlich doch zum demonstrativen Besuch des Kolig-Saales und sanktionierte damit in aller Öffentlichkeit, was die FPÖ als "Fäkalkunst" und "Religionsschändung" diffamiert hatte. Jahre zuvor hatte sich der Kunstbischof in einer Kärntner Galerie über ein Gemälde von Cornelius Kolig mokiert, da dieses mit seinem Titel ("Überdüngt") die Schönheit der dargestellten Löwenzahnwiese konterkarierte. Noch vor kurzem hing es, zu einem guten Preis erstanden, in Kapellaris Klagenfurter Residenz.
In einem Interview sagte der Bischof einmal, man müsse "nicht brüllen, um deutlich zu sein". In Kärnten werden seine leisen Worte noch lange nachklingen. Denn Bleibendes stiften eben nicht nur die Dichter.
Erwin Hirtenfelder ist Kulturredakteur der "Kleinen Zeitung" in Klagenfurt.
Bischofs-Rochade
Dass der Grazer Bischof Johann Weber bald abgelöst werden würde, war klar, seit vor einigen Wochen Webers Rücktrittsansuchen an die Öffentlichkeit drang. Den Transfer des Gurker Hirten Egon Kapellari nach Graz prophezeiten hingegen nur wenige. Seit 14. März ist Kapellari nun steirischer Bischof; seine bisherige Diözese leitet er bis zur Bestellung eines Nachfolgers als Administrator weiter.
DIE FURCHE bat - anlässlich des vollzogenen (Graz-Seckau) und des bevorstehenden (Gurk-Klagenfurt) Bischofswechsels - zwei Kenner der Personen um eine Bilanz der jeweiligen Bischofsära. (ofri)