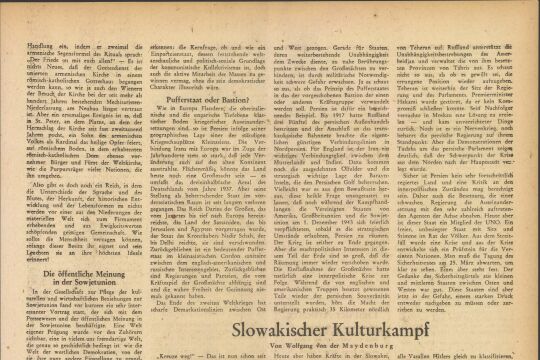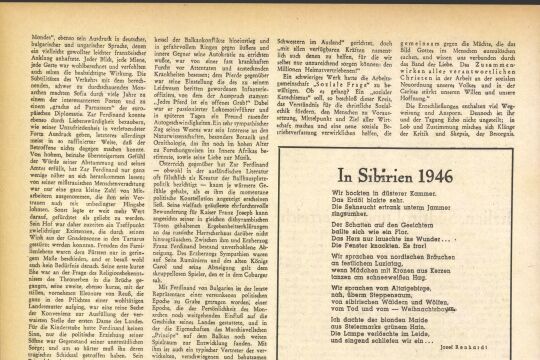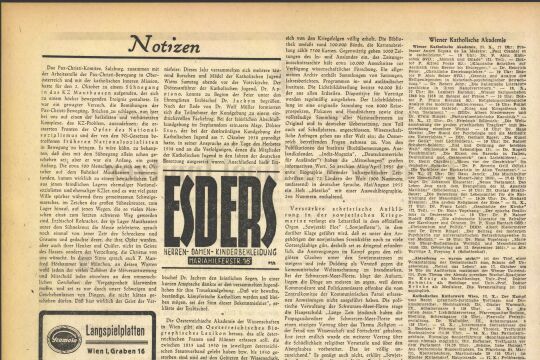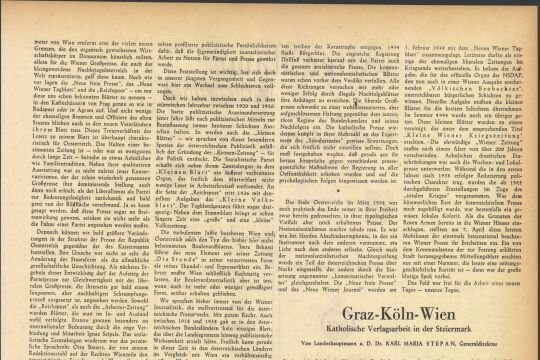Katholische Kirche 1945: Augenblicke mit weniger Mittelmaß
1945 markierte auch für die katholische Kirche eine Zäsur: Die kirchenfeindliche NS-Herrschaft war zu Ende. Aber es galt auch, parteipolitischen Schutt der Zwischenkriegszeit wegzuräumen. Und vieles neu zu denken.
1945 markierte auch für die katholische Kirche eine Zäsur: Die kirchenfeindliche NS-Herrschaft war zu Ende. Aber es galt auch, parteipolitischen Schutt der Zwischenkriegszeit wegzuräumen. Und vieles neu zu denken.
Der Stephansdom, der in den letzten Kriegstagen 1945 ein Raub der Flammen wurde, kann auch als Symbol für die Lage der katholischen Kirche verstanden werden: Sieben Jahre NS-Diktatur waren auch für die Kirche eine schwere Zeit. Beim „Anschluss“ 1938, wo die Bischöfe zwischen leiser Ablehnung der neuen Herren und anbiedernden Versuchen, einen lebbaren Status quo für die Kirche zu perpetuieren, lavierten (inklusive des unglückseligen „Heil Hitler“ Kardinal Innitzers unter der Bischofs-Erklärung zum „Anschluss“ ), gab es noch Hoffnung. Diese zerschlug sich schnell: Die Auflösung der konfessionellen Schulen, der theologischen Fakultäten oder die Abschaffung des Religionsunterrichts waren Zeichen der kirchenfeindlichen Politik des Regimes. Viele Priester wurden drangsaliert und kamen auch in die KZs.
Aber auch Ballast der Zwischenkriegszeit lastete schwer: Die politische Ehe der katholischen Kirche mit der Christlich-Sozialen Partei und den Machthabern des Ständestaates hatte zur tiefen Kluft mit der sozialdemokratisch dominierten Arbeiterschaft geführt. Erst das gemeinsame Schicksal von „schwarzen“ und „roten“ Internierten in den NS-Lagern wurde eine prägende Erfahrung, die auch auf die Kirche rückwirkte.
Einer der so „Bekehrten“ war der damals 73-jährige Friedrich Funder, bis 1938 als Chefredakteur der christlich-sozialen Reichspost ein Exponent des kirchlich-parteilichen Lagers, der im Dezember 1945 mit der Gründung der FURCHE Wegweisendes schuf. Sein – in seinem Testament 1959 festgehaltenes – Credo für diese Zeitung lautete: „Klare katholische Gesinnung, auf die Zusammenarbeit der gläubigen Christen in liebevoller Haltung auch gegenüber den getrennten christlichen Brüdern bedacht, aufgeschlossen gegenüber den seelischen und leiblichen Bedürfnissen und berechtigten Lebensansprüchen der arbeitenden […] Volksschichten, mutig stets zu einem freien Wort bereitstehend, wo es gilt, Träge, Kurzsichtige in den eigenen Reihen zu Aktivität und Vorwärtsschreiten anzuspornen – nicht zuletzt in strenger Unabhängigkeit von jeder politischen Partei […] der Gerechtigkeit und der christlichen Liebe zu dienen.“
Das war auch im kirchlichen Blick ein völlig neuer Zugang, wie er vice versa analog zu finden war: Die in den letzten Apriltagen 1945 gegründete Österreichische Volkspartei, hatte das Wort „christlich“ nicht mehr im Namen – auch von dieser Seite ein Emanzipationsversuch, der die belastende Symbiose von Kirche und Partei hinter sich ließ.
Doch 1945 begann auch für die Institution katholische Kirche die Bewährungsprobe des Wiederaufbaus. Die katholische Hierarchie hatte in den Jahren der NS-Diktatur überwintert – nicht immer an vorderster Front der Mutigen. Aus der Biografie des 1943 hingerichteten Wehrdienstverweigerers Franz Jägerstätter etwa ist bekannt, dass sich ein Widerständler wie der heutige Selige keineswegs auf die Unterstützung der Kirche verlassen konnte.
Im September 1945 verfasste der österreichische Episkopat den ersten Hirtenbrief nach Kriegsende. Die TV-Journalistin und Historikerin Eva Maria Kaiser hat in ihrer Studie „Hitlers Jünger und Gottes Hirten“ (Böhlau 2018) dieses Dokument analysiert. Sie konstatiert, dass darin der Nationalsozialismus expressis verbis nicht angesprochen wird und dass kein klarer Schnitt zu den Tätern gemacht wurde, sondern schnell, nach Kaisers Befund: allzu schnell, die Brücken zu den „Ehemaligen“ errichtet wurden. Die Opfer des NS-Regimes. Nicht zuletzt viele Priester seien dagegen, so Kaiser, von den Kirchenoberen sträflich schlecht behandelt worden, mitunter gar wie Parias.
Aufbruch katholischer Intellektueller
Auf der anderen Seite war der geistige Wiederaufbau 1945 schon vorbereitet. Bereits in der Zwischenkriegszeit hatte sich – analog zur von Romano Guardini in Deutschland inspirierten Jugendbewegung – der „Bund Neuland“ als kirchliche Aufbruchsbewegung gebildet; viele Große des Nachkriegskatholizismus waren „Neuländer“, nicht zuletzt ein junger Priester namens Franz König, der ab 1956 als Erzbischof von Wien Geschichte schreiben sollte.
In den Kriegsjahren waren der Wiener Seelsorgeamtsleiter Karl Rudolf und der Pastoraltheologe Michael Pfliegler Wegbereiter der Nachkriegskirche, ein junger Jesuit namens Karl Rahner war bis 1944 in Wien bei den Theologischen Kursen tätig – die Innsbrucker Fakultät war ja aufgelöst.
Und rund um die Hochschulseelsorger Karl Strobl und Otto Mauer scharten sich in Wien Neuländer, darunter der spätere Begründer der Judaistik Kurt Schubert (1923–2007) oder die nachmalige Doyenne der Zeitgeschichte Erika Weinzierl (1925–2014) sowie der heute 95-jährige Biochemiker Hans Tuppy, der 1945 zu den Gründern der Österreichischen Hochschülerschaft gehörte. Diese jungen Leute gehörten zu den intellektuellen Vordenker(inne)n aus dem katholischen Milieu. Auch Kriegsheimkehrer stießen bald dazu wie der dann langjährige FURCHE-Redakteur Friedrich Heer (1916–83) oder der nachmalige Presse-Chef Otto Schulmeister (1916–2001), der mit Otto Mauer ab 1947 die Monatsschrift Wort und Wahrheit, neben der FURCHE das zweite wesentliche Organ katholischer Intellektualität in der Nachkriegszeit, herausgab.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!