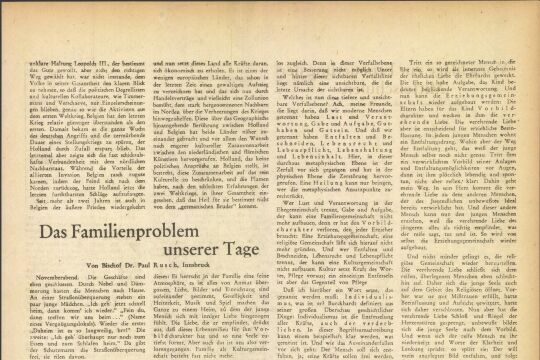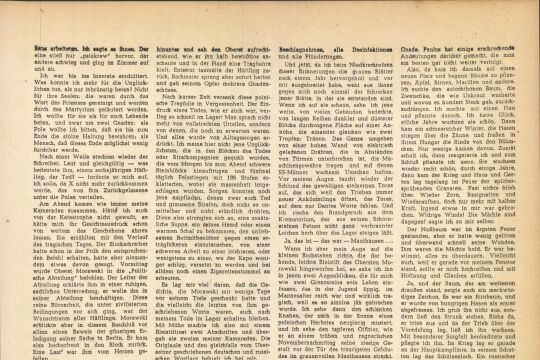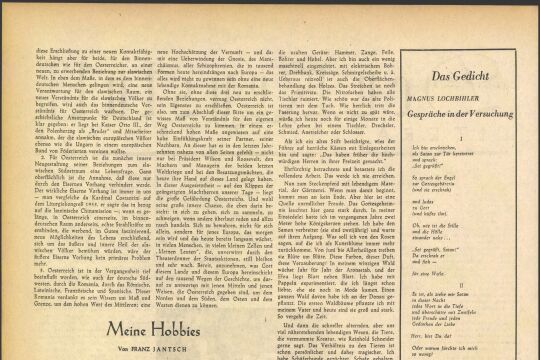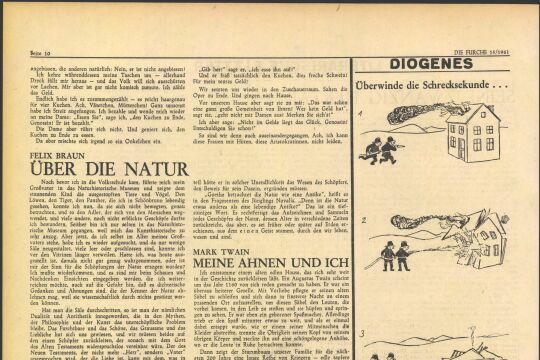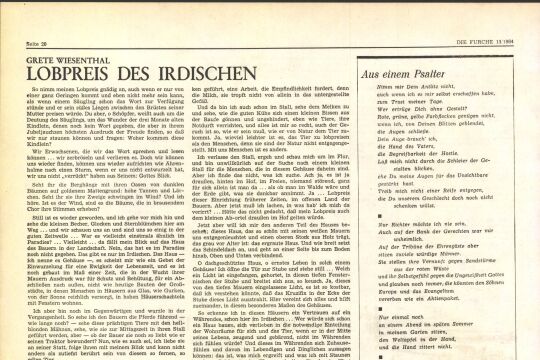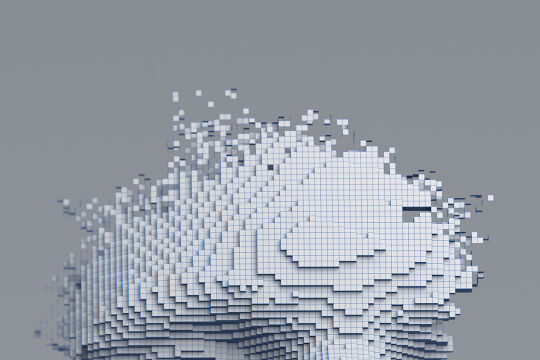Den Garten essen
FOKUS
Andreas Weber: "Wir lieben zu wenig"
„Fressen und gefressen werden“: Dieses wenig charmante Naturgesetz verliert bei Andreas Weber seinen Schrecken. Der deutsche Biologe über die Freude am essbaren Garten, erotische Ökologie und die Vegetation als prosoziales Vorbild.
„Fressen und gefressen werden“: Dieses wenig charmante Naturgesetz verliert bei Andreas Weber seinen Schrecken. Der deutsche Biologe über die Freude am essbaren Garten, erotische Ökologie und die Vegetation als prosoziales Vorbild.
Wie man als Naturwissenschafter Biologie, Philosophie und Poesie verbinden kann, zeigt Andreas Weber mit seinen vielbeachteten „literarischen Sachbüchern“. Der gebürtige Hamburger setzt sich dafür ein, den mechanistischen Blick auf organische Phänomene zu überwinden und den technologisch hochtrabenden Zukunftsvisionen ein attraktives Konzept von „Lebendigkeit“ entgegenzustellen. Die FURCHE bat den Autor, den es immer wieder zur Gemeinschaft und Gartenarbeit in ein ligurisches Dorf zieht, zum Interview.
DIE FURCHE: Sie haben Ihre Doktorarbeit über „Natur als Bedeutung“ geschrieben. Welche Bedeutung haben so gesehen die essbaren Pflanzen?
Andreas Weber: Sie zeigen uns, dass die lebende Welt als solche grundsätzlich essbar ist. Die Biosphäre ist nicht eine Ansammlung von toten Dingen, sondern atmender, fühlender Körper. Ein Körper wie meiner auch. In Wirklichkeit bin ich ja Teil dieser Biosphäre, die mich mit ihrem Körper ernährt. Und ich ernähre sie durch das, was ich ausatme, ausscheide, einst nach meinem Tod gewesen sein werde. Leben heißt, seine Existenz in jedem Moment geschenkt zu erhalten, ganz physisch und biologisch. Und mit jedem Atemzug ein Geschenk ans Leben zu machen. Wenn ich ein paar zarte Lindenblätter in den Mund nehme oder eine Karotte aus der feuchten Erde ziehe, komme ich unmittelbar mit dem Geschenk des Lebens in Kontakt.
DIE FURCHE: Sie leben in Berlin und in Varese Ligure in Italien. Die Gartenerfahrungen müssen da sehr unterschiedlich sein ...
Weber: Ich habe an beiden Orten keinen Garten mehr, den ich selbst bestelle. In Italien halte ich mich oft in der kleinen Allmende entlang des Dorfbachs auf. Hier können die Menschen sich einen Garten zuteilen lassen. Meist Ältere bauen hier Gemüse an, das dann auch in den kleinen Geschäften im Dorf verkauft wird – wunderbar bitteren Wintersalat zum Beispiel oder ganz frische Tomaten, mit garantiert null Kilometer Lieferweg. Ein Freund hat dort einen großen Gemüsegarten mit ein paar Heuwiesen und Getreidefeldern. Dort helfe ich im Sommer viel mit – und komme nie ohne einen großen Korb „essbarer Landschaft“ nach Hause.
DIE FURCHE: Haben Sie zu manchen dieser essbaren Pflanzen eine besondere Beziehung?
Weber: Ich habe zu allen Pflanzen die gleiche tiefe Beziehung. Ich esse sie dann mit dem liebevollen Blick, in der zärtlichen Berührung meiner Haut. Der amerikanische Dichter Ralph Waldo Emerson schrieb einmal, seine Augen würden das Grün der bewaldeten Berghänge gegenüber „knabbern“ – so wie ein Reh die frischen Fichtenschösslinge knabbert. Als Kind habe ich Giersch im Terrarium gezüchtet, weil er mir so gut gefiel. Ich habe die Pflanzen auf der anderen Straßenseite ausgegraben. Aber ich wusste nicht einmal, dass er essbar ist. Etwas später hatte ich einen Gemüsegarten, den ich als Kind selbst bewirtschaftete. Ich legte die Beete neu an, aber es gab auf dem Areal schon drei Reihen Erdbeeren, die ich nur freilegen musste. Bei frischen Erdbeeren muss ich immer an die Amsel denken, die sich auch sehr für sie interessierte. Ich erinnere mich, dass sie öfters auf dem Griff meiner Schaufel saß und schimpfte, wenn ich eine Pause beim Umstechen machte. Vielleicht schielte sie auf die Regenwürmer, die beim Umgraben zum Vorschein kamen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!