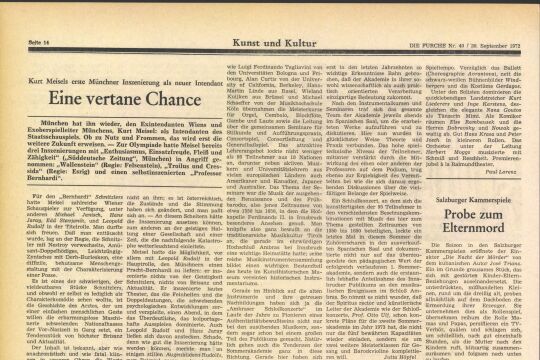Arthur Schnitzler bezeichnete seinen "Professor Bernhardi“ als Charakterkomödie. In Dieter Giesings Regie am Burgtheater sind weder komische Aspekte noch Charaktere zu sehen.
Auf die Frage, was bei "Professor Bernhardi“ die von Schnitzler selbst deklarierte Komödie ausmache, antwortete Regisseur Dieter Giesing in einem Interview, dass in den lächerlichen Winkelzügen der Figuren zugunsten tagespolitischer und privater Interessen eine Art Komik entstehe. Tatsächlich hat Schnitzler geradezu minutiös die unterschiedlichen politischen Positionen und Ideologien im Wien des beginnenden 20. Jahrhunderts auf der Ebene der Ärzteschaft verhandelt und zugleich abstrahiert. Damit ist seine Geschichte eines Konflikts zwischen humanitärem Handeln und religiösem Gehorsam, der gleichsam wellenförmig aberwitzige Kreise bis auf höchste politische Ebenen zieht, bis heute hochaktuell.
In Giesings kalter Inszenierung blitzt zwar hie und da Joachim Meyerhoffs (Bernhardi) komisches Talent durch, ansonsten aber bleibt der Regie-Vorsatz nur graue Theorie. Seltsam unentschlossen wirkt Giesings Arbeit, wie eine Modellinszenierung, allerdings mit Echtheitsanspruch. Karl-Ernst Herrmanns weiße Schrägbühne vor dem Eisernen Vorhang bringt die Akteure ganz nah ans Publikum, wo sie dann aber umso entfernter erscheinen.
Inszenatorisch nicht viel beigetragen
Eine gleißend helles Licht verbreitende Neonröhre verbindet eine Loge aus dem Zuschauerraum mit der Bühne - auch wenn knapp hundert Jahre seit der Uraufführung vergangen sind, ist es nicht heute genau wie damals, als "Strebertum, Parlamentarismus, menschliche Gemeinheit - Politik mit einem Wort“ aus "Fällen“ Affären machten und umgekehrt? Sollten es diese Worte Schnitzlers sein, die Giesing vermitteln möchte, so hat er inszenatorisch nicht allzu viel beigetragen. Ein Stück wie "Professor Bernhardi“ lebt von seinen gelungenen Figurenkonstellationen, dramaturgischen Kniffen und exzellenten Dialogen auch ohne große Regiehand.
In einem Punkt allerdings irrt Giesings Interpretation entscheidend und deckt den Widerspruch in der szenischen Umsetzung selbst auf: An der Decke des Bühnenbildes hängt die österreichische Fahne. Wie aber - außer historisch betrachtet - kann die Anspielung auf Österreich noch funktionieren, wo doch - wie Giesing selbst betont - der allgemeingültige Konflikt fern jeglichen Österreichertums zählt? Da funktioniere ein "Bernhardi“ genauso wie ein Stück von Tschechow, so Giesing. Mitnichten. Denn dass über das Idiom auch Mentalität vermittelt wird, scheint Giesing (oder waren es direktoriale Entscheidungen?) in seiner Besetzungspolitik komplett ignoriert zu haben.
Auch wenn Meyerhoff über großes schauspielerisches Talent verfügt, einen Bernhardi will man dem Norddeutschen nicht recht abnehmen. In seiner überaus geführten, kontrollierten Art des Spielens und Sprechens gibt er zwar den korrekten Menschenfreund und Mediziner, den überaus klugen und manchmal eigensinnigen Direktor der Wiener Privatklinik, den Wiener Juden aber, dem seine Widersacher Schaden zufügen, sieht man in keinem Augenblick. Auch die Schar seiner Kollegen ist großteils mit feschen, adretten Herren besetzt, die eher an Frankfurter Banker denken lassen als an Wiener Ärzte.
Diskussion über Theaterpolitik gefordert
Allein Roland Koch als souveräner Widersacher Dr. Ebenwald, Caroline Peters als überlegte Prof. Cyprian, Udo Samel als loyaler Kollege Pflugfelder, Branko Samarovski als hoher Beamter und Nicholas Ofczarek als Unterrichtsminister Flint lassen in dem an Personen reichen Stück vermuten, wie facettenreich diese Inszenierung hätte werden können. Denn Schnitzlers Kritik ist eine Kritik an den Verhältnissen, die selbst paradigmatisch zu verstehen ist. Österreich ist ein Exempel für die Welt. Aber wenn das Beispiel falsch erzählt wird, verliert es sowohl an Kraft als auch an Wirksamkeit.
Zwischen die Premieren-Bravi mischten sich Buh-Rufe, die sich in diesem Fall nicht allein als nationaler Chauvinismus abtun lassen können, sondern - ernst genommen - auch als Forderung nach einer differenzierten Diskussion über österreichische Theaterpolitik zu deuten sind.