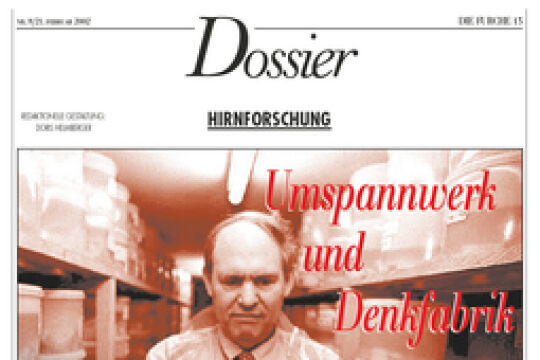Die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) ist das wichtigste Untersuchungs-verfahren der Neurowissenschaften. Gedanken lesen kann man damit noch nicht.
Bunte Bilder von Hirnschnitten gehören fest zu den Publikationen der Neuroforschung. In grellen Farben strahlen Hippocampus, Amygdala und Co. zwischen ansonsten trockenen Texten hervor. Neben dem lockernden Layout-Effekt transportieren die Aufnahmen wertvolle Informationen, sofern man sie zu lesen weiß. Generiert am Computertomografen, „Hirnscanner“ genannt, geben sie detaillierte Einblicke in die Abläufe des Gehirns. Die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) hat sich als wichtigste Untersuchungsmethode der Hirnforschung etabliert.
Das Verfahren nutzt den magnetischen Drehimpuls von (meist) Wasserstoffatomen, ihren Kernspin. Dazu wird der Patient in die Röhre des Gerätes geschoben. Starke Magnetfelder richten die Atome im Körper parallel zueinander aus. Anschließend lenkt man die Atome mittels Radiowellen kurzzeitig ab. Wenn sie sich dann wieder in den parallelen Zustand zurückorientieren, geben sie Energie ab, die vom Scanner als Signal detektierbar ist.
Sauerstoff zeigt die Aktivität im Gehirn an
Je nach Untersuchungszweck setzt man die untersuchte Person gleichzeitig bestimmten Reizen aus. Beispielsweise muss sie Rechenaufgaben lösen oder an etwas Konkretes denken. Was sich dabei wo und in welcher Intensität im Hirn abspielt, wird vom Scanner erfasst und mittels einer Software ausgewertet und in diese Bilder umgerechnet. Durch mehrere hintereinander angeordnete Magnetfelder unterschiedlicher Stärke lassen sich die untersuchten Bereiche des Gehirns sehr genau abgrenzen.
Die Aktivität der Nervenzellen wird dabei indirekt gemessen. Und zwar über das Verhältnis von sauerstoffarmen zu sauerstoffreichem Blut. Aktive Gehirnareale benötigen mehr Blut als inaktive. Der plötzlich veränderte Sauerstoffgehalt bewirkt eine Veränderung der magnetischen Eigenschaften, die das fMRT-Gerät als Signal registriert. Bei reduziertem Blutdurchfluss, etwa unter Narkose, ist fMRT deshalb nicht anwendbar. Farben sucht man im Hirn übrigens vergebens. Die bunt markierten Areale sind das Resultat der Software und dienen der Visualisierung.
Die fMRT zeichnet sich durch eine hohe räumliche Auflösung im Millimeterbereich aus, ist aber mit einer Sekunde Reaktionszeit vergleichsweise langsam. Das klassische EEG (Elektro-Enzephalografie) misst zwar mit hoher zeitlicher Auflösung von einigen Tausendstel Sekunden. Doch dafür erfasst sie nur ganze Zellverbünde. Man braucht also in der Hirnforschung beide Methoden (und noch einige andere). Die spektakuläreren Ergebnisse werden meist im Hirnscanner erzielt. Manche erhoffen sich von der neuen Technik sogar die Verwirklichung eines alten Menschheitstraums – fremde Gedanken zu lesen.
So ist es dem US-Neurowissenschaftler Jack Gallant in einem Experiment gelungen, mit einer bis zu 92-prozentigen Trefferquote nur aufgrund der fMRT-Bilder zu bestimmen, welche Fotos sich ein Proband gerade ansieht. Der Wissenschaftler zeigte den im Hirnscanner liegenden Teilnehmern erst 1750 Bilder mit unterschiedlichen Motiven. Aus den fMRT-Daten errechnete ein Computerprogramm ein dreidimensionales Muster. Dann bekamen die Testpersonen 120 neue Bilder vorgelegt. Das Programm erkannte daraufhin mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig, welches Bild der Proband gerade betrachtete. Mit Gedankenlesen hat das nichts zu tun, mehr mit der mathematischen Auswertung von Mustern. Bestimmte Hirnstrukturen werden statistisch mit kognitiven Funktionen beim Verarbeiten visueller Stimuli korreliert. Als Ergebnis erhält man einen Wahrscheinlichkeitswert. Doch auch das ist beachtlich und verspricht Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel in der Traumforschung. Den Wachkoma-Patienten könnte es dann vielleicht möglich sein, per Hirnmuster mit ihrer Außenwelt zu kommunizieren.