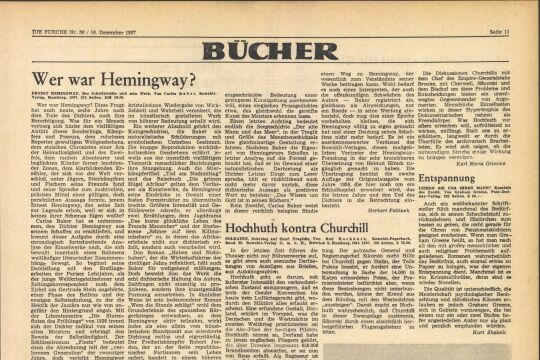Jäger eines Jägers schoß einen Bock
Der „Tod eines Jägers“ von Rolf Hochhuth wurde nicht uraufgeführt, sondern zu Grabe getragen. Alle Beteiligten haben die Katastrophe kommen gesehen; noch bevor sie da war, schoben einige einander die Schuld in die Schuhe. Hochhuth selbst reiste vor der Premiere ab. Doch könnte sich der „Tod eines Jägers“ einem Phönix gleich aus der Asche der Total verrisse zu einem amerikanischen Bühnenerfolg erheben. Was’ diesseits des Atlantik als taktlos und peinlich empfunden wird, die unbarmherzige Demontage des Idols Hemingway, entspricht in den USA nämlich genau der dort gerade gängigen Welle.
Der „Tod eines Jägers“ von Rolf Hochhuth wurde nicht uraufgeführt, sondern zu Grabe getragen. Alle Beteiligten haben die Katastrophe kommen gesehen; noch bevor sie da war, schoben einige einander die Schuld in die Schuhe. Hochhuth selbst reiste vor der Premiere ab. Doch könnte sich der „Tod eines Jägers“ einem Phönix gleich aus der Asche der Total verrisse zu einem amerikanischen Bühnenerfolg erheben. Was’ diesseits des Atlantik als taktlos und peinlich empfunden wird, die unbarmherzige Demontage des Idols Hemingway, entspricht in den USA nämlich genau der dort gerade gängigen Welle.
Wäre es nicht so, würde nicht Hemingway seit einiger Zeit von der gesamten amerikanischen Literaturkritik abgekanzelt und posthum fertiggemacht, könnte man Hochhuth glauben, daß es sich hier um das etwas danebengeratene Produkt seines Ringens mit einer weiteren Vaterfigur handelt. Aber die Deckung seines Stückinhaltes mit dem, was die amerikanische Literatur-Schickeria schreibt, legt die Vermutung nahe, daß der Verschleiß der drittenVaterfigur, die Hochhuth in die Schreibmaschine geriet, vor allem marktkonform erfolgte.
Er zeigt Hemingway in seinen letzten Stunden, einen mit sich selbst, mit seiner Vergangenheit und seinem Land abrechnenden Hemingway - wär’s wirklich Hemingway, wäre die Abrechnung imposant, aber da ja Hochhuth es ist, der, sozusagen eine literarische Handpuppe Hemingways in der Hand, diesen mit sich selber rechten und dabei vor nichts haltmachen läßt, entbehrt die Sache nicht eines Quantums Schäbigkeit. Mit Hemingway auf dem Höhepunkt seiner literarischen und sonstigen Virilität würde Hochhuth nicht einmal posthum fertig, also steckt er sich hinter den dementen, den früh vergreisten Hemingway und schlägt das Wrack, den alten Hemingway, dem „faschistischen“ jungen Hemingway um die Ohren.
Das Unangenehme an der Sache ist die entsetzliche Inferorität des Kritikers angesichts des Kritisierten, denkt man einen Augenblick an den Hemingway, der gelebt und geschrieben hat, schrumpft Rolf Hochhuth auf mikroskopisches Maß. Das Unangenehme ist der sich aufdrängende Verdacht, daß bei dieser Abrechnung mit Hemingway literarischer Potenzneid mitgespielt haben könnte.
Ein schwaches Stück also, ein über lange Strecken ärgerliches Stück, mit ein paar starken Momenten vielleicht- so wie es auf dem Papier gedruckt stand. Hätte man dem Text vertraut
(und einen Text, dem man nicht vertraut, soll man nicht spielen), hätte das Stück seine für Hochhuth typische Chance gehabt, Emotionen zu entfachen. Der Ärger, den er bereitet, ist ja nicht das Schlechteste an Hochhuth. Worüber man sich ärgert, dabei schläft man wenigstens sicher nicht ein. Ärger kann sehr produktiv sein. Aber der Text wurde nicht, zwecks Analyse durch das Publikum, diesem analytisch vorgetragen, sondern durch totale akustische Verfremdung vorenthalten. Was Bernhard Wicki als Hemingway sprach, war schlicht unverständlich. Deshalb ist es auch kaum möglich, die Qualität des mehrmaligen Umschreibens auf der Probe zu beurteilen.
Bernhard Wicki hat sich eine so perfekte Teuhnik angeeignet, in jeder Lautstärke, vor allem aber in den grö-
ßeren, Unverständliches von sich zu geben, daß man nicht auf Unvermögen, sondern auf ein Regiekonzept tippt. Er bewegt sich auch gar nicht wie ein müder, alter Mann, sondern zeitweise eher wie ein rasender Derwisch. Wüßte man nicht, wie’s ausgeht, würde man eher ein Ende mit Morii und Brand als einen Selbstmord erwarten. Die ganz interessante klinische Studie eines Hysterikers. Aber nicht eines Selbstmörders.
Dazwischen tritt gelegentlich Curd Jürgens im Jagdanzug auf und spricht Texte von Hemingway. Immerhin, ihn versteht man wenigstens einwandfrei. Ohne Kenntnis dessen, was da gespielt wurde, bevor der „Tod eines Jägers“ gespielt wurde, bleibt auch unerfindlich, was Regisseur Emst Haeusserman vorgeschwebt haben könnte, als er das Stück annahm. Da es ungerecht gewesen wäre, dem Bühnenbildner Günther Schneider- Siemssen eine Chance zu geben, wo niemand sonst eine hatte, und weil das Landestheater renoviert wird, hatte er Hemingways Wohn- und Sterbezimmer in den Mozarteum-Saal einzubauen. Über der Tür, durch die Hemingway die Szene betritt, erheben sich Orgelpfeifen, und Stuckengerin spenden ob der tragischen Handlung Trost. Würde Curd Jürgens nicht als „Papa Hemingway“, sondern als Tod aus dem „Jedermann“ auftreten - es wäre kein Stilbruch!