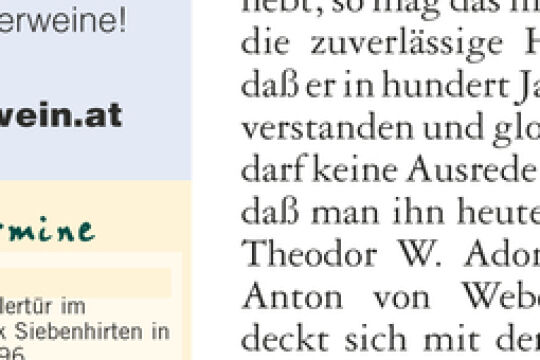"Peer Gynt" in der Auffassung Johann Kresniks in Salzburg.
Nein!" Dies soll der Überlieferung nach Henrik Ibsens letztes Wort vor seinem Tod gewesen sein. Die ganze nordische Morbidezza, wie sie die skandinavische Intelligenz im 19. Jahrhundert als enthüllenden und anklagenden Nihilismus gegen bürgerlichen Optimismus und Fortschrittlichkeit pflegte, ist in den Verwerfungen von Ibsens "Peer Gynt" gegenwärtig.
Johann Kresnik hat nun bei den Salzburger Festspielen auf der Perner-Insel in Hallein diesen "Peer Gynt" in Szene gesetzt: Mit einer Theaterpranke für große Szenen auf der einen Seite und altmodischem Agitprop-Theater auf der anderen, das in den neu eingefügten Texten bis zu Antiamerikanismen nichts auslässt, was nicht ideologisch ausschlachtbar ist. Was nicht notwendig wäre. Denn Ibsen wusste als großer Dekonstruktivist und Nihilist sehr wohl, dass die Würde des Menschen - Aufklärung hin oder her - zwar theoretisch unantastbar ist, aber täglich mit Füßen getreten wird.
Kresnik lässt die Schlüsselszene für Ibsens Gesamtwerk, jene, in der Peer eine Zwiebel häutet, zwar an der Rampe spielen, hat ihr aber viel zu wenig Gewicht beigemessen. "Bloß Häute, nur immer kleiner und kleiner." Der Kern der Zwiebel kommt nicht ans Licht: das bare Nichts.
An nichts hielt sich Kresnik in dieser Inszenierung genauer als an einen Brief Ibsens vor 1867: "...bin ich nicht imstande aufzubauen, so werde ich doch der Mann sein, alles um mich niederzureißen". So lässt er die Knochen aus allen Gebeinhäusern der Welt herbeikarren und ausstreuen, blechernen Zivilisationsmüll lautstark vom Himmel regnen und die Boote zur Überfahrt aus dem Schnürboden stürzen.
Eine opulente Inszenierung also auch. Nicht der geringste Tadel an Ensemble und Tänzern, an Peer in drei Personen Benjamin Höppner, Roland Renner und Erhard Marggraf, am Trollkönig von Wolfgang Michalek und an Peers Mutter Aase von Cornelia Kempers.
Die Bühne von Martin Zehetgruber zeigt eine zunächst grün überzogene Hügellandschaft u.a. mit Stalins, Nietzsches und Kennedys Gesichtern, die Kostüme stammen von Heide Kastler, die Musik, die den gelegentlich zähen Handlungsgang vorantreibt, von Serge Weber. Und Christoph Klimke schuf das Libretto. Im letzten Drittel der Aufführung fragt man sich, was noch komme. Denn das meiste war schon da.