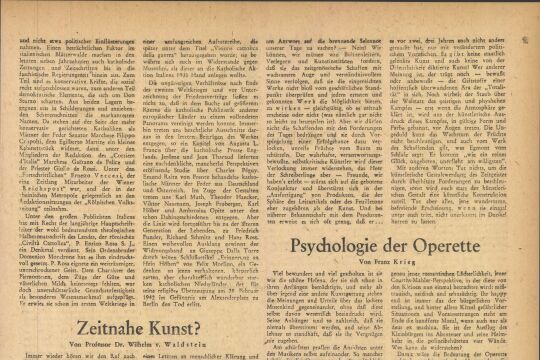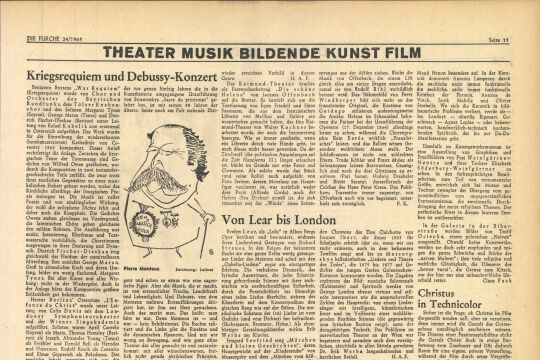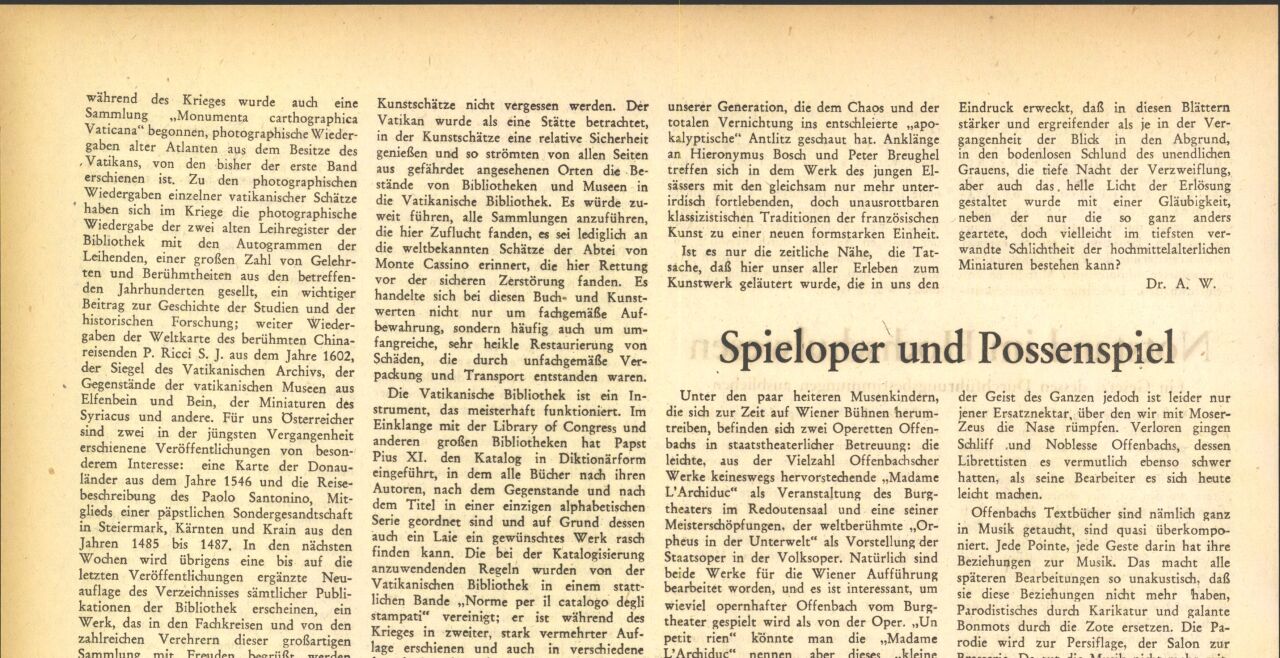
Unter den paar heiteren Musenkindern, die sich zur Zeit auf Wiener Bühnen herumtreiben, befinden sich zwei Operetten Offenbachs in staatstheaterlicher Betreuung: die leichte, aus der Vielzahl Offenbachscher Werke keineswegs hervorstechende „Madame L'Archiduc“ als Veranstaltung des Burgtheaters im Redoutensaal und eine seiner Meistersdiöpfungen. der weltberühmte „Orpheus in der Unterwelt“ als Vorstellung der Staatsoper in der Volksoper. Natürlich sind beide Werke für die Wiener Aufführung bearbeitet worden, und es ist interessant, um wieviel opernhafter Offenbach vom Burgtheater gespielt wird als von der Oper. „Un petit rien“ konnte man die „Madame L'Archiduc“ nennen, aber dieses „kleine Nichts“ wird mit soviel Grazie und Eleganz tragiert, daß Meister Jacques begeistert Bravo klatschen würde. Es gibt keinen toten Punkt in diesem sprühenden, fast substanzlosen Spielchen, das den Besucher zweieinhalb Stunden lang mit der Laune seines kultivierten Ubermuts überschüttet und damit seine an sich bescheidene Aufgabe restlos erfüllt.
Anders der „Orpheus“. Hier hat Offenbach im mythologischen Spiegel die moderne Gesellschaft parodiert. Die Transposition dieser Parodie auf die gegenwärtigen Zustände wäre der Sinn der Bearbeitung gewesen, die sich leider trotz Vermehrung der Schauplätze auf das Doppelte, in einer possenhaften Vergröberung erschöpft. Der Anspielungen gibt es viele, wenn auch keine originelle, der Anzüglichkeiten ebenso, wenn auch keine salonfähige; abgestandene Witze statt Humor, ungeschlachte Eindeutigkeiten statt Esprit. Regie und Ausstattung sind reich an köstlichen und „kostbaren“ Einfällen, die Kostüme an Pracht und Pikan-terien, dem Schlußcancan haftet sogar noch etwas vom Air des Originals an. Es wird viel gelacht und applaudiert, sogar bei offener Szene wie in einer Lehar-Operette — der Geist des Ganzen jedoch ist leider nur jener Ersatznektar, über den wir mit Moser-Zeus die Nase rümpfen. Verloren gingen
Schliff .und Noblesse Offenbachs, dessen Librettisten es vermutlich ebenso schwer hatten, als seine Bearbeiter es sich heute leicht machen.
Offenbachs Textbücher sind nämlich ganz in Musik getaucht, sind quasi überkomponiert. Jede Pointe, jede Geste darin hat ihre Beziehungen zur Musik. Das macht alle späteren Bearbeitungen so unakustisch, daß sie diese Beziehungen nicht mehr haben, Parodistisches durch Karikatur und galante Bonmots durch die Zote ersetzen. Die Parodie wird zur Persiflage, der Salon zur Brasserie. Da tut die Musik nicht mehr mit, die Eurydike mit einem Hauch Gluckschen Zaubers umgibt und noch im Liede des Styx, wie jeder echte Humor, unter Tränen lächelt. Daher bleibt sie hinter dem gesprochenen (nicht immer feinen) Wort zurück, wird zum Schatten des Hintergrundes, zur Dekoration, zum Pelzmantel auf unpassenden Schultern.
Gespielt wird in großer Form. Eine Eurydike, die -immerhin Offenbachschen Schimimer zu wahren weiß, ein tenoraler Kammersänger Orpheus, eine Aphrodite des Montmartre, ein Hades, mit dem auch seitens Zeus' nicht zu spassen ist, ein possierlich elegischer Styx und ein Operettenprofessor, wie er im Buch steht, freilich nicht in diesem, das sein Urautor Hector Cremieux wahrscheinlich glatt verleugnen würde. Die Szene aber beherrscht Moser-Zeus, der als olympischer Haushaltungsvorstand alle Lacher auf seiner Seite hat.
Offenbachs 1858 entstandener „Orpheus“, ein Welterfolg ohnegleichen, gibt hier nicht viel mehr als das notwendige Übel einer Vorlage ab, bildet quasi das Dadh, unter dem einige Etagen tiefer die Bearbeitungen gedeihen.