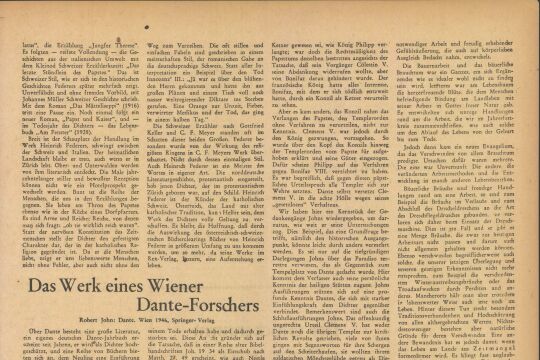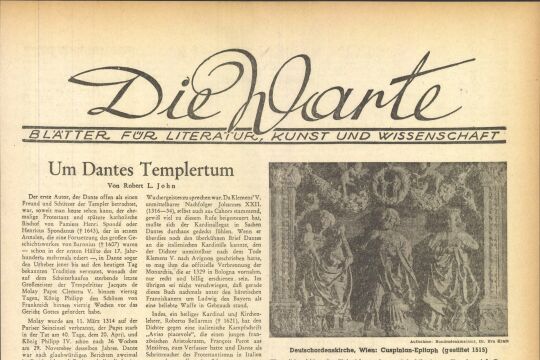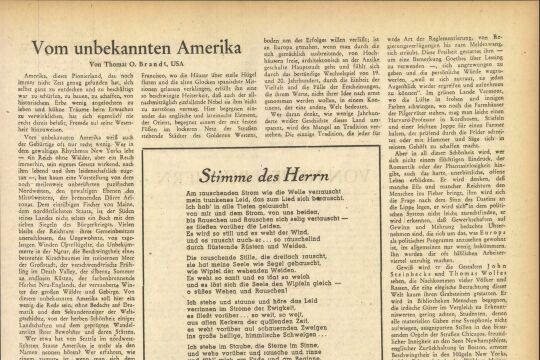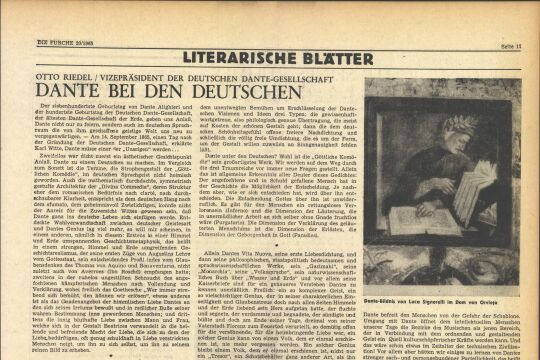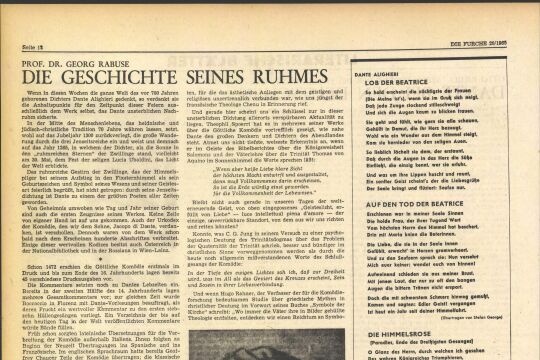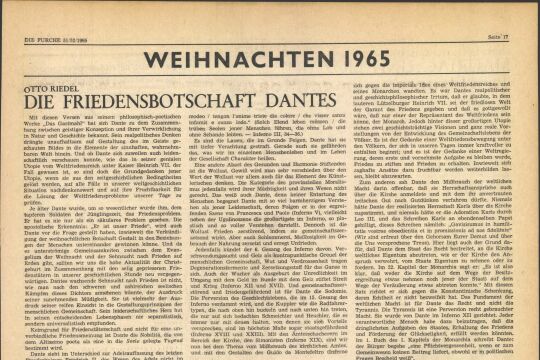Dantes Hölle: Wo die Teufel Namen haben
Zum 700. Geburtstag von Dante Alighieri. Teil 3.
Zum 700. Geburtstag von Dante Alighieri. Teil 3.
Sagen wir es rundheraus: Scheiße. Wer meint, ein Werk, das mit dem Non-plus-ultra-Zusatz „Göttlich“ versehen ist, sei porentief rein, liegt falsch; ganz eindeutig „merda“ liest, wer im Kapitel 18 von Dantes „Inferno“ ankommt. Mit diesem Wort lässt sich auch heute in Italien fluchen, und in „merda“ schwimmen Zuhälter und all jene, die anderen ihre Liebe vorgegaukelt haben. Dazu gehören, wie überall in Dantes Jenseits, mythische Figuren wie auch ausgesuchte Zeitgenossen, die ihre sichtbarste Lebensspur in Dantes Hölle hinterlassen haben: ein gewisser Venedico Caccianemico zum Beispiel, der seine Schwester an einen Marchese verschacherte. Was für ein Nachleben!
Ab der Mitte von Dantes Höllenreise wird es richtig deftig. Während zu Beginn noch abgeschlossene Kreise besichtigt wurden, erstrecken sich hier die wechselnden Landschaften über mehrere Kapitel, und manche Reisegenossen sind länger dabei, als Dante lieb ist. Klassische Teufel tauchen auf, sadistisches, geflügeltes und nicht besonders helles Personal der tiefen Hölle.
Ein Widerspruch scheint sich aufzutun: Welches Interesse sollten Teufel daran haben, in Gottes Auftrag Sünder aufs Grausamste zu bestrafen? Bei fortgesetzter Reise zeigt sich, dass es ihnen, denen Dante individuelle Züge verpasst, herzlich egal ist, wen sie auf die Zinken ihrer Gabeln bekommen: So muss Vergil seinen Schützling erst verstecken, bevor er mit dem Rudelführer der Teufel, unter Verweis auf Gottes Willen natürlich, freies Geleit ausverhandeln kann. So sind sie doch böse, durch und durch, „Calcabrina“, Trampelfuß, „Cagnazzo“, Fetthund, und all die anderen, die ihr Chef – Malacoda heißt er, „Bösschwanz“, noch sind wir nicht bei Luzifer persönlich – schließlich als zweifelhaften Begleitschutz für Dante und Vergil zusammenruft. Wie es sich für Teufel gehört, bläst der Rudelführer keine Trompete zum Aufbruch: Das höllische Signal ist (wir sind schon eingestimmt) ein Furz.
Dantes Horror haftet, neben allem tief Berührenden, neben moralischen und politischen Überlegungen, Witz und Charme an, das ist einer der Gründe, warum wir siebenhundert Jahre nach seinem Tod noch immer über sein Werk sprechen. Und wenn er Bilder verwendet wie jenes vom römischen Fußgängerverkehr, der im katholischen Jubeljahr von 1300 so dicht war, dass er in Einbahnen gelenkt werden musste, dann können wir uns die Vergangenheit in die Gegenwart hereinlesen: Wir sind doch alle Menschen, damals, heute, in Dantes Hölle – und hier.
Nächste Woche: Lauter Prominente in der Hölle
Die Autorin ist Lehrerin und Schriftstellerin.