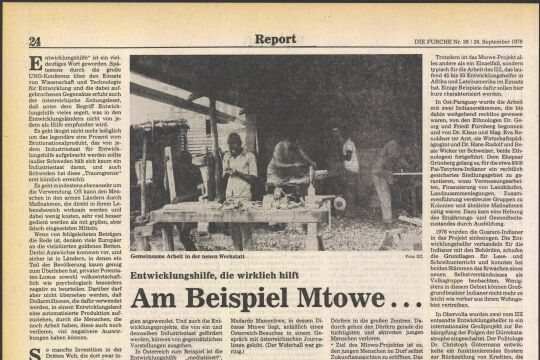Das Erdbeben in Haiti hat auch die internationale Katastrophenhilfe verändert. Welche Lehren man aus dem Hilfseinsatz zog, weiß Max Santner vom Roten Kreuz.
Seit 2007 leitet Max Santner die Internationale Zusammenarbeit im Österreichischen Roten Kreuz. Drei Mal besuchte er Haiti nach dem Beben: kurz nach der Katastrophe, ein Jahr danach, zuletzt im Vorjahr. Warum sich der Wiederaufbau in Haiti so schwierig gestaltet und welche Lehren die internationale Gemeinschaft daraus gezogen hat, bespricht er mit der FURCHE.
Die Furche: Nach dem Erdbeben wurde die schlechte Koordination der NGOs kritisiert. Die UNO hat schon nach der Tsunami-Katastrophe 2004 ein Cluster-System entwickelt. Wieso griff das nicht?
Max Santner: Haiti war schon vor dem Beben das ärmste Land der westlichen Hemisphäre, ohne intakte Infrastruktur, ohne Bildungswesen, eine NGO-Republik ohne funktionierenden Staat. Dann zerstörte das Erdbeben alle Ministerien. 17 Prozent der Beamten, die dort gearbeitet haben, kamen ums Leben. Es gab keine Leitungsebene, die die Hilfsleistungen koordinierte. In dieses Vakuum strömten 10.000 NGOs, viele davon amerikanische One-Man-Shows. Die kann das Cluster-System gar nicht abfangen. Als die UNO sich wieder organisiert hatte, nachdem ihr Hauptquartier in Port-au-Prince zerstört und der Missionschef ums Leben gekommen war, kam das Cluster-System zur Anwendung. Es stimmt aber nur die großen Organisationen aufeinander ab, die mit dem System vertraut sind und die Kapazität haben, zu Koordinationsmeetings zu gehen.
Die Furche: Genau die wurden bemängelt, weil lokale Hilfsdienste davon ausgeschlossen waren.
Santner: Dass lokale NGOs nicht gut eingebunden wurden, war eines der Grundübel des Systems. Daraus hat man gelernt. Auf den Philippinen, nach dem Taifun Haiyan funktionierte das schon besser. Auch die "beneficiairy communication“, die Kommunikation mit den Hilfeempfängern zu verbessern ist ein neues, großes Thema. Im Westen sind wir zwar sehr oft gut informiert darüber, was in einem Katastrophenfall stattfindet, aber die betroffene Bevölkerung weiß aufgrund der abgeschnittenen Kommunikationswege oft gar nicht, was passiert. Da laufen dann Leute in roten oder grünen Leiberln vor ihnen herum, und von vielen weiß man nicht, was sie tun.
Die Furche: Das Erdbeben in Haiti war eine der ersten Katastrophe, in der Betroffene über ihre Handys einen Hilferuf in sozialen Medien absetzen konnten. Etablierte NGOs waren darauf nicht eingestellt und nutzten diese Daten nicht ausreichend, heißt es.
Santner: Das kann ich persönlich nicht bestätigen, aber seither wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, Technologien, die den Menschen vertraut sind, im Katastrophenfall vermehrt zu nutzen. Ebenfalls in Verbindung mit alltäglichen Technologien steht der Trend hin zu Cash Transfer Programmen, in denen Menschen keine Warenpakete bekommen, sondern Bargeld oder Gutscheine. Beim Hochwasser auf dem Balkan im Sommer haben wir das erfolgreich angewendet. Bei Spendern und in der Öffentlichkeit hat es lange eine gewisse Skepsis demgegenüber gegeben, aber wir arbeiten daran, dass das als sinnvolle Hilfsleistung gesehen wird.
Die Furche: Wo liegt der Vorteil?
Santner: Man muss nicht mehr tonnenweise Material von einem Ort zum andern karren, sondern kann Waren von dort verwenden. Das kurbelt die lokale Wirtschaft an. Und die Leute können sich aussuchen, wofür sie das Geld ausgeben. Das hat viel mit Würde zu tun.
Die Furche: Das Rote Kreuz hält in Haiti auch Katastrophenvorsorgetrainings. Wie funktioniert das?
Santner: Eigentlich recht einfach: Am wichtigsten ist der Nachbar, weil der im Ernstfall Ersthelfer sein wird. Da geht es um Know-how in Erster Hilfe und Organisation, wen man wie erreicht, wer das Kommando übernimmt, auch um ein lokales Depot mit Hilfsgütern. Der nächste Schritt ist längerfristig, etwa dass man widerstandsfähigere Häuser baut.
Die Furche: Resilienz ist auch global das wichtigste Stichwort: Ziel muss sein, eine Region nicht mehr so verletzbar zu machen, wie Haiti es damals war. Wie gelingt das?
Santner: Je besser ein Staat organisiert und vorbereitet ist, desto weniger katastrophal sind die Auswirkungen von Katastrophen. Das sieht man gut, wenn man Haiti etwa mit den Philippinen oder Japan vergleicht. Im März wird die internationale Staatengemeinschaft im japanischen Sendai bei der Weltkonferenz für Katastrophenvorsorge ein Dokument unterzeichnen, das die Leitplanken für die nächsten Jahre legt. Ich erwarte mir, dass die Lehren aus Haiti die Bereitschaft erhöhen, schon vor einer Katastrophe zu investieren. Sei es in Infrastruktur, Technologie, Ausbildung und Trainings. Und dazu muss es auf internationaler und nationaler Ebene die entsprechenden Budgetlinien geben.