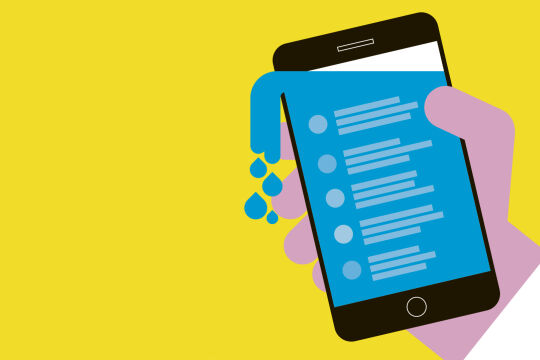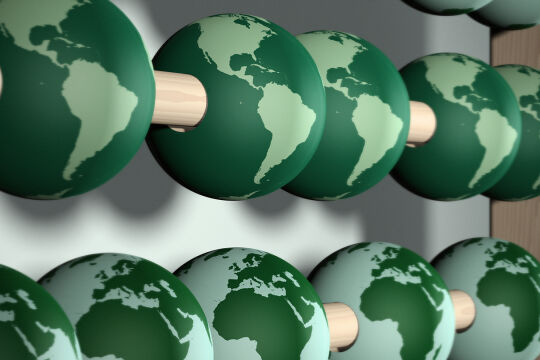Die Ökonomin Johanna Mair über soziales Unternehmertum, die Rolle der Hilfsorganisationen in Haiti und ein neues Gewinndenken nach der Krise. Das Gespräch führte Oliver Tanzer
Johanna Mair war eine der ersten Ökonomen, die sich in den frühen 90er-Jahren mit der Frage des sozialen Unternehmertums wissenschaftlich auseinandersetzte. Heute lehrt die gebürtige Südtirolerin in Barcelona und Stanford.
Die Furche: Seit Ausbruch der Wirtschaftskrise ist es sehr modern geworden, sich als Unternehmer mit dem Mäntelchen des sozialen Gewissens zu schmücken. Aber was ist Social Entrepreneurship überhaupt?
Johanna Mair: Der Begriff wird in vielen Domänen verwendet, die im Normalfall nicht sehr viel miteinander zu tun haben. Im öffentlichen Bereich wird er zuletzt in Großbritannien und in den USA gebraucht, um Innovation bei sozialen Serviceleistungen voranzutreiben. Im normalen Geschäftsleben bedeutet er ein integratives Businessmodell, das auf Verantwortung und Zusammenarbeit angelegt ist. Im Finanzbereich wird er heute sehr stark verwendet, wenn es um verantwortungsvolle Investitionen geht. Und schließlich macht sich die Entwicklungshilfeszene den Begriff zunutze, wenn es um Mikrofinanz geht.
Die Furche: Was profitorientierte Organisationen betrifft, so machen besonders Mikrokredite derzeit Furore. Sie sind da eher skeptisch. Warum?
Mair: Mikrokredite sind ein extremes Beispiel, das uns aufzeigt, dass wir manchmal mehr nachdenken sollten. Muhammad Yunus, der Gründer der Grameen-Bank, etwa sagt, Social Entrepreneurship kann und muss auch profitabel sein. Dass das so sein kann, dazu braucht man sich nur die Zinsen für Mikrokredite anzusehen. Es ist aber auch so, dass der Zugang zu Krediten nur einen kleinen Teil eines bestehenden Problems lösen kann, wie etwa Armut oder die soziale Ausgrenzung von Frauen. Es ist also zu fragen: Wie viele Frauen wurden durch den Kredit sozial besser gestellt? Das lässt sich nicht dadurch messen, ob die Kredite zurückgezahlt werden.
Die Furche: Non-Profit-Organisationen wie „Caritas“ und „Ärzte ohne Grenzen“ scheinen wesentlich professioneller in der Katastrophenhilfe zu sein als andere, auch staatliche Organisationen. Das zeigt sich derzeit auch in Haiti. Was können profitorientierte Unternehmen, aber auch staatliche Strukturen von solchen Organisationen lernen?
Mair: Es wurde lange Jahre eine ganz große Chance verpasst, weil man geglaubt hat, nur der profitorientierte Sektor sei das Allheilmittel für den sozialen Bereich. Es gab bis vor fünf oder zehn Jahren den Trend, dass Logistikfirmen vermehrt in den Katastrophenhilfebereich gegangen sind und dort die Erfahrung gemacht haben, dass die zum Teil kirchlichen Organisationen viel mehr bewirkten als sie selbst. Da muss jetzt auch ein Umdenkprozess stattfinden, dass wir mit solchen stereotypen Vorstellungen von Profit und Non-Profit-Organisationen aufhören. Man muss vielmehr fragen, wer kann nun ein bestimmtes Problem besser lösen und wie kann man die Lösung übertragen.
Die Furche: Also mehr ein gegenseitiges Lernen als einander zu konkurrenzieren.
Mair: Genau. Aber weil sie gerade Haiti erwähnt haben: Ich habe in den vergangenen Tagen intensiv die Berichte über die Hilfsmaßnahmen mitverfolgt. Dabei ist mir aufgefallen, dass jede Aktivität in den Medien in einen monetären Wert übersetzt wird. Also beispielsweise gibt es Nahrungsmittel oder medizinische Güter um soundso viele Millionen Dollar. Es hat fast den Anschein, als wolle man den Zuseher damit beeindrucken, wie viel Geld da hineinfließt. In Wahrheit sollte es aber darum gehen, was zu diesem Zeitpunkt gerade sinnvoll und notwendig wäre. Geld ist eigentlich niemals das Problem, es ist immer genug davon da.
Die Furche: Glauben Sie, dass die Krise zu einem fundamentalen Umdenkprozess Richtung sozialer Orientierung der Wirtschaft führt?
Mair: Es ist eine einzigartige Chance. Wir müssen uns fragen, ob wir nicht in den vergangenen zehn Jahren blind in eine Richtung gelaufen sind. Wir haben auch in Europa nur eine Form des Kapitalismus praktiziert, jene, die auf börsennotierten Unternehmen basiert. Das ist zwar eine wichtige Unternehmensform, aber eben nicht die einzige. Wir sind von anderen, vielleicht ebenso sinnvollen Organisationsformen abgekommen, wie etwa Kooperativen oder Genossenschaften. Die dort zugrundeliegenden Prinzipien wurden aufgegeben und am Ideal des börsennotierten Unternehmens gemessen. Es wäre nun eine Möglichkeit gegeben, auf breiter Ebene Veränderungen einzuleiten, etwa durch gewisse Veränderungen im Steuersystem.
Die Furche: Wenn man andere Unternehmensformen will, müsste man auch den Begriff Gewinn neu definieren.
Mair: Genau. Gewinn ist ja nichts schlechtes. Gewinn ist auch, wenn jemand nicht für Profit arbeitet – er verteilt den Gewinn ja nur, da muss man ansetzen. Da bedarf es eben auch mehr an Aufklärungsarbeit.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!






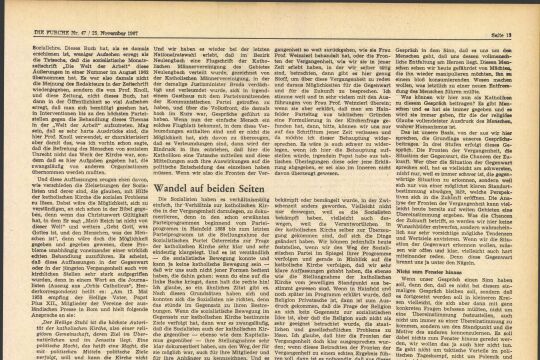
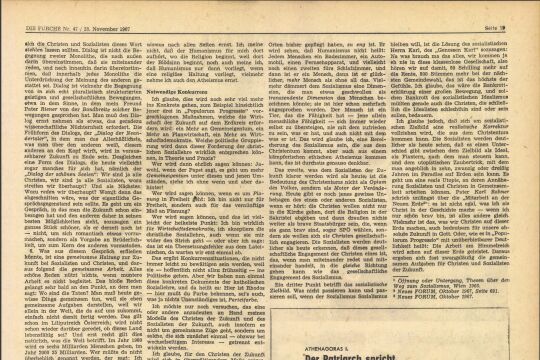


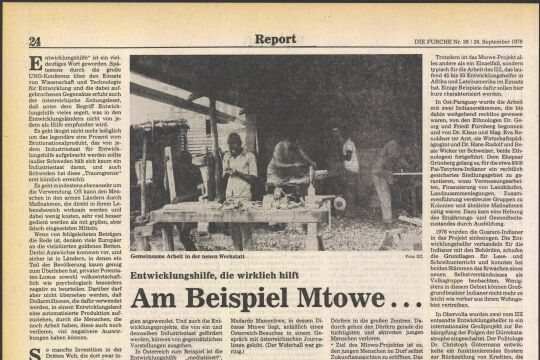

































.png)