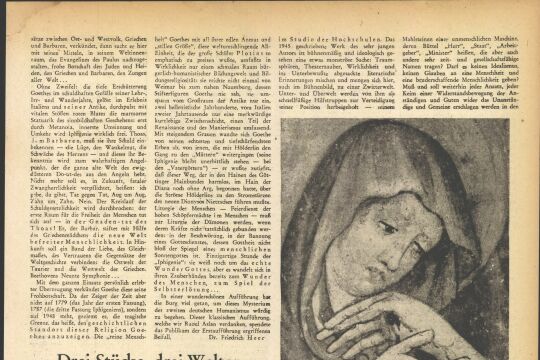Horváths "Glaube Liebe Hoffnung" in der Regie von Martin KuÇsej.
Wenn Martin KuÇsej seine Inszenierung von Ödön von Horváths "Glaube Liebe Hoffnung" mit der ins Wasser gegangenen Elisabeth beginnt, dann eröffnet er einen tragischen Reigen, den "Kleinen Totentanz", wie der Autor selbst spezifizierte. Das Stück baut auf einer realen Begebenheit auf: 1932 lernte Horváth den Gerichtssaalberichterstatter Lukas Kristl in München kennen, der ihn auf die Geschichte einer jungen Korsetten-Verkäuferin aufmerksam machte, die aus wirtschaftlicher Not mit der Justiz in Verbindung geraten war, deren Fängen sie nie wieder entkam. Im Mittelpunkt der Story steht - wie so oft bei Horváth - ein "Fräulein", das in ihrem Anspruch, möglichst gerade durch die Welt zu gehen, kläglich scheitert: Umgeben von Chauvinisten wird Elisabeth nur zur Projektionsfläche für deren eitle Bedürfnisse; ja sogar am bitteren Ende, als sie an den Folgen ihres Suizidversuchs stirbt, bedauert sich ihr vermeintlicher Lebensretter nur selbst: "Umsonst" heißt es da, und ihr früherer Geliebter Alfons weiß auch nichts anderes als ein selbstmitleidiges "Ich hab kein Glück".
KuÇsej begeht glücklicherweise nicht den Fehler, in Gut und Böse zu teilen, sondern stellt die Figuren höchst differenziert als aus der eigenen Not Handelnde dar, als jene, die auf sich selbst zurückgeworfen sind. Und damit wird er Horváth als Meister in der Analyse von Beziehungsmechanismen gerecht, der die Personen seiner Dramen dort stehen lässt, wo sie gerade sind, wo sie sich nicht entwickeln und unreflektiert bleiben und wo das Ergebnis diese bittere, zerstörerische Dummheit ist. "Glaube Liebe Hoffnung" präsentiert sich als bisweilen komische Tragödie, oder wie es Horváth selbst untertitelte: eine "Kleinbürgerliche Komödie", bei der einem das Lachen im Halse stecken bleibt und für die es keine literaturwissenschaftlichen Zuordnungen mehr gibt.
So auch die Bühne von Martin Zehetgruber, die eine Welt darstellt, in der es zwischen Himmel und Hölle keinen Raum gibt. Auf einem Display ziehen im Zeitraffer die Wolken, während die Bühne einer Art Kloake, einer U-Bahnstation aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gleicht. Damit spielt KuÇsej gezielt auf jene Gott- und Inhaltslosigkeit an, die Horváth in "Glaube Liebe Hoffnung" (ebenso in anderen Texten wie "Jugend ohne Gott") künstlerisch umzusetzen suchte.
Auch für Elisabeth gibt es keinen Ort, bis sie im anatomischen Institut landet, wo wenigstens ihr Leichnam ein Zuhause finden soll.
Die Musik von Bert Wrede betont das Atmosphärische dieser Inszenierung, die die unausgesprochene Angst, die Bedrohung den gesamten Abend hindurch tragen. Analog dazu muss die homogene Ensembleleistung in der "Ausstellung" der Sprache erwähnt werden, KuÇsejs feine Klinge setzt auf den von Horváth verwendeten Konjunktiv - alles bleibt nur in der Möglichkeit, fast wie bei Nestroy: "Wirklichkeit is immer das schönste Zeugnis für die Möglichkeit".
Manchmal wird dieses besondere Hinschauen (hier ist unbedingt Reinhard Traubs grandiose Lichtregie zu nennen, der die inneren Befindlichkeiten der Figuren perfekt ausleuchtet) gar zu zelebrierend, dann schleppt sich die Tristesse ins Unendliche.
Sylvie Rohrer spielt die feinen Abstufungen auf Elisabeths stetem Weg bergab, Werner Wölbern zeigt die vielen Nuancen dieses kleinen, machtversessenen Polizisten, der an nichts anderem interessiert ist, als Elisabeth unter seine Kontrolle zu bringen. Der wie immer brilliante Ignaz Kirchner macht aus dem Leichenpräparator eine bizarre Nummer, Kirsten Dene setzt in feinen Tönen auf Anteilnahme bis zu jenem Punkt, wo's um die eigene Haut geht und die Tragik der Gleichgültigkeit beginnt.