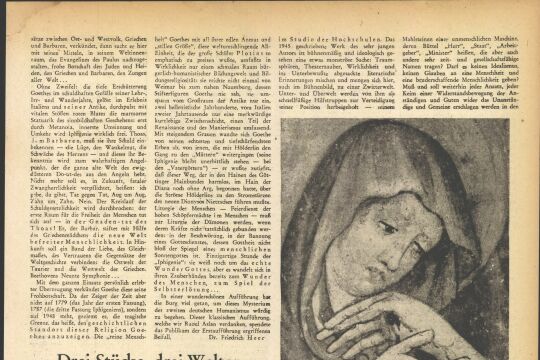„Automatenbüfett“: Kleinkrieg im Anglerverein
Kurz vor der erneuten Schließung der Theater konnte im Wiener Akademietheater noch die Premiere von Anna Gmeyners selten gespielter Komödie „Automatenbüfett“ aus dem Jahr 1932 über die Bühne gehen.
Kurz vor der erneuten Schließung der Theater konnte im Wiener Akademietheater noch die Premiere von Anna Gmeyners selten gespielter Komödie „Automatenbüfett“ aus dem Jahr 1932 über die Bühne gehen.
Das Burgtheater unter Intendant Martin Kušej hat sich vorgenommen, „vergessene“ Stücke von österreichischen Exil-Autorinnen zurück auf die Bühne zu bringen. War es in der vergangenen Spielzeit Maria Lazars „Der Henker“ von 1921, so ist es heuer die 1932 von der damals noch nicht 30-jährigen, in Wien geborenen Anna Gmeyner verfasste Komödie „Automatenbüfett“, die dem Publikum vorgestellt wird. Nun gibt es Stücke, die zu Recht vergessen sind, und es gibt solche, die es nicht sind. Zu welcher der beiden Kategorien Gmeyners Dreiakter gehört, ist nicht ganz leicht auszumachen.
Das titelgebende „Automatenbüfett“ ist Stammtreff eines Anglervereins und überhaupt Zentrum einer kleinen Ortschaft, in dem ein Grüppchen von wunderlichen, selbstsüchtigen und auch mitunter boshaften Kleinbürgern seinen großen Träumen und eigennützigen Geschäften nachgeht. Nachdem Leopold Adam (hier von Michael Maertens in seiner ihm eigenen Kunst als steifer Spießer dargestellt), der von der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Zuchtfisch träumt, die wegen Liebesdingen lebensmüde Eva (Katharina Lorenz) aus dem Wasser gezogen und ins Automatenbüfett gebracht hat, gerät die beschauliche und menschelnde Welt der Kleinbürger dortselbst allmählich aus den Fugen.
Der ebenso geschäftstüchtigen wie mannstollen Inhaberin des Automatenbüfetts Clementine Adam (Maria Happel) ist die Schöne gleich ein Dorn im Auge: „Sogar das Bier schäumt anders“, schimpft sie einmal. Die ansonsten geselligen Honoratioren des Ortes, unter ihnen der Schulrat Wittibtöter, Apotheker Hüslein, Zeitungsredakteur Arendt oder Oberförster Wutlitz, stellen der jungen Frau sogleich nach. Keiner wird das Objekt der Begierde schließlich bekommen, auch Pankraz, der hinterlistige Falschmünzer, nicht. Ihm gelingt es wenigstens, der Adam ein Begehren vorzuspielen und sich so das Automatenbüfett unter den Nagel zu reißen.
Satirisch bis poetisch
Gmeyners Stück steht ganz in der Tradition populärer Dramatik der Weimarer Republik. Einerseits ist es dem Volksstück eines Ödön von Horváth verwandt, mit der Milieuschilderung, der genauen Menschenbeobachtung, den zerrissenen, sentimentalen und gemeinen Figuren und der Entlarvung des Gemütlich-Kleinbürgerlichen. Andererseits ist es auch dem antinaturalistischen Stilkonzept eines Carl Sternheim nahe, mit dem dieser seine beißende Spießerkritik vorzubringen pflegte. So wechseln sich bei Gmeyner satirische Sätze mit schlichten Sätzen von berückender poetischer Kraft ab („ich wollte, ich wäre zwei kleine Hunde und könnte miteinander spielen“). Ihre kunstvolle Dekonstruktion des jargonhaften Sprechens wollte sie dabei durchaus als Kritik der Weimarer Gesellschaft verstanden wissen.
Anlässlich der Inszenierung im Berliner Theater am Schiffbauerdamm im Dezember 1932 vermerkte einer der großen Theaterkritiker der Weimarer Republik, Herbert Jhering, über die Autorin wohlwollend, sie wolle „nicht mehr als sie kann“. Jetzt könnte man sagen, die Regie will vom Stück mehr als es kann. Denn Barbara Frey legt ihre Inszenierung als große (stumme) Choreografie an, wobei sie einen Satz im Stück konterkariert, wonach Tempo Trumpf sei.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!