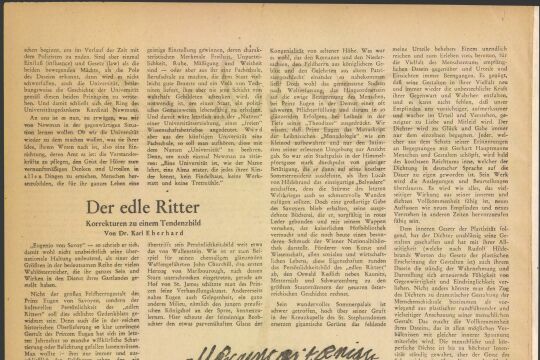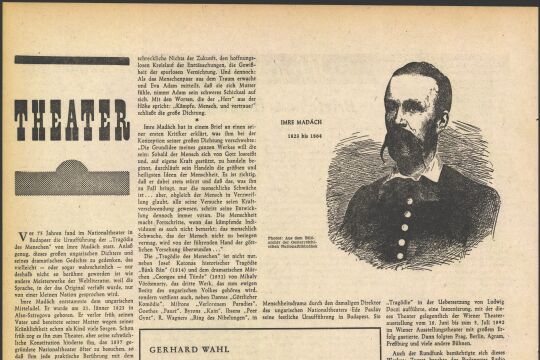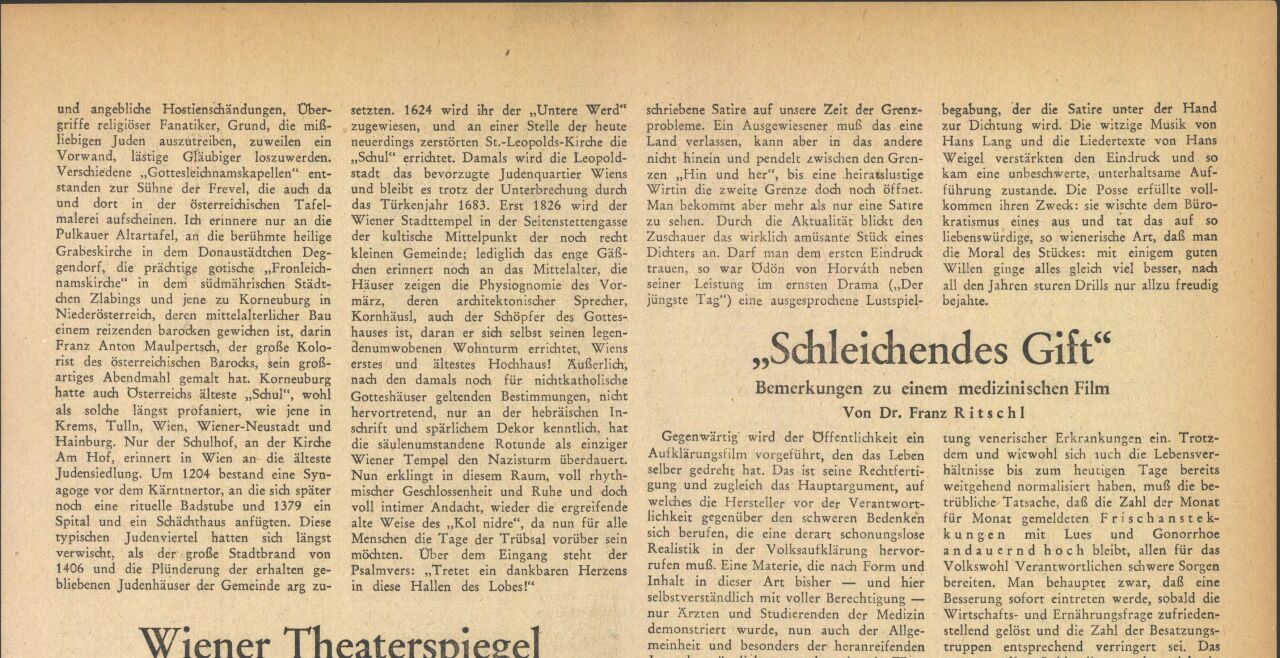
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wiener Theaterspiegel
Das Akademietheater eröffnete seine heurige Spielzeit mit Nestroys „Unverhofft“. Man bekam nicht so sehr den scheinbar harmlosen (wie er gewöhnlich gespielt wird), wie den nachdenklichen, ja den Pessimisten Nestroy zu sehen. Die für ihn charakteristische Mischung der grotesken Steigerung des Komischen ins Kolossale, mit Witz und Desillusion kam in dieser Aufführung gut heraus. Ganz im Gegensatz zu der gemüthaften Dramatik Raimunds zielt ja Nestroy darauf ab, wie alle Satiriker, den Menschen zu entlarven und die Verhüllungen, die er um seine „Lebenslügen“ geworfen hat, wegzureißen. Diese Absicht verwirklicht der Dichter mit einem dramatischen Personal, das alles andere als rein realistisch aufzufassen ist. Mit Recht sah man in dieser Aufführung einen mephistophelischen Modehändler in Gelb und Schwarz, einen Herrn von Ledig, der einen Trauerflor um die Stimme hatte. Echt Nestroy ist es, wenn fast jede der dargestellten Gestalten ihr mühsam gehütetes Geheimnis hat, wie fast jede durch die Handlung gezwungen wird, ihr Geheimnis preiszugeben. Nach außen aber erscheint dem harmlosen Zuschauer das Gesehene als unbeschwert gemütlich und so konnte das frische und lockere Spiel einen harmonischen Eindruck hervorrufen.
Nach Rußland führt das Theater in der Josef stadt mit Leo Tolstois „Der lebende Leichnam“. Diese Dichtung zieht ihre immer wieder erprobte Wirkung aus dem Mitleid mit der Menschheit. Fedja Protassow ist von Natur sonderlich begabt: wo andere ihre kleinen Illusionen im bürgerlichen Alltag zu verbergen wissen, da beherrschen ihn seine Träume, die Musik der Zigeuner („Was liegt da nicht alles drin“) und die „Stimmen aus dem Grund“, die den Menschen in den Abgrund locken. Er sieht mit Seherkraft Lockungen und Illusionen, wo andere Liederlichkeit, Pflichtvergessenheit, Trunksucht und Faulheit erkennen. Fedja lebt in einer Traumwelt. Und so spielt uns Tolstoi den Mißklang vor, den das Zusammentreffen von Traum und individuellstem Leben ergibt. Edthofer spielt diesen in das Leben eingekerkerten Riesen des Traumes mit der Geste des herabgekommenen Grandseigneurs. Er wußte glaubhaft zu machen, daß diesem Menschen das „gewöhnliche“ Leben nur eine Steppe voll Öde und Langeweile ist; er spielte einen Fürsten der Phantasie. Wie er am Schlüsse einer in das Räderwerk der Justizmaschinerie geratenen Seele sich mit leise flatternder und zitternder Stimme Gehör zu verschaffen suchte, war tief ergreifend. Ein Abend vollendeter Kunst der Darstellung.
Der russische Dichter zieht seine Wirkung aus dem rein Menschlichen. Anders das Drama der Franzosen. Die Insel in der Komödie hat mit Romain Rollands „Ein Spiel von Tod und Liebe“ eröffnet. Das Stück ist ein guter Griff. Man kann sich kaum etwas Dramatischeres vorstellen: Inmitten der Französischen Revolution, diesem Taumel der Selbstsucht und der Leiden-sd ften, fassen zwei Menschen den schweren Entschluß, vor der drohenden Enthauptung nicht zu flüchten, sondern sich zu opfern. Der eine, Jerome von Courvoisier, ist ein alter Mann, der seine Forderung nach Humanität nicht aufzugeben vermag, jedoch erkennen muß, daß die Revolution seine Ideale nicht verwirklichen kann. So übergibt er die beiden Pässe, die ihm und seiner Frau die Flucht ermöglichen sollen, seinem natürlichen Feinde, dem Geliebten seiner Frau, und dieser selbst. Seine Gattin erkennt die sittliche Größe ihres Gemahls und besdiließt, an seiner Seite zu sterben. Hier opfert der Mensch sich selbst aus höchster sittlicher Überwindung. Das ist die gleiche hohe Dramatik des Opfers, wie sie auch in Clau-dels „Bürgen“ begegnete. Nur war das Opfer bei Claudel christlich motiviert; bei Rolland zieht die Dramatik ihre Folgerichtigkeit aus der Frage nach dem Wesen der Humanität. Aus der Verzweiflung an der Verwirklichung der Humanität durch die Revolution ist das Drama und sein Opfergedanke geboren. Und so will es scheinen, daß Rolland die echte Humanität in die Überwindung des Lebens, eben in das Opfer verlegt. „Wozu ward uns das Leben gegeben?“ heißt es am Schluß — damit wir es überwinden. Ganz ähnlich sehen Schiller und Stifter die echte Freiheit in' der Überwindung der Leidenschaften. Die Darstellung wurde dem Dramatischen des Werkes, das genug des Aufwühlenden hat, nicht gerecht. Es war nur kaltes Feuer, das abgebrannt wurde.
Das Studio des Theaters in der Josefstadt, kann mit der Posse „Hin und her“ von ödön von Horvath einen unstreitigen Erfolg buchen. Eine 1932 geschriebene Satire auf unsere Zeit der Grenzprobleme. Ein Ausgewiesener muß das eine Land verlassen, kann aber in das andere nicht hinein und pendelt zwischen den Grenzen „Hin und her“, bis eine heiratslustige Wirtin die zweite Grenze dodi noch öffnet. Man bekommt aber mehr als nur eine Satire zu sehen. Durch die Aktualität blickt den Zuschauer das wirklich amüsante Stück eines Dichters an. Darf man dem ersten Eindruck trauen, so war ödön von Horvath neben seiner Leistung im ernsten Drama („Der jüngste Tag“) eine ausgesprodiene Lustspielbegabung, der die Satire unter der Hand zur Dichtung wird. Die witzige Musik von Hans Lang und die Liedertexte von Hans Weigel verstärkten den Eindruck und so kam eine unbeschwerte, unterhaltsame Aufführung zustande. Die Posse erfüllte vollkommen ihren Zweck: sie wisdite dem Bürokratismus eines aus und tat das auf so liebenswürdige, so wienerische Art, daß man die Moral des Stückes: mit einigem guten Willen ginge alles gleich viel besser, nach all den Jahren sturen Drills nur allzu freudig bejahte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!