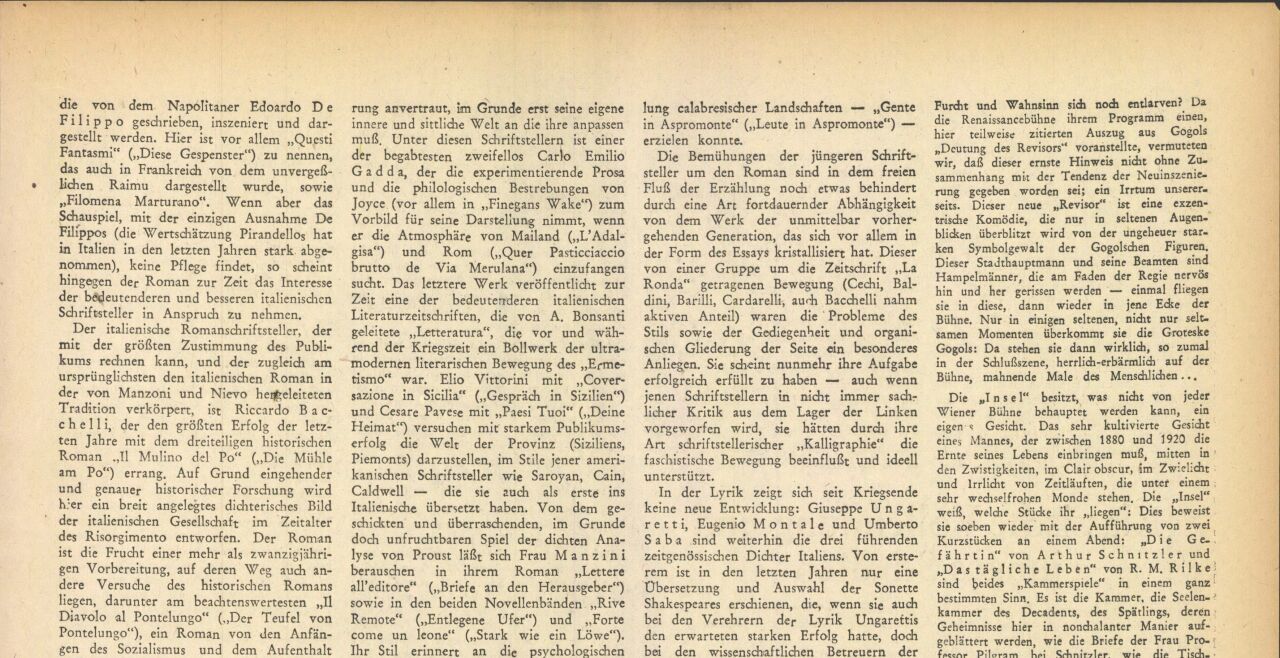
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wiener Vorweihnachtspremieren
Als erste Weihnachtspremiere bringt das Thea, ter der Stephansspieler heuer ein „M a r i e n s p i e 1 nach altflämischen Motiven“ von A. Miller. Schade, der Erfolg des vorjährigen Weihnachtsspieles findet diesmal keine Wiederholung. An den Schauspielern liegt es nicht: Sie spielen mit einer Hingabe, Wärme und inneren Anteilnahme, die eines besseren Stückes würdig wäre. Ein Marienspiel — nach altflämischen Motiven? Man denkt an die innige Größe der alten Maler Flanderns, an die Schau Timmer. manns, der die heilige Familie, die Armut und Innigkeit dieses Landes eigenständiger Bauern und Kleinbürger durchwandern läßt — in ewiger Gültigkeit, eben deshalb, weil ganz eingeborgen in die karge demütige Zeithaftigkeit der üppigstrotzenden und wieder hungrig-darbenden flandrischen Erde. Das Millersche Marienspiel will aber zu seinem argen Schaden die „Zeit-losigkeit“ der Legende erreichen und bleibt eben deshalb, weil es nicht wagt, den harten eckigen Raum nothaft irdischer Wirklichkeit aufzusuchen, im Leeren hängen: Blechern klappern schulhaft-fade Reime, billige Gemeinplätze. Es gibt keine Handlung, weil kein Leben verhandelt wird — Engel und Teufel streiten sich um eine Puppe im Stil von St. Sulpice, der berühmten, von Paul Claudel für immer entlarvten Kitschwelt scheinreligiöser Pseudokunst. Wohl um die Ewigkeitsgültigkeit des heiligen Geschehens anzudeuten, läßt die Regie das Spiel im Zeitlupentempo abrollen; wir sehen also zwei Stunden zu, wie Maria ihr Haupt hebt und senkt, senkt und hebt... Peinlich. Verkürzt auf eine halbe Stunde ließe sich vielleicht noch einiges retten. Nochmals, schade; denn es wird gut gespielt, an den Sdiau-spielern liegt es nicht.
Die Renaissancebühne bringt großes Wektheater: Gogols „Reviso r“. Diese hunderjährige Komödie hat an sich nichts von ihrem Glanz verloren, weil sie ein nieverschwin-dendes Thema behandelt: Das Scheitern des Menschen vor dem Urteilsspruch seines Gewissens. Man kennt seine Handlung: Die Behörden einer kleinen russischen Stadt geraten in Angst, weil ein Oberbeamter angesagt ist, der ihre Amtsgeschäfte — die Regierung ihres kleinen Reiches — überprüfen soll. Das Schicksal will es, daß ein junger „Windbeutel“ für eben diesen Revisor gehalten wird; um ihn herum tobt also nun der Jahrmarkt der Eitelkeiten, um mit Thackeray zu sprechen; er heimst Geld und Ehrung, Furcht und Liebe ein und verschwindet; als er verzieht, steht der wirkliche 'Zuchtherr dar Beamten-, ja Mensdien-dämmerung. Die Stunde des Gerichts, der Entlarvung aller Egoismen, Gewalttaten und Schein, heiligkeiten dieser Welt, schlägt. Gogol selbst hat in seiner „Deutung des Revisors“ dies sein Meisterwerk in einer Weise aufgefaßt, welche es nahe an die Meisterwerke Franz Kafkas, zumal an den „Prozeß“, heranrückt: Die kleine russische Provinzstadt ist „unsere eigene Seelen-
Stadt“, „der Revisor ist unser erwachendes Gewissen“; wir sollen über die in Angst und Entsetzen, Eitelkeit und Selbstsucht erstarrenden Personen — lachen. Gewiß, wir lachen über uns selbst — die Begründung, die Gogol für dieses Lachen gibt, zeigt die Tiefe des christ-lidien Humors auf: „Jawohl, wir lachen über uns selbst, weil wir eine Stimme vernehmen, die uns gebietet, besser zu werden als die übrigen.“ Gogol kannte also noch, ebenso wie unser Barock, dieses Lachen eines Menschentums, das sich mit all seinen Schwächen in Gott geborgen weiß. Kafka, unsere Gegenwart, kennt es nicht mehr. Sie ist nur mehr ein unfruchtbarer Advent, ein banges Harren neuen Schrecknissen entgegen: Was für grauenhafte Tatsachen wird uns die Zukunft noch enthüllen, bis in welche Tiefen hinab wird, unter dem drohenden Drängen des unsichtbaren Revisors, der Mensch in
Furcht und Wahnsinn sich noch entlarven? Da die Renaissancebühne ihrem Programm einen, hier teilweise zitierten Auszug aus Gogols „Deutung des Revisors“ voranstellte, vermuteten wir, daß dieser ernste Hinweis nicht ohne Zusammenhang mit der Tendenz der Neuinszenierung gegeben worden sei; ein Irrtum unsererseits. Dieser neue „Revisor“ ist eine exzentrische Komödie, die nur in seltenen Augenblicken überblitzt wird von der ungeheuer starken Symbolgewalt der Gogolschen Figuren. Dieser Stadthauptmann und seine Beamten sind Hampelmänner, die am Faden der Regie nervös hin und her gerissen werden — einmal fliegen sie in diese, dann wieder in jene Ecke der Bühne. Nur in einigen seltenen, nicht nur seltsamen Momenten überkommt sie die Groteske Gogols: Da stehen sie dann wirklich, so zumal in der Schlußszene, herrlich-erbärmlich auf der Bühne, mahnende Male des Menschlichen...
Die „I n s e 1“ besitzt, was nicht von jeder Wiener Bühne behauptet werden kann, ein eigen s Gesicht. Das sehr kultivierte Gesicht eines Mannes, der zwischen 1880 und 1920 die Ernte seines Lebens einbringen muß, mitten in den Zwistigkeiten, im Clair obscur, im Zwielicht und Irrlicht von Zeitläuften, die unter einem sehr wediselfrohen Monde stehen. Die „Insel“ weiß, welche Stücke ihr „liegen“: Dies beweist sie soeben wieder mit der Aufführung von zwei Kurzstücken an einem Abend: »Die Gefährtin“ von Arthur Schnitzler und „Das tägliche Leben“ von R. M. Rilke; sind beides „Kammerspiele“ in einem ganz bestimmten Sinn. Es ist die Kammer, die Seelenkammer des Decadents, des Spätlings, deren Geheimnisse hier in nonchalanter Manier aufgeblättert werden, wie die Briefe der Frau Professor Pilgram bei Schnitzler, wie die Tischblumen Maschas bei Rilke. Herr Professor Pilgram (in „die Gefährtin“) weiß nach dem plötzlichen Tode seiner Frau zwar, daß er ihre Liebe' kaum jemals besessen hat, eine Erkenntnis, mit der er sich sachlich-egoistisch seit langem abgefunden hatte, er weiß aber nichts von der eigentlichen Tragödie ihres Lebens. Im Gespräch mit einer Freundin seiner Frau und seinem früheren Freund, entfaltet sich nun das Schicksal dieses, kleinen Menschfenkreises in einer Fülle von Nuancen, welche nun erst den Schmerz echter Einsicht vermittelt: Wie seltsam, wie schuldhaft war doch alles... Um dieselbe Einsicht ringt Rilkes „kammerspiel“. Was weiß der junge Maler Georg Miliner von seinem eigenen Innensein, er, der sich von seinem Modell, der kleinen Mascha, über sein gutes — sein Arbeits-, und sein schlechtes, sein Tagesgesicht aufklären lassen muß, er, der einer zweiten Frau —• Helene — das bittere Wissen um ein bis auf den Grund ausgeschöpftes einmaliges Er'ebnis danken muß. Rilke, der kurzweilige Mann einer Malerin, der scheue Freund der Frauen, der Bienenmeister, welcher tausend Leben kosten will und sich den Forderungen des einen — seines eigenen — in tausend Gesichtern, Masken, Fluchten fliehend verwehrt, blickt aus jedem Wort, jeder Geste, ja selbst aus den zarttonigen Bildern des Meisters Werner Scholz, die (ein sehr zu lobender Gedanke der Regie) das Künstlerzimmer der Insclauifführung zieren. Schnitzlers und Rilkes „Kammerspiele“: Gespräche müder Seelen im Abend. Historische Dokumente einer Zeit, die nicht mehr die unserige ist. Sie ergreifen uns nicht mehr, wohl aber ringen sie — in der so Überjms gepflegten Aufführung der „Insel“' um unser Begreifen. Seht — so waren Menschen in einer großen Dämmerstunde unseres Landes, des Abendlandes. So sprachen sie, so gebärdeten sie sich, so gingen sie hin. Girlande vergilbenden Lebens.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































