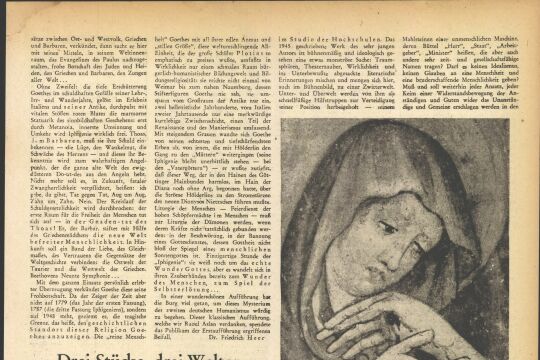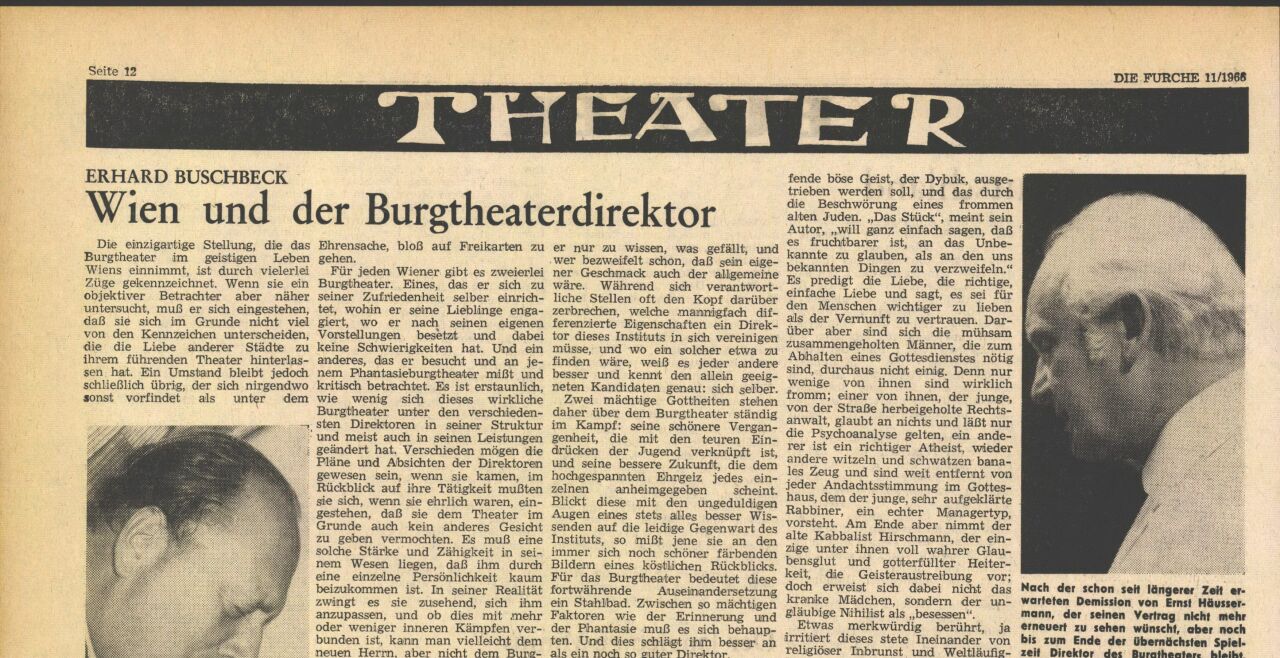
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zeitstück, Legende, Impromptu
In drei Komödien hat Carl Sternheim den Aufstieg der Familie Maske als Spiegelung von Aufstieg (und Fall) des Wilhelminischen Deutschlands festgehalten. In der Mitte zwischen der kleinbürgerlichen Komödienwelt der „Hose” und der bourgeoisen Apokalypse des Schauspiels „1913” steht „Der Snob”, jener Kleinbürgersohn Christian Maske, der sich Macht und Reichtum errafft, Held aus dem — wie Sternheim es nannte — „bürgerlichen Heldenleben”. Streber mit brutaler Ellbogenfreiheit, Fassadenkletterer auf den Sprossen einer Karriere, die mit dem Generaldirektor und Aktionär endet, zahlt er seine langjährige Geliebte mit Zinseszdnsen aus, verrät seine ärmlichen Eltern, um die „blamable” Herkunft verleugnen und sich durch eine Heirat gräflichen Glanz zulegen zu können. Im „Snob” hat Sternhedm die Verkörperung einer Welt geschaffen, die sich innerlich längst eingestanden hatte, daß Verdienste das sind, was man verdient, und Macht und Ansehen sich nur in erhabenen Stammbäumen manifestieren. Von den Themen her ist „Der Snob” freilich schon in historische Distanz gerückt und hat nur noch wenig mit der Dämonie eines modernen Wirtschaftswunders zu tun. Was aber an dem Stück stofflich fremd und überholt sein mag, wird durch Stemheims frühexpressionistischen Sprachstil, mit dem er der gesellschaftlichen Wirklichkeit zusetzte, überbrückt. Stemheims vielumstrittene Sprache ist ein drahtiges, knarrendes Deutsch, in dem die Dialoge wie Telegramme hervorgestoßen werden, eine Art grammatikalische Stenographie, fast eine Vorahnung für die kaltschnäuzige Ausdrucks- und Denkweise der nachrückenden Generation, entsprungen einem Akt der Sprachver- zweiflung inmitten der ungeheueren Vermehrung des Wortkonsums.
Sternheim kann nur in einer sorgfältigen, die Stilmomente kundig abwägenden Darbietung gebracht werden, wobei die Marionetten im Panoptikum des Autors zugleich wie Menschen aus Fleisch und Blut wirken sollen. Das ist Rudolf Noelte, dem Regisseur der Inszenierung, mit der das Berliner Renaissancetheater eine Woche lang im Akademietheater gastierte vollauf gelungen. Es gab eine exakte, komödiantisch lebendige Aufführung, in deren Mittelpunkt Boy Gobert (wenn wir nicht irren: Mitglied des Wiener Burgtheaters) als Christian Maske stand, der bisweilen mit echt wienerischem, also durchaus Sternheim fremdem Charme das Gleichgewicht zwischen Unsicherheit und Überlegenheit hielt. Vollkommenen Sternheim spielte dagegen Hubert v. Meyernick als stocksteifer, im Standesdünkel unerschütterlicher Graf Aloysius Palen. Kräftige Komik bot Hans Mahnke als Vater Maske. Käte Haack war die kümmerliche, biedere Mutter, Friedei Schuster die kluge, einsichtige Freundin von Christian Maske, Immy Schell die puppenhafte, unpersönliche kleine Komteß. Viel Beifall für die Gäste.
Der Amerikaner Paddy Chayefsky (Jahrgang 1923), als Theater-, Film- und Fernsehautor im internationalen Gespräch, will seine Legende „Der zehnte Mann” nicht als ein mystisches Stück aufgefaßt wissen. Obwohl es in einer sehr armen Vorstadtsynagoge in New York spielt, wo aus einem „besessenen” Mädchen (statt es zum Psychiater oder in eine Anstalt zu schicken) der besitzergreifende böse Geist, der Dybuk, ausgetrieben werden soll, und das durch die Beschwörung eines frommen alten Juden. „Das Stück”, meint sein Autor, „will ganz einfach sagen, daß es fruchtbarer ist, an das Unbekannte zu glauben, als an den uns bekannten Dingen zu verzweifeln.” Es predigt die Liebe, die richtige, einfache Liebe und sagt, es sei für den Menschen wichtiger zu lieben als der Vernunft zu vertrauen. Darüber aber sind sich die mühsam zusammengeholten Männer, die zum Abihalten eines Gottesdienstes nötig sind, durchaus nicht einig. Denn nur wenige von ihnen sind wirklich fromm; einer von ihnen, der junge, von der Straße herbeigeholte Rechtsanwalt, glaubt an nichts und läßt nur die Psychoanalyse gelten, ein anderer ist ein richtiger Atheist, wieder andere witzeln und schwatzen banales Zeug und sind weit entfernt von jeder Andachtsstimmung im Gotteshaus, dem der junge, sehr aufgeklärte Rabbiner, ein echter Managertyp, vorsteht. Am Ende aber nimmt der alte Kabbalist Hirschmann, der einzige unter ihnen voll wahrer Glaubensglut und gotterfüllter Heiterkeit, die Geisteraustreibung vor; doch erweist sich dabei nicht das kranke Mädchen, sondern der ungläubige Nihilist als „besessen”.
Etwas merkwürdig berührt, ja irritiert dieses stete Ineinander von religiöser Inbrunst und Weitläufigkeit, von Sakralem und gemütvollwitziger Naivität. Wahrscheinlich ist die Bezeichnung Legende die falscheste aller möglichen Bezeichnungen dafür. Es ist Michael Kehlmann, dem Regisseur der Inszenierung im Theater in der Josefstadt hoch anzurechnen, daß er nicht nur eine fremdartige Welt erschloß, sondern auch eine vom Schauspielerischen her fesselnde Aufführung zustandebrachte. Leopold Rudolf als Hirschmann, Herta Martin als Mädchen, Peter Vogel als der am Leben Verzweifelnde boten ausgezeichnete Leistungen, aber auch das übrige Ensemble, darunter besonders: die Herren Sowinetz, Waldbrunn, Muliar, Bucher, Schmidel, Matič. Das anfänglich „formale” Befremden wich einem lebhaften Schlußbeifall.
Julius Mader
Jean Giraudoux beginnt wenigstens auf zweien unserer Wiener Bühnen heimisch zu werden. Und das ist gut so, denn es gibt für den mitteleuropäischen Geschmack kaum eine bessere Schule —, denn was auf den ersten Blick wie Frivolität aussieht, ist in Wirklichkeit tiefe Skepsis angesichts der menschlichen Dummheit und Schicksalsblindheit.
„Ich liebe es”, sagte einmal Andrė Gide über Giraudoux, „mich ihm anzuvertrauen, ohne allzu sicher zu wissen, wohin er mich führt.” Der erste der beiden im Akademietheater gespielten Einakter, „Impromptu”, führt nirgendhin, -sondern will — in Form witzig-pointierter Dialoge — zwischen Schauspielern, ihrem Direktor und einem Herrn aus dem Ministerium ein wenig zum Selbst- verständnis von Theaterautoren, Schauspielern, Publikum und Kritik beitragen. Es ist ein Beispiel jenes „literarischen Theaters”, das Giraudoux gemeinsam mit seinem Freund und Mitarbeiter Louis Jouvet auf so unvergleichliche Weise bereichert hat — und bei dessen Nennung sämtliche Schauspieler in schallendes Gelächter ausbrechen…
Im zweiten Stück, „Lied der Lieder”, geht es um die Liebe zwischen einem jungen Mädchen ungewisser Provenienz und einem alternden „Präsidenten”, zwar nicht gerade dem der Republik, aber einem Mann in höchster Stellung. Sein Nebenbuhler, ein junger Naturbursche, der das Mädchen heiraten wird, hat nur seine Jugend für sich — und sonst gar nichts. Und diese Jugend siegt — natürlich.
Beide Stücke hat Ulrich Erfurth mit leichter Hand, mit Tempo und Takt inszeniert. Das lichte, luftighelle Bild einer Pariser Kaffeehausterrasse zum zweiten Einakter (Lois Egg) ist eines der freundlichsten, die man seit langer Zeit gesehen hat. In beiden Stücken war der als Erscheinung imposante und als Schauspieler ausgezeichnete Richard Münch der die Bühne absolut beherrschende Herr (Direktor und Präsident). Ihm ebenbürtig als Florence im „Lied der Lieder” Sonja Sutter in einer äußerst komplizierten Partie. Die bestens besetzten Nebenrollen spielten Günther Haenel (dem der alterfahrene Schauspieler und der raunzig- lebensweise Kellner wie auf den Leib geschrieben waren), ferner Angelika Hauff als gescheites und gutaussehendes Kassenfräulein, Thomas Egg als unwiderstehlich naiver junger Mann und ein gutes Dutzend anderer. Ein vergnüglicher Abend (obwohl sich das erste Stück genausogut zum Lesen wie zum Spielen eignet) und viel Beifall.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!