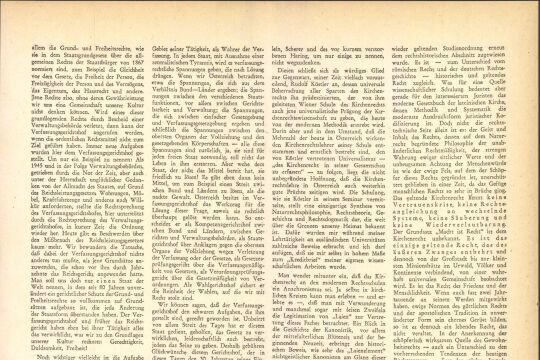Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vorostern auf der Buhne
Das Wochenende vor der Karwoche brachte Wien einige Premieren, die nach der Windstille auf unseren Bühnen in den letzten Monaten fast wie ein Sturm wirkten.
Alles überragend die glanzvolle Premiere der „Jüdin von Toledo“ im Burgtheater. Selten darf der Oesterreicher auf dieses sein Staatstheater und auf die Urkraft seiner Dichter so stolz sein, wie an diesem festlichen Abend. „Die Jüdin von Toledo“ wurde seit 1932 nicht mehr in der Burg aufgeführt, die heraufziehenden Schatten der politischen Wirren legten sich vor das Werk. Auch diesmal schien ein Mißgeschick die Aufführung emstlich zu behindern, ja in Frage zu steilen. Ernst Lothar, der verdienstvolle Regisseur, erkrankte während der Proben schwer; da sprang Hennann Thimig, der hervorragend diskrete Isaak dieser Aufführung, ebenso diskret und vorbildlich sich für das Werk des anderen einsetzend, als „Hilfsregisseur“ ein. Die Hauptdarstellerin, Annemarie Düringer, kennte erst mitproben, als die Proben längst im Gantre waren. Ei gab nicht wenige, die um diese Aufführung diese hochproblematischen Stückes zitterten.
Es gelang großartig. Die Düringer zauberte vom ersten Atemzug an eine faszinierende Seelenlandschaft auf die Bühne: einen Zaubergarten, in dem sich König Alfons VIII. .von Kastilien und das Publikum willig verführen ließen. Die Stärke dieses Trauerspiels liegt in seinen beiden ersten Aufzügen. Mit teilweise atemberaubender Wucht führt hier Grillparzer, ein Meister der Tiefenpsychologie, der das Dutzend bedeutender Erforscher der Seele und die drei Dutzend mit Psychologie arbeitenden Autoren nach ihm vorwegnimmt und oft überspielt (indem er sie nämlich unterspielt und in einem kurzen Vers Abgründe in der Seele anleuchtet), in den Konflikt. Hier der unerwachte, als Mann und Mensch ungereifte junge König, seine Pflichten als Staatsführer in schwerer Zeit, und dort d i e Jüdin Rahel, als Verkörperung ihres Volkes, als Inkarnation eines tausendjährigen Wissens um die Abgründe im Menschen und einer tausendjährigen Leidenschaft, in diesen Abgründen zu wohnen. Ahasver, der „un-behauste Mensch“, das ist hier diese Frau. Kein Halt, keine Sicherung ist ihr gegeben in Himmel und auf Erden, nur in ihrer Liebe. Der Schutz des Königs ist nur ein kleiner Talisman, den sie im . Innersten nicht ernst nimmt. Also hängt sie ihr Leben und das Schicksal der Ihren an dieser ihrer Liebe, ihrer Leidenschaft auf. Und stürzt, wie Kleists Penthesilea stürzt, ein Opfer ihres hohen Muts (sie ist kühner und tollkühner als alle die papierenen Ritter, die den König umstehen), als sich zeigt, daß der schwache Mann dieser Liebe nicht gewachsen ist. Hier setzt die Schwäche der beiden letzten Aufzüge ein. Gewiß: es „muß so ausgehen“. Der König kehrt zur Staatsräson zurück und zu seiner frigiden englischen Königin, stürzt sich in die Schlacht, den Sieg, und was Gott ihm zusenden mag. Die Jüdin muß untergehen: Sie trägt den goldenen Stern des Unheils vom ersten Auftreten an auf ihrer Stirn (sehr schön wird das in der Gestaltung der Rolle durch die Düringer sichtbar). Der Dichter läßt es aber in diesem Abgesang sichtbar an der Orchestrierung fehlen. Die großen Linien werden nur mehr angesagt, nicht mehr durchinstrumentiert. Staatsakt und Staatsräson sprechen die dürre Sprache der alten Staatstragödien. Der Dämon Raheis betritt die Bühne nicht mehr. Sein Zauber wäre zu stark, er würde alle guten Vorsätze des Königs über den Haufen werfen und die Mörder als hilflose phantasielose Schurken entlarven, die nur diesen einen Ausweg kennen. Und sie hindern, sich christlich anzuschmücken. Nur in einer letzten Geste Isaaks, der nach dem Golde immer noch langt, und in der ergreifenden Schlußszene der Esther (in dieser Gestalt scheinen alle die großen jüdischen Konvertiten des 19. und 20. Jahrhunderts bis zu Edith Stein vorweg erschaut), die glaubhaft, aus zerstoßenem Herzen, das große Verzeihen kündet, wird der D a i m o n des seligunseligen 'Gottesvolkes noch einmal präsent.
Die Schauspieler: die Burg hat einen neuen Helden und Liebhaber gewonnen. In Walther Reyer, der bereits mit seinem Debüt im „Kalten Licht“ Aufsehen erregte. Eine prächtige Erscheinung. Dann die Düringer. Dann Hermann Thimig als Isaak, Hennings als Manrique, Eva Zilcher in der wenig beneidenswerten Rolle als Leonore. Und die anderen. Das Publikum begriff sie alle in seinem lubel ein.
Hilde K r a h 1 macht mit einem vorzüglich zusammengestellten Ensemble eine Gastspielreise durch die Deutsch sprechenden Lande. Deutschland, Schweiz. Oesterreich. Jetzt sind sie in Wien, in der Jose f-Stadt, gelandet. Das Ergebnis wird wohl annähernd überall dasselbe sein: schlechte Kritiken für das Stück, gute für die Schauspieler, und ausverkaufte Häuser. Das Ehepaar Goetz kurz zuvor im Akademietheater hat das scheinbar unfehlbare Rezept ebenfalls befolgt. Reißer mit hochbrisant wirkenden Rollen, die das ganze Stück hindurch explodieren, eignen sich scheinbar am besten für solche Gastspielreisen, die auf Nummer Sicher gehen wollen. Der „Oberst C h a b e r t“, nach dem Roman Balzacs dramatisiert von Hans Rehfisch, ist ein solcher Reißer. Der Kampf eines totgesagten, vom „Kaiser“ selbst feierlich als gefallener Kriegsheld proklamierten napoleonischen Offiziers, zehn Jahre später in Paris um seine Frau, seinen Namen, sein Vermögen, wird da hineingestellt in eine Welt der Intrige, der Korruption. Die französische Gesellschaft der Restauration, ein Vorbild für den Fäulnisprozeß, dem so viele Reaktionen und „konservative“ Restaurationen nach ihr verfallen sind und wohl noch verfallen werden. In diesem Karneval der Gier, des Fleisches und der Machtsucht halten sich nur Haie, kleine und größere Raubfische, die aufeinander lagd machen. Hilde Krahl gestaltet faszinierend eine Frau, die von diesen Haien gejagt wird und zur größeren Hälfte selbst zu ihnen gehört. Das wird dem biederen, edelsinnigen Oberst zum Verhängnis. Viel Tränen, viel Zusammenbrüche. In eitel Heldengröße und Entsagung verläßt er die Bühne. Ein Bombenerfolg. Alle Mitspieler wären zu nennen, an “der Spitze Charles Regnier.
Das Volkstheater bringt in seinem Sonderabonnement für literarisch interessierte und aufgeschlossene Besucher die „W interwende“ von Maxwell Anderson, übersetzt von Hans Sahl. Uraufführung eines amerikanischen Stückes der dreißiger Jahre (mangels Uebersetzung bis jetzt verschoben). Eine tief pessimistische Stimmung überwellt damals, wie ein Sandsturm, die Vereinigten Staaten. Den Menschen liegt der Schock von 1929, der Börsensturz und die nachfolgende große Arbeitslosigkeit in den Gliedern, und. mehr noch, ein erstes Aufflackern eines Gefühls, den Boden unter den Füßen verloren zu haben. Den Boden des Rechts, der Kameradschaft, der Zusammengehörigkeit. Die „Gesellschaft“ scheint sich aufzulösen in Gangster, in Arbeitslosenheere, die mit den bezahlten Privatarmeen der großen Industrien kämpfen. Allein ist das Herz. Es wird zerbrochen. Die Gerechtigkeit ist in den Händen von bezahlten Justizagenten oder von irre werdenden Fanatikern (die großartige Erscheinung dieses Abends: Günther Haenel als Richter Gaunt, der an einem Justizmord, den er begangen hat, zerbricht). Ander-' on drängt diesen Alpdruck der dreißiger Jahre zu-' sammen an einer düsteren Kaimauer in New York,' die er mit Schüssen, Aengsten, Toten überreich bestückt. Zuviel des Verderbens. Da auch die beiden Einsamen, die Liebenden, unter den Schüssen der Verbrecher fallen müssen (Kürt Sowinetz und die leider zu larmoyante Maria Urban), verkehrt sich der starke Sinn dieser amerikanischen Tragödie in Widersinn. Bleiben einige sehr stark wirkende Szenenfetzen, in denen Lyiismen, Wahrworte und Handlung sich binden. Leon Epp hat als Regisseur sehr gestrafft und auf echten Eindruck hin gearbeitet, Gustav Manker hat ein starkes Bühnenbild geschaffen, das den Alp nachwirken läßt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!