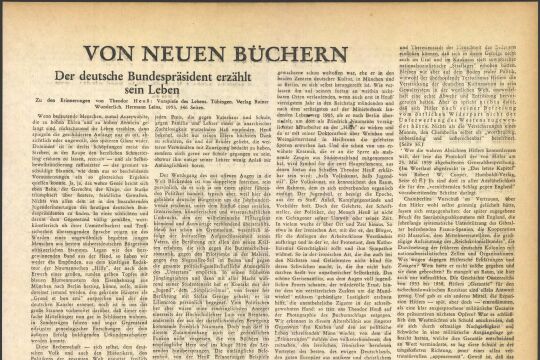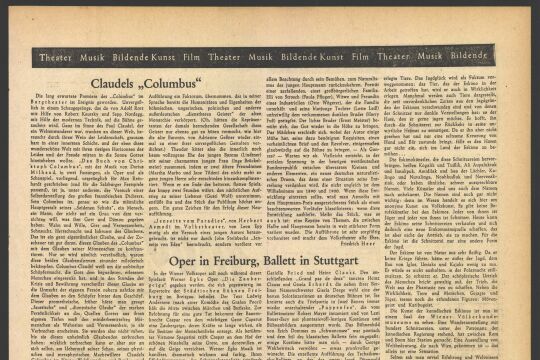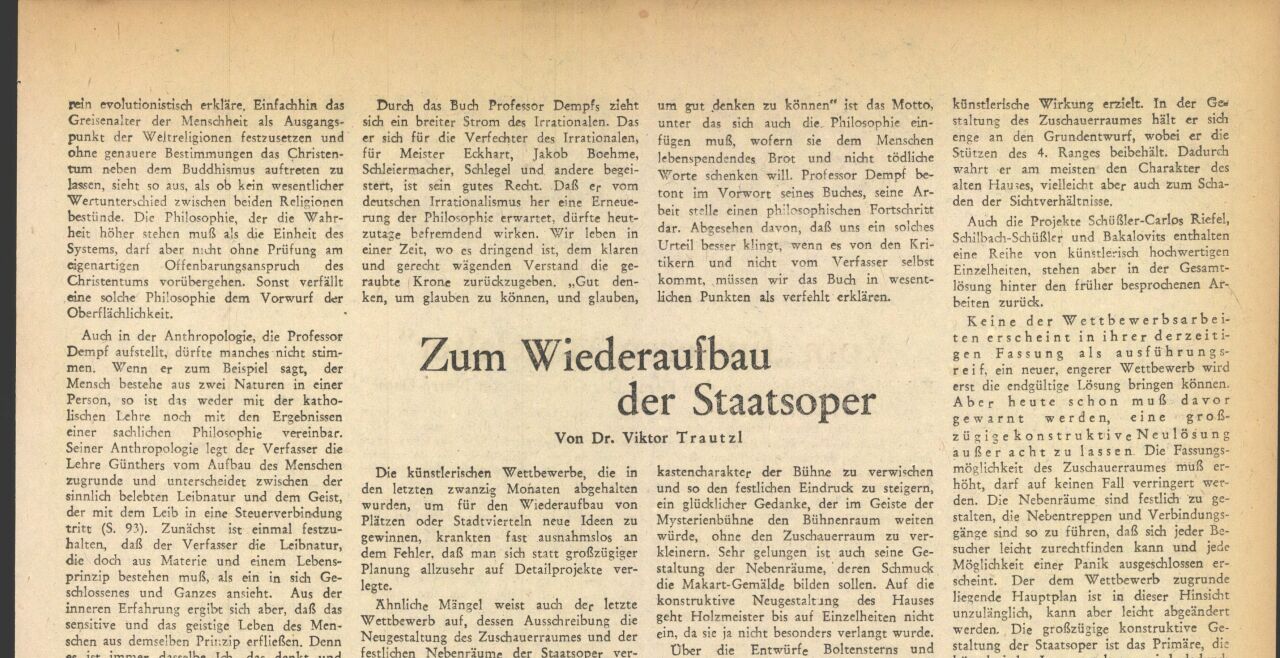
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ibsen und Faschingsspiele
Das Volkstheater hat sich die achtbare Aufgabe gesteht, klassische Stücke der Vergangenheit mit einer besonderen gesell- schaftkritischen Note ins Rampenlicht der Gegenwart zu stellen, und hat dem’ Publikum dergestalt bereits zu überraschenden Neuentdeckungen verholfen. So kam da ein N c s t r o y zum Vorschein, der weit über Individual-, Zeit, und Situationskomik und -kritik hinaus sich als großartiger unbestechlicher Richter des ständischen Scheinkosmos seiner Epoche enthüllte — und nun folgt ein Ibsen, der, wie das Publikum aufs neue überrascht, feststellen muß, unserer Zeit mehr zu sagen hat, als sie vermutet, ja als ihr oft lieb ist. „Ein Volksfeind” zeigt die Ballung der Konfliktstoffe unserer Zeit, die Dynamik der Gegensätze Masse-Persönlichkeit, die Problematik von „Demokratie”, Volksführung und Freiheit auf: im Puppenhaus des 19. Jahrhunderts, in einer kleinen abgelegenen Provinzstadt des Nordens. Als der Badearzt Doktor Thomas Stockmann, der geistige Schöpfer und Initiator des Aufsdiwungs seiner Heimatstadt zum Kurort mit Rang und Namen, im Wasser des Heils giftige Bakterien entdeckt, zwingen ihn seine Mitbürger, diese vorerst nur medizinische Entdeckung auszuweiten ins Soziale, Gesellschaftliche, Allgemeinmenschliche hinein. Diene Braven und Guten, diese Konservativen und Liberalen, diese Fortschrittlichen und Reaktionäre, diese Mittel-Unter, und Uberständler — was gelten ihnen sittlicher Anstand und gemeinsinniger Verstand, Wahrheit und Freiheit? Nun, da sie ihren Verdienst und Gewinn bedroht sehen — durch diese bösartige Enthüllung einer ihrem Erwerbssinn unbequemen Wahrheit — erklären sie den Volkskrieg gegen ihren Doktor und deklarieren ihn zum Volksfeind. Daß es nur bei Kündigung der Wohnung, Entlassung aus dem Dienst, Verfemung seiner Familie, einigen zerschlagenen Fensterscheiben und anderen Unfreundlichkeiten bleibt, ist der Gutmütigkeit dieser kleinstädtischen Biedermänner zu verdanken: in anderen moderneren Zeitläuften wäre er längst exekutiert worden: durch ein Volksgericht.
Hier aber stockt die Geschichte — ein Riß tut sich auf — die Zeitspanne und der Unter- schied der Sphären und Atmosphären erweist sich plötzlich als beklemmend groß. Dr. Stockmann, der nun, nach dem rolligen Scheitern seiner Stadtbeglückungspläne (wollte er nicht eine Sanierung der Leiber und der Seelen?) zum ‘modernen Volksredner wird und zum Umdenken aller alten Werte, zum Umsturz der Stadtordnung, aufruftį agitiert nicht unter den Massen des 20. Jahrhunderts in einer Fabrikhalle von Berlin, Essen oder Paris, sondern eben nur in einer winzig kleinen norwegischen Prövinzstadt der Gartenlaubenzeit: hier gibt es nur Sturm im Wasserglas, ein paar ‘ schnaubende Männerbärte, Mäddhentränen und eben, zerbrochene Fensterscheiben. So echt der Grundansatz, das große primäre Anliegen Ibsens — die Aufzeigung der Lebenslüge der Gesellschaft — ist, so deplaciert ist die Revolution in d:esem Hühnerstalle, wo um den eitlen Oberhahn, den Bürgermeister Peter Stockmann, und um einige ehrgeizige Nachwuchshähne — die Redakteure des „Volksboten” — Leberecht Hühnchen und anderes männliches und weibliches Hühnervolk den kleinen Tanz der Eitelkeiten und des Futterneides stelzen.
Regie und Ensemble des Volkstheaters müssen etwas von diesem Konflikt um Ibsen 1948 verspürt haben: man hat also versucht, dies innere Brüchigkeit zu überspielen — durch komödiantisches Temperament (Wolfgang Heinz als Dr. Stockmann), durch Kürzungen und Retouschen mannigfacher Art — und ist dergestalt in manchen Szenen und Momenten gewollt-ungewollt ins Burleske und Groteske verglitten. Verträgt dies aber Ibsens tragisches Schauspiel? Wir glauben nicht! Nichts ist den großen Nordländern ferner als der menschlich-milde Humor der Südwelt, der Romania und Catholica, des Weinlandes, der Hügel des Maßes und der Mitte — die gläserne blitzende schwertgrasgrüne Heiterkeit des Nordhimmels, die Lache des Trollgeistes bei Grog, Punsch und Gewittersturm gehört einer anderen, uns sehr fernen Welt an. Strindberg mußte an der Wachau scheitern …
Und in diesem Punkt scheitert leider, trotz heißem Bemühen, auch der neue „Volksfeind” des Volkstheaters: eine sparsamere,- zügigere und straffere Aus-Zeichnung der wesentlichen Kraftlinien dieses noch immer starken Stückes hätte der Aufführung gut getan — dazu ein Schuß Inselkälte.
1931 hait es Max Reinhardt in Berlin gewagt, Franz Molnars „Jemand” auf der Bühne jenes Leben zu geben, welches dieses Stück an sich nicht besitzt. Ohne damals viel Erfolg zu ernten. Wir wissen also nicht, aus welchem Grunde dieses Wagnis 1948 in Wien von der in der letzten Zeit so rührigen Renaissancebühne widerholt werden mußte. In Luxushotels und Scheinschlössern, wie sie der Welt der Abraham-Operetten und Ufafilme damals dutzendweise zur Verfügung standen (zumindest auf der Bühne und im Atelier), spinnt ein charmanter ‘ alter Hochstapler jene Lügengewebe, die seiner unglücklichen und unzufriedenen Tochter eine gesicherte, ruhige Existenz vermitteln sollen: er erfindet ihr einen Gatten, einen Herrn Jemand”! Ach, die Lügen — sie waren nicht einmal aus Kunstseide! Darf man es der bösen Umwelt verargen, daß sie dennoch so bald als möglich von dem nicht vorhandenen gräflichen Gatten profitieren will, da sie ihn bereits voll und ganz einbezieht in den Kampf, die Jagd und vor allem die Rechnungen ihres Betriebes? — Nicht dies ist an dem Stück zu beanstanden: die Fülle der Banalitäten, des wenig sauberen Spieles zwischen Vater, Tochter und Schwiegersohn in spe; nicht auch die Tatsache, daß Molnar selbst in dem alten Tricheur gefällig lächelnd sich selbst gebildet hat; wohl aber jene: daß dieses leichte Spiel auf Schritt und Tritt an den Ernst, an Entscheidungen des Lebens, der Wirklichkeit mit ilren echten Fragestellungen und Forderungen anstreift — und verlegen lächelnd auskneifen muß, weil es eben nur ein kleines Spielchen im Frack sein darf. Der peinliche Eindruck also: Puppen der Konfektionsindustrie, welche den Hintergrund des Schaufensters, der Firma „Molnar Lust- spiel-G. m. b, H.” nicht ganz verstellen können: dort gehen müde Menschen nach Hause — die Angestellten des Lebens und das Publikum. •
Eine Erstaufführung bringt die Insel: „Liebe, List und lauter Lügen” von Erich Ziegel. Eine Komödie nach Motiven des Lustspielfabrikanten des elisabethanischen England, des Thomas Heywood, versetzt in ein Venedig zwischen Goldoni und Guardi, bestimmt für den Wiener Fasching. — Die alte gute Mär von der Läuterung des reichen Taugenichts (Lėlio) durch die Liebe der schönen und tugendsamen Sängerin (Beatrice), vom neckischen Spiel der Zofe (Fiorina) und des Vertrauten-Dieners (Nicolo). Was wird daraus? Ausgelassen beschwingte, kapriziös tänzelnde, vibrierende, überschäumende Commedia dell’- arte?
Nein. Diesen hochbegabten jungen Schauspielern fehlt etwas — und dies ist vielleicht ein beachtenswertes Symptom unserer Zeit — es fehlt ihnen die Leichtigkeit und die reflexionslose Sicherheit des Scherzes. Helmut Janatsch als Lėlio und Eva Zilcher als Beatrice sind in jedem Augenblick des Spiels in Gefahr, zu Romeo und Julia zu werden Selbst Paul Kemp als Nicolo fällt der romantisch-treu- herzig-wannen Atmosphäre soweit zum Opfer, daß er weniger ein spitzbübisch-glatter Florettfechter seines Lügenspiels als vielmehr ein treu-deutscher Hausknecht, ein treuer Diener seines Herren ist, dem es im Grunde peinlich ist, lügen zu müssen — lieber wäre ihm die Teilnahme an dem Festschmaus, dessen Speisenfolge er, als Abschluß des Stücks, dem aufmerksamen Publikum verrät. Dolores Hubert — als Fiorina, sie allein trägt den Schwung und Charme der Faschingswelt — die Zofe.
Als Ganzes: ein sehr kultiviertes, gefälliges wohltemperiertes Spiel. Ein Abend, zu dem vornehme ältere Damen junge Cousinen, die vom Lande zu Besuch kommen, laden: dezent und distinguiert, etwas eintönig.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!