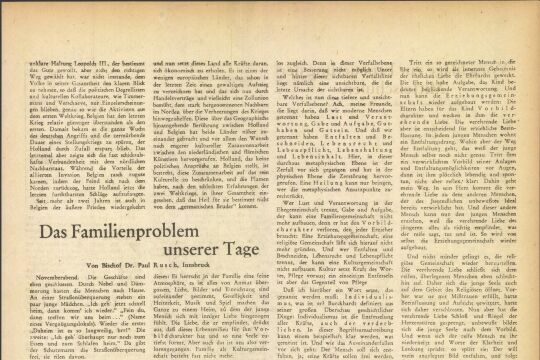Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Drei Stücke, drei Welten
In den Kammerspielen gibt es „Die vollkommene Ehe“ von S. Raphaelson, verdeutscht von A1- fred Polgar, zu sehen. Zu sehen, denn zu sehen gibt es hier weit mehr als zu hören: es sind die wechselnden Toiletten der Frau Susanne von Almassy. Da aber dieses Schauspiel auch ein Hör-spiel sein will, lassen sich Komplikationen nicht vermeiden: der Zuschauer ist also genötigt, das Geplätscher der Dialoge, das Geräusch der Schallplatten, das Plappern eines Bühnenkindes mit Fassung über sich ergehen zu lassen; dieweil ihn nichts, aber schon gar nichts an diesen Gesprächen zu interessieren vermag. Die Worte sind hier nur kleine bunte Sternchen, welche sich Er und Sie in einem Spielbecher, mutwilig schüttelnd, zuwerfen. Sie und Er sind zehn Jahre lang verheiratet und zergähnen und zerplaudern sich am Feiertage der Erinnerung, beim Stiftungsfeste ihres Lebensbundes. Beruf und Betrieb des Lebens haben sie auseinandergebracht — wie viele Tausende vor und neben ihnen in dieser Zeit. Während jene Tausende aber scheitern oder erst nach schwersten Bewährungs- und Belastungsproben wieder zueinanderfinden, haben es diese Leutchen auf der Bühne nicht nötig, sich mit der Wirklichkeit und ihrer Härte auseinanderzusetzen. Gut gespielt, zumal vom Trio Almassy-Skodler-Meinel, läßt dieses Stück das Theater in der Rotenturm- straße für zwei Stunden zu einem Automatenbüfett werden: kleiner Imbiß der Laune für Vorübergehende.
Wie arm an Substanz und Herzkraft die hier dargestellte Flitterwelt moderner Flappermenschen ist, zeigt, in starker Kontrastwirkung, der neue Nestroy des Volkstheaters. „Zu ebener Erde und erster Stock“ oder „Die Lau- nendesGlück s“. Es ist das alte Thema Nestroys, dessen liebender Zorn die innermenschlichen und gesellschaftlichen Gegensätze seines Zeitalters immer wieder in neuen Bildern und Gestalten beschwört, mit ätzendem Stichel skizziert, warnend, polternd anklagt und durch seine Darstellung zu überwinden trachtet.
Im Oberstock, im säkularisierten Paradies, lebt in Schmaus und Braus die Familie des Herrn von Goldfuchs, des „Spekulanten und Millionärs". Im Unterstock, in der weltgewordenen Kleinhölle, existiert die Familie des „armen Tandlers" Schlucker mit fünf Kindern und einigen beschwerlichen Anhängseln. In diesem Stück von den „Launen des Glücks ‘ ist aber Nestroy selbst ganz guter Laune: der Hochmut der „Obe ren“ kommt zu Fall, die bösen Buben (Monsieur Bonbon und der Bediente Johann) erhalten ihre wohlverdiente Strafe, die Unter-weit rückt zu den fadenscheinigen Ehren der Ober- (Uber-) Welt auf. Ein Terno in der Lotterie, eine indische Erbschaft: Frau Fortūnas Füllhorn (das breitgolden über der Bühne hängt) hat sich, einmal wenigstens, der Kehrseite der Gesellschaft zugeneigt. Ein Zwitschern und Trillern, ein singendes Sagen anmutigster Heiterkeit schwingt über die Bühne und überwölbt den Raum dieser guten Welt wie eine glückselige Märchenhenne, welche den armen Kindern dieser Welt Goldeier legt...
Inszenierung, Regie und Bühnenbild haben mit großer Delikatesse die innere Stimmung dieses sozialen Märchenstücks erfaßt und diese ganz in seidig-sicheres Himmelblau gewandet. Mit Recht wurde auf die sonst gegenwärtig so stark in Mode gekommene Zuschärfung der Nestroyschen Couplets und Wortspiele auf das kleine Glück und große Leid unserer Tage nahezu verzichtet.
In dieser geschlossenen Welt, in der das blind-lächelnde und weise schenkende Glück regiert, gibt es keine Charaktere, keine Einzelpersonen im präzisen Sinne tragischer Eigenständigkeit: nur „Rollen“ (und hier zeigt sich wieder die letzte Verbundenheit von Wiener Hoch- und Praterbarock), nur Spielfiguren, bei denen es wesentlich auf das Zusammenspiel ankommt. Gemeinsam haben sie den Reigen zu drehen, nur verhaltenste demütige Bescheidung erlaubt es ihnen nämlich, ihre Rollen zu tauschen, Ober- und Unterstock zu wechseln, ohne aus der Sicherheit, ohne aus dem Zauberkreis dieses Kosmos herauszufallen. Der gefallene, armgewordene Herr von Goldfuchs soll ja noch zu Gnaden kommen — durch die Hand des reichgewordenen Tagschreibers Adolph, der hochsteigende Tandler Schlucker muß sich, in dem solange umträumten Himmel der „gehobenen Position“ angelangt, mit den Schleifen neuen Protzentums zieren lassen. Das Gelingen der Aufführung hängt also ganz vom Ensemble, von seiner inneren Einheit, von seinem Zusammenspiel ab — und hier gab es eine Meisterleistung des Volkstheaters, welche den Erfolg dieses Nestroys sichern wird.
Aus der blauen Sicherheit dieses Märchenspiels treten wir in die Ungesichertheit, in die Gefährdung unseres Tages: in der Uraufführung des Stücks „Entscheidende Stunde“ von Michael Kehlmann im Studio der Hochschulen. Das 1945 geschriebene Werk des sehr jungen Autors ist bühnenmäßig und ideologisch gesehen eine etwas monströse Sache: Traumsphären, Theaterzauber, Wirklichkeit und ins Unterbewußte abgesackte literarische Erinnerungen mischen und mengen sich hier, auch im Bühnenbild, zu einer Zwitterwelt. Unter- und Überwelt werden von ihm als schnellfüßige Hilfstruppen zur Verteidigung seiner Position herbeigeholt — seinem
Exerzierreglement haben sich die Duse und Leonidas, Frankin und Herder, Goya und Balzac und etliche andere zwiesdilächtige Figuren zu stellen.
Und doch: seht euch das Stüde an! Laßt euch nicht verwirren durch seine sehr augenfälligen Fehler, Fehlgriffe und -tritte! Hier spricht ein junger Mensch. Hier ruft, bittet, bettelt, fordert, heischt die Not einer jungen Generation um Gehör: soll wirklich wieder ein neuer Krieg die Menschheit in den Abgrund des Nihilismus stürzen, müssen unsere jungen Burschen und Mädchen zerhämmert, zerrieben werden von den
Mahlsteinen einer unmenschlichen Maschine, deren Büttel „Herr“, „Staat“, „Arbeitgeber“, „Minister" heißen, die aber auch andere sehr zeit- und gesellsdiaftsfähige Namen tragen? Darf es keinen Idealismus, keinen Glauben an eine Menschheit und eine bruderschaffende Menschlichkeit geben? Muß und soll weiterhin jeder Ansatz, jeder Keim einer Widerstandsbewegung der Anständigen und Guten wider das Unanständige und Gemeine erschlagen werden in den
Herzen der „Jungen" durch die Gleichgültigkeit, Brutalität und nüchtern-kluge Grausamkeit der ewig „Alten“, ewig „anderen“ aller Zeiten? Soll der Kreislauf des gewohnten Bösen auch das letzte Kind, den letzten „neuen Menschen“ verschlingen? Dies die Thesen Kehlmanns.
Das Ende des Stücks ist kein Ende, sondern ein Appell. Ein Anruf an eben diese Jugend dieser Welt, an alle Menschen, die es angeht: noch ist die letzte Schlacht welche über unser Schicksal entscheiden wird, nicht geschlagen, sie muß in uns geschlagen werden!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!