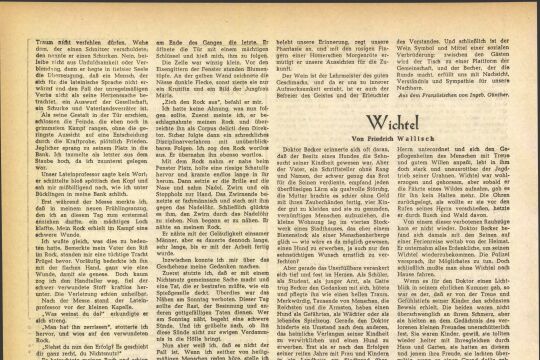Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wenn Franzosen träumen
Jean Anouilh mischt in „Leocadia“ mit der geschickten Hand des Erztheatralikers Motive eines modernen Kunstmärchens mit denen des Volksmärchens. Sein melancholischer Prinz trauert einem Phantom nach — der Sängerin Leocadia, einer preziösen Schönheit, die sich vor Jahren gelegentlich einer Diskussion über Bach durch eine vehemente Geste mit ihrem eigenen Schal erdrosselt hatte. In einer Art Freilichtmuseum des herzoglichen Parkes stehen alle Stätten der großen Liebe — ein schon von Efeu umsponnenes Taxi, ein Nachtlokal, eine Kaffeeschenke samt allem Personal —, die den Schwermütigen ständig an die Unvergeßliche, die er bloß drei Tage gekannt hat, erinnern. Seine hochmütige und exaltierte Herzogintante engagiert eine Pariser Putzmacherin, die erst widerwillig, aber schließlich freiwillig als Double der toten Leocadia durch ihr jungfrisches, völlig unkompliziertes Wesen den Prinzen aus seinem müßigen Traumleben erweckt. Der spannende Kampf zwischen der gesunden Lebenskraft des Mädchens aus dem Volke und der makabren Versunkenheit des jungen Mannes aus hochadeligem Geschlecht, den in hellen Augenblicken eine glasklare und selbstkritische Intelligenz auszeichnet — das ist Komödie. Mag sein, daß dem Stück im Französischen ursprünglich ein politisch-satirischer Doppelsinn eigen war: das alte, konservativ versteinerte Frankreich auf der einen, das der Trikolore, des hellwachen Verstandes und des gute« Herzens auf der anderen Seite. Heute merken wir in diesem poetischen Spielwerk zwischen Sein und Schein nur noch den Wechsel von dunklem Ernst zu heiterem Rosa, zwischen unübertrefflich Komödiantischem und Banalem. Das Stück beginnt mit einer unnachahmlichen Replik der Herzogin und der stellungsuchenden Pariser Midinette: „Da sind Sie also! — Ja, ich glaube — Warum sind Sie nicht größer? — Ich weiß nicht, Madame“, und endet mit einem Operetteneffekt, wenn die Putzmacherin ihrem Traumprinzen sein Schattenbild hinwegküßt — und das Publikum schon ein wenig ungeduldig geworden ist.
Die Aufführung im Theater in der Josefstadt unter der handfesten Regie Otto Schenk« und in den neutralen Bühnenbildern von Roman W e y 1 hält sich mehr an das Schwankhafte als an das Schwebende des romantisch-ironischen Märchenspiels. Johanna v. K o c z i a n als Modistin Amanda spielt das anmutige Naturkind mit Mutterwitz, Helmut Lohner den Prinzen mit modernen Hamletzügen, denen man nur ein wenig mehr überlegene Selbstironie wünschte. Helene T h i m i g gibt die Herzogintante auf der Linie zwischen komischer Überspanntheit und Manier, während man Hans 01 d e n bei dem leicht angetrottelten Baron Hector leider auf einen einzigen und darum eintönigen Charakterzug festlegte. Unter den Chargen gefielen Peter Gerhard als Kammerdiener und Carl Bosse als Oberkellner.
Bei einer Aufführung von Jean Genets „Wände überall“ kommt einem die verblüffende Spannweite des französischen Theaters erst so recht zu Bewußtsein. Jean Anouilh, Schneidersohn aus Bordeaux, Moralist und kultivierter „Stückemacher“, als den er sich gern selbst bezeichnet, schreibt Bühnenwerke, die nach der Meinung eines klugen Theatermannes wie „stehengebliebene Denkmäler einer verlorenen Welt, ein Stück schönen Seins inmitten eines Ozeans ▼on Gewöhnlichkeit“ anmuten. Jean Genet, „poete maudit“ mit einer höchst anrüchigen Vergangenheit, schreibt Stücke, die wie die Provokation einer anarchischen Gesinnung und Kunst wirken. Anouilh ist ein typischer Vertreter der Garte als Inbegriff von Klarheit und Logik des Denkens, von Formstrenge und Witz. Genets faszinierendes Theater dagegen ist prunkvoll und dunkel, eine seltsame Mischung von Poesie und Boulevardeffekt, so wie in seiner Sprache die Leuchtkraft des Lyrischen, Pathos, Leitartikel, Straßenjarcon mrl ordinäre Zote dicht nebeneinanderstellen.
Sein auf vielen Ebenen zugleich spielendes Schauspiel „Wände überall“ soll das erste von sieben Dramen zum Thema des Todeä sein, offenbar der Beginn eines Zyklus über die sieben Todsünden. Sünde aber bedeutet für Genet einen Zustand der Auserwähltheit, der nicht von Gott, sondern von der Gemeinschaft sondert. Genet bietet eine symbolisch verschlüsselte Algerien-Phantasie. Eingeborene stehen gegen Franzosen, in der aufgeführten Bearbeitung verschämt „Europäer“ genannt. Drastisch zeichnet er die Verkommenheit und den Schmutz bei den Arabern, Hochmut und dumme Leere bei den Kolonial-Franzosen und Legionären. Inmitten stellt er das algerische Paar Said und Leila mit Saids Mutter. Er, der Ärmste des Landes, hat das häßlichste Mädchen des Landes geheiratet, weil sie billig war. Leila liebt Said, der ein Dieb ist, zu den Dirnen geht und am Ende seine Landsleute an die Franzosen verrät. Verstoßen und verdammt, nimmt das Paar das Böse und die Schlechtigkeit aller auf sich und opfert sich für die Dorfgemeinschaft. Um sie herum die Klageweiber, Schicksalsweiber, abstoßend, grell und wild, und das Freudenhaus mit seinen käuflichen Objekten. Dieser „Realität“ setzt Genet das Reich der Toten gegenüber, nur durch eine dünne Wand von den Lebenden getrennt.
Es bereitet nicht wenig Mühe, die zahlreichen Bezüglichkeiten in dieser surrealistischen Verquickung von absurdem mit poetischem Theater zu enträtseln. Die dreistündige Aufführung im Volkstheater — an sich ein kühnes Wagnis — unter der sehr bemühten Regie von Leon E p p und in den phantasievollen Bühnenbildern Hubert A r a t y m s konnte dem um mehr als ein Drittel gekürzten Werk nur andeutend gerecht werden. Von den über 50 Mitwirkenden seien Elisabeth E p p als Saids Mutter, Klaus Höring als Said und Julia Gschnitzer als Leila besonders hervorgehoben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!