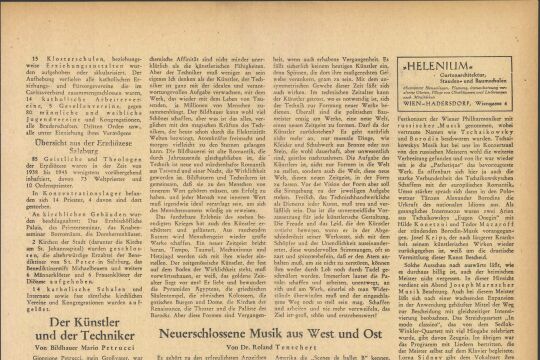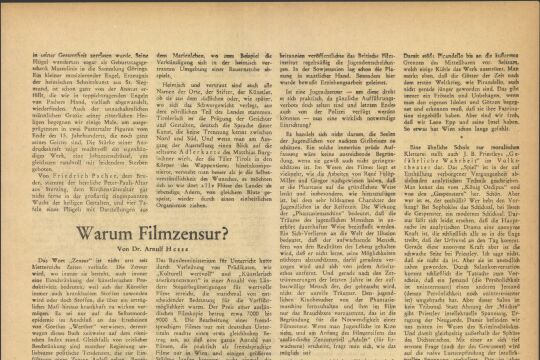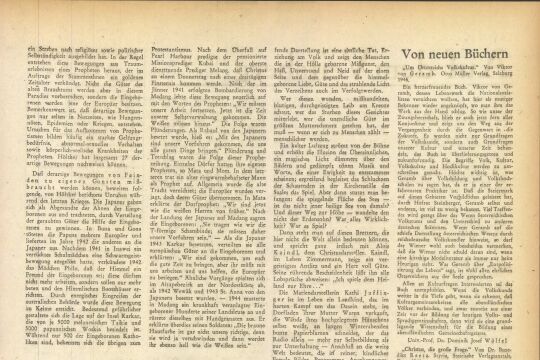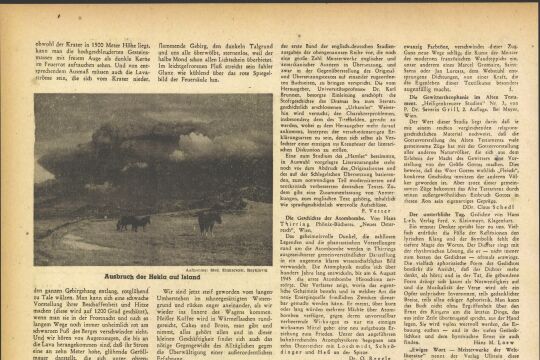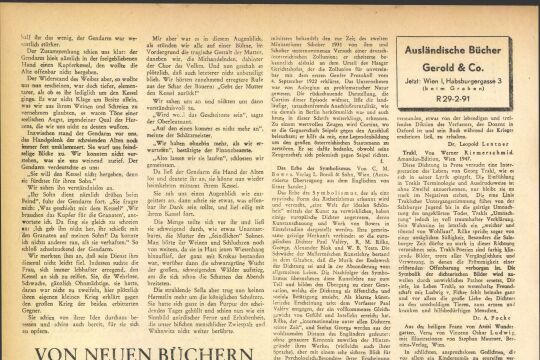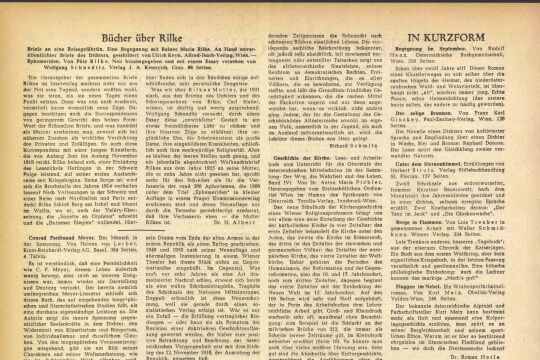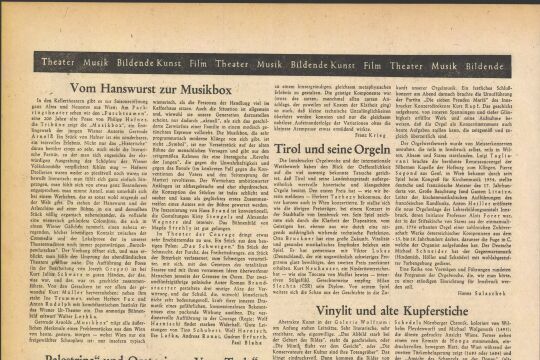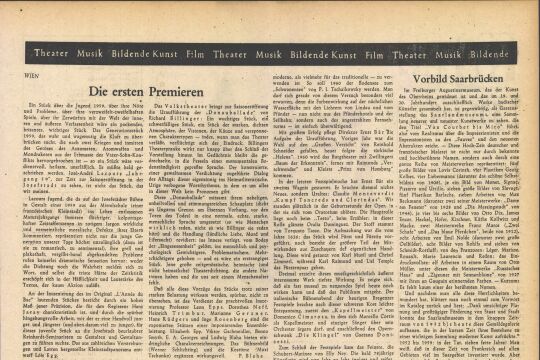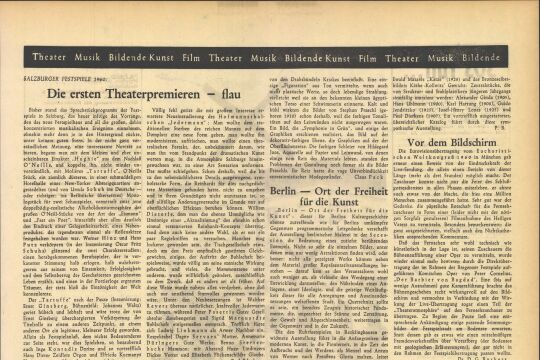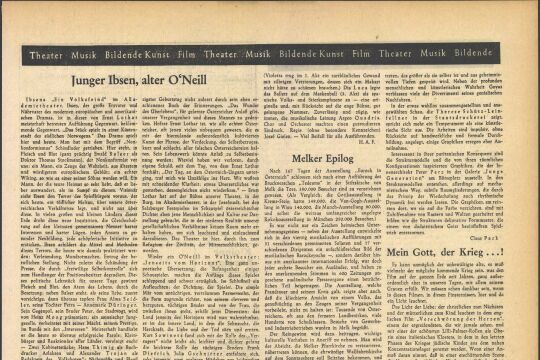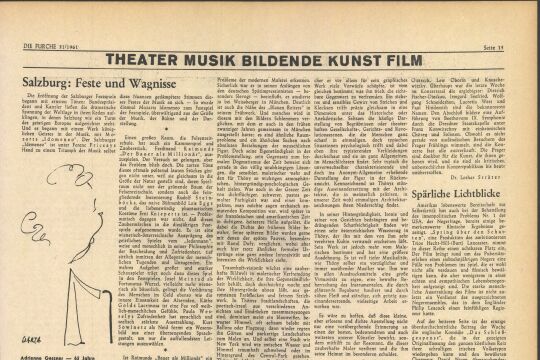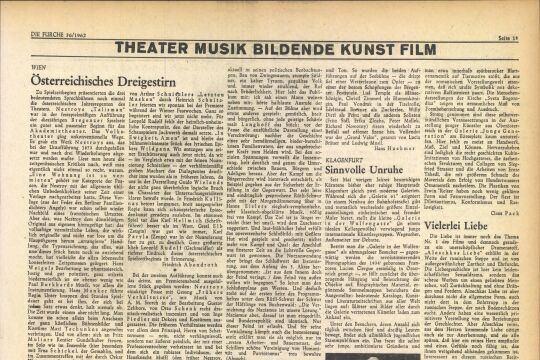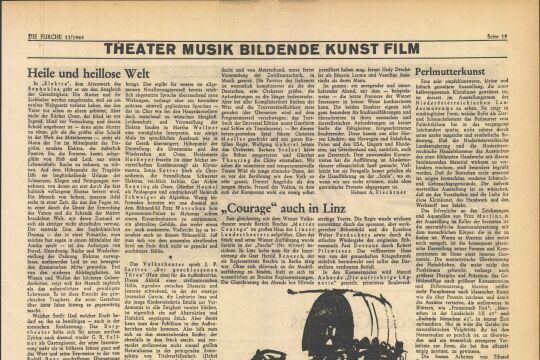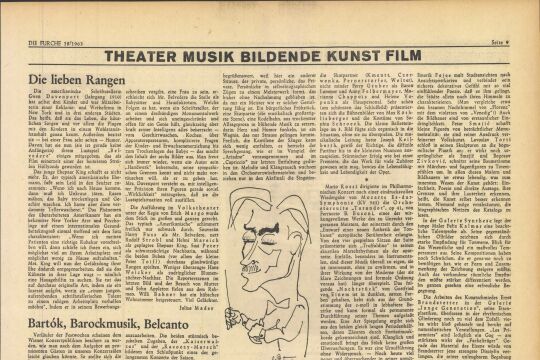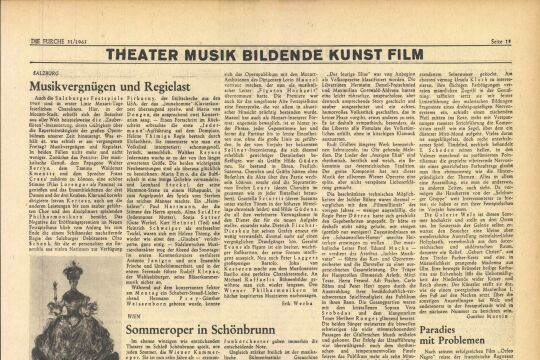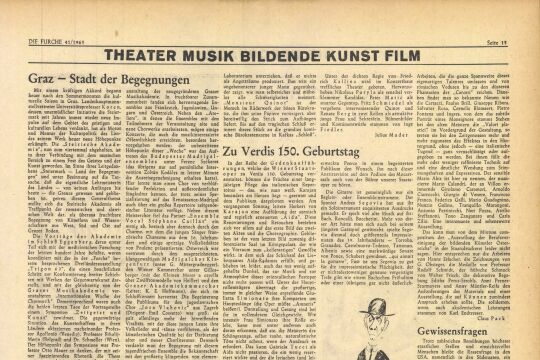Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ganz Herz, ganz Gefühl
„O, wenn ich jetzt nicht Dramas schriebe, ich ging zugrund“, vertraute Goethe während der Niederschrift seines Schauspiels „Stella“ einer Brieffreundin an. Also ist es unmittelbares Bekenntnis, Ausdruck des eigenen innersten Lebens einer allzu getriebenen Jünglingsseele. Die verlassene Liebe (Friederike), die gegenwärtige Liebe (Lilli), versetzten den Sechsundzwanzigjährigen in einen Zustand innerer Zerissemheit, in eine Stimmung zwischen Sehnsucht und Bedrückung, Zärtlichkeit und Freiheitsdrang. Flucht und Wiederkehr, Gebunden-und Getrenntsein: das sind die Goethe und Fernando gemeinsamen Erlebnisse. „Denn was geht dem Menschen über seine Freiheit?“ sagt Lucie zu Fernando in „Stella“. Dieses „Schauspiel für Liebende“ ist kein ins Psychologische aufgelöstes Problemstück über eine Ehe zu dritt, sondern ein Spiel im Geiste schwärmerischen Rokokos, ein Stück lauterer Poesie, worin es keine Charaktere, keine Helden gibt, denn der einzige Akteur ist die Liebe — im Kampf gegen bürgerliche Konvention. Für den Zuschauer von heute geht freilich diese zur reinen Empfindung gewordene Passion dreier Menschen, zwei Frauen und ein Mann, der sie beide sucht und flieht, und die alle an einem unwirklichen Ort und bei einer unwahrscheinlicher Gelegenheit zusammentreffen, wie in einem sozial hiftleeren
Raum vor sich. Nicht „warmes, pulsierendes Leben“ erfüllt ihn, sondern eine Schönheit, die eher im Lyrischen als im Dramatischen liegt. Die für Poesie — und welche Dichtung! — Empfänglichen werden Goethe willig folgen, andere wieder werden den Abstand gegenüber jenen Tagen der überquellenden Gefühle empfinden.
Mit Recht wurde in der Aufführung im Akademietheater der versöhnlichere (ursprüngliche) Schluß gewählt, der dem Wesen des Schauspiels besser entspricht, und nicht det tragische (spätere) mit Gift und Pistole. Die einfühlende Regie Rudolf Steinboecks versuchte denn auch, mehr das Unwirkliche, fast Märchenhafte de« Geschehens zu verdeutlichen. Wird doch in der Schlußszene die Parabel des Grafen von Gleichen zitiert, ein Anruf himmlischer Mächte, das menschlich Verworrene zu lösen. Das schöne Bühnenbild von Lois Egg kommt dem sehr entgegen: es fehlen die Wände, nur Holzrahmen deuten die Grenze des Raumes an, wo die Seelen sich erkennen.
Das Stück gibt Rollen her, allerdings schwierige. Für eine Schauspielerin der Gegenwart ist es schwer, eine „noch ganz in dem Gefühl der jüngsten, reinsten Menschheit“ lebende Mädchengestalt, überfließend von Zärtlichkeit und Schwärmerei, zu spiele». Aglaja Schmi d als Stella gelang es fast vollkommen. Paula W e s s e 1 y war als Cäcilie überzeugend und echt in jedem Ton. Ergreifend der Übergang aus der trauernden Resignation der verlassenen Gattin zur schmerzlich-heiteren Überlegenheit, zur ewigen Schwesterlichkeit der Frau, „die, aus Liebe, selbst ihre Liebe hinzugeben vermag“. Walther R e y e r vermochte als Fernando, der unentschlossen zwischen den beiden Frauen schwankt, jede drohende Sentimentalität und Unmännlichkeit zu vermeiden. Von den übrigen Mitwirkenden seien noch Loni F r i e d 1 als Töchterchen Lucie, Lisi K i n a s t als resolute Postmeisterin und Wolfgang Gasset als Verwalter hervorgehoben.
Die Budapester Vorstadtlegende Franz M o 1 n & i s „L i 1 i o m“ wird in der Bearbeitung Alfred Polgars vielfach als Wiener Volksstück reklamiert. Daß es M o 1 n ä r s bestes Stück ist, dürfte heute unbestritten sein. Allerdings — ein Wiener KaffeehauslitCTat bot einmal für „Liliom“ in aller Öffentlichkeit „den ganzen Grillparzer mit einigen Bänden Hofmannsthal als Zuwag'“. Und ein anderer meinte, die Literatursnobs des Jahres 2100 würden über die Frage debattieren, wie man denn Molnär und Goldoni eigentlich zu spielen habe. Molnär als „unsterblicher“ Klassiker des Theaters — darüber ließe sich nun freilich streiten.
Die Geschichte von dem Hutschen-schleuderer, dem Pratercasanova Liliom. einem brutalen, aber ganz zutiefst doch weichen Kerl, ist im naturalistischen Teil nicht ohne Sentimentalitäten. Aber nach der ironischen Himmelszene, in der ein ..himmlischer“ Präsidialist diesem irgendwie rührenden Lümmel von Mann nach Jahren guter Führung einen kurzen Besuch bei den Seinen auf Erden gestattet, damit er die im Leben versäumte gute Tat nachhole, folgt die Schlußszene — und die stammt von einem wirklichen Dichter. Die Szene, da Liliom dem Kinde, seiner Tochter, vor der er unerkannt steht, auf die Hand schlägt, weil sie den „mitgebrachten“ Himmelsstem zurückweist — doch der Schlag, der deutlich zu hören war, schmerzt nicht. Erstaunt wendet sich das Mädchen an die Mutter. Und da sagt sie, die so oft von Liliom im Leben geschlagen wurde: „Es gibt Schläge, die nicht weh tun; doch, es gibt Schläge, die man nicht fühlt.“ Und in diesem einen Satz ist alles Leid und alle Liebe und alle Zartheit.
Keine der ,Xiliom“-Aufführungen aus den letzten Jahren konnte ganz befriedigen, auch nicht die jetzige B u r g -t h e a t e r inszenierung im Theater a. d. Wien. Die Mischung von Realismus und Legende, von Rührseligkeit und Poesie gibt dem Regisseur zu schaffen; zudem ist Liliom eine volle, runde Bühnengestalt, die nach einem großen Schauspieler mit besonderer Ausstrahlung verlangt. Der Regie Kurt M e i s e 1 s geriet manches zu überlaut grell (Praterszene), anderes wieder zu wenig gerafft (Unterhaltung der Dienstmädchen in der Praterau). In Lilioms Sterbeszene mußte sich die sonst ganz vortreffliche Inge K o n r a d i ab Julie wie eine versteinerte Statue geben. Josef M e i n r a d ist ein herrlicher, ein liebenswerter Schauspieler, aber er spielt nur den halben Liliom. Das Flui-dum der Unwiderstehlichkeit fehlt ihm völlig. Michael J a n i s c h als Fiscur war nur eindeutiger Verbrechertyp ohne den Zug dämonischer Komik. Susi Nico-I e 11 i als üppige Frau Muskat gefiel, aber wozu der ungarische Akzent? Lotte L e d 1 als Marie kicherte zuviel. Hans Moser mimte den grundgütigen Himmelskommissar. Die zahlreichen anderen Nebenfiguren gerieten, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, durchwegs annehmbar. Kurt Halleggers Bühnenbilder waren ungleichwertig: gemahnte das üppige Praterbild zu Beginn an ein Musical, so wirkte das Schlußbild mit dem Vorstadthäuschen doch recht dürftig. Manches andere aber hatte Stimmung. Die Musik von Alexander Steinbrecher hätte man sich manchmal zurückhaltender gewünscht. Alles in allem: Es hat gefallen, aber wieder warten wir auf den nächsten „Lfliom“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!