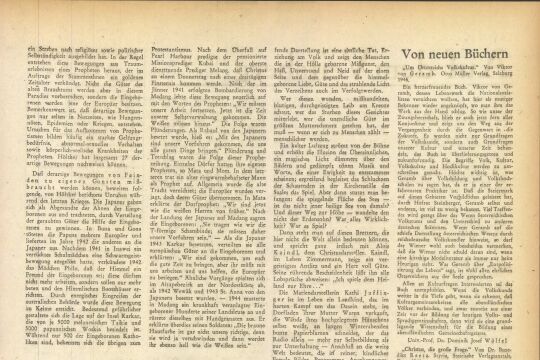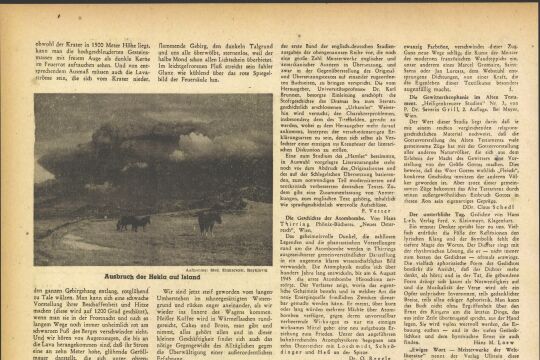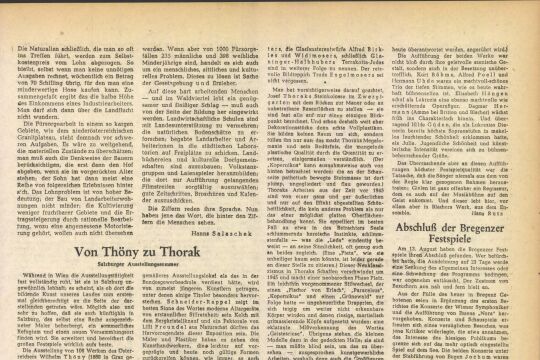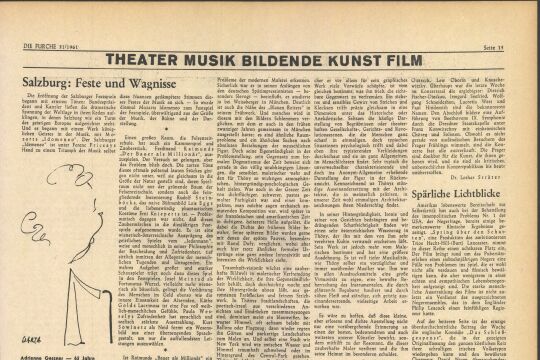Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Heile und heillose Welt
In „Elektra“, dem Alterswerk des Sophokles, geht es um den Ausgleich der Gerechtigkeit. Die Mutter und ihr Liebhaber werden umgebracht, weil sie ein uraltes Weltgesetz verletzt haben, das den Vater vor allem zu ehren gebietet. Aber nicht der Rächer Orest, der blind ist vor Jugend, blind vor Versuchung, und dessen Schuld ungeheuer ist — denn seine Mutter zu töten, gilt als die größte aller Schuld in der Welt des Mittelmeeres —, steht als Mann der Tat im Mittelpunkt der Tragödie, sondern Elektra, die äußerlich Passive. Sie, die Fromme, kennt, ausgeglüht von Haß und Leid, nur einen Lebensinhalt: Rache zu nehmen, zu sühnen. Auf dem Höhepunkt der Tragödie läßt sie langhinhallende Urlaute der Schmerzen, Klagen und Peinigungen vernehmen, von denen sie erst durch die fast kultisch vollzogene Bluttat befreit wird. Ein Mensch von hohem, innerem Adel steht in einer Zeit, die aus den Fugen ist, in einer durch die Untat der Ermordung des Vaters und die Schande der Mutter besudelten Welt, mit deren Zustand er sich als einziger nicht abzufinden vermag. Der zentrale Sinn des Sophokleischen Dramas — das in einer Präantike, man möchte fast sagen in einem Mittelalter der Antike spielt — ist das Aufzeigen von Frevel, Unordnung, Rache und Wiederherstellung der Ordnung. Elektras auswegloses, umfassendes Leid ist zur bewegenden dramatischen Mitte geworden. Frei von den niederen Abhängigkeiten, im Wissen und Wolles der höchsten Gebundenheiten, zeigt sich der Mensch zugleich als das unheimlichste und gewaltigste Lebewesen. Es ist diese Einsicht des griechischen Tragikers, die seine Gestalten über 2000 Jahre hinweg so gegenwärtig macht.
Welcher Stoffl Und welcher Kraft bedarf es, ihn zu bewältigen — auch in der szenischen Realisierung. Das Burgtheater holte sich für seinen antiken Zyklus auch diesmal wieder G. R. S e 11-n e r als Gastregisseur, der seine Inszenierung mehr als in früheren Jahren ganz auf das Wort und seine Expression in der von Rudolf Bayr geschaffenen Übersetzung stellte. Bei der Behandlung des Chors verzichtete Seilner auf alle äußeren Mittel, beispielsweise Masken, und suchte das sich stets neu stellende Problem dadurch zu lösen, daß er die choreographischen Bewegungen auf ein Mindestmaß beschränkte und den einheitlich grau getönten jungen Gesichtern jede Individualität nahm, wobei die hellen (wohl allzu hellen) Stimmes ;,ehsr jugendlksJtert'i.,GeÄhUM. nen Elektras zu gehören schienen als reflektierenden oder richtunggebenden Betrachtern und „Kommentatoren“.
Rudolf Bayr vermied in seiner Übersetzung jede pathetische Schönfärberei und humanistische Glättung und versuchte, die kantige Archaik des griechischen Originals möglichst getreu wiederzugeben, bei dem die tragische Unruhe allein das mit bewegender Kraft geladene Wort hervorbringt. Das ergibt für unsere im allgemeinen Nivellierungsprozeß bereits reichlich abgenutzte Sprache überraschend neue Wirkungen, verlangt aber ein besonders präzises, sinnvoll gegliedertes Sprechen — das im Chor wie bei den Hauptdarstellern doch manchmal zu wünschen übrigließ. Leidenschaft und Verzweiflung der Elektra fanden in Martha Wallner eine vorzügliche Interpretin, nur einige Male im sprachlichen Ausdruck wie in der Gestik übersteigert. Höhepunkt der Darstellung: die Urnenszene und das Wiedersehen mit Orest. Heidemarie Hatheyer fesselte (in einer höchst unvorteilhaften Kostümierung) als Klytai-mestra, Sonja Sutter blieb als Chry-sothemis, die freundlichere Schwester Elektras, reichlich farblos. Gut Achim B e n n i n g als Orest, Günther H a e n e 1 als Paidagogos und eindrucksvoll Heinrich Schweiger als Aigisthos. Wenig befreunden konnten wir uns diesmal m:t dem Bühnenbild Fritz Wotrubas. Sein Agamemnon-Palast in Mykenae schien einem Riesenbaukasten zu entstammen, ein abstraktes Gebilde, das weder etwas an- noch ausdeutete. Vielleicht lag es besonders auch an diesem Bühnenbild, daß man sich von dem pausenlos abrollenden Spiel am Ende doch nicht so gepackt und erschüttert fühlte.
Das Volkstheater spielt J. P. Sartres „Bei geschlossenen Türen“ (Huis clos) für die Außenbezirke. Dieses Abbild einer zivilisatorischen Hölle, irgendwo zwischen Diesseits und Jenseits schwebend, in der der einstige Journalist Garcin, die Lesbierin Ines und die junge Kindesmörderin Estelle zur Verdammnis in alle Ewigkeit vereint bleiben, ist eigentlich ein auf Abstraktion und Dialektik angelegtes Stück. Aber damit kann man dem Publikum is den Außenbezirken nicht kommen. Also hält man sich an den atemraubenden Reißer, der ebenfalls in dem Stück steckt, und vermeidet stellenweise nicht einmal grellen Naturalismus in der peinigenden Atmosphäre von Triebverfallenheit. (Dabei könnte — das war auch bei dieser lediglich auf äußeren Effekt bedachten Aufführung der Eindruck — dieses psychologischpräzise, philosophisch-logisch-anschauliche, dramaturgisch virtuos gebaute Kurzdrama einen hochgelagerten Ausgangspunkt für ein religiöses Gespräch bieten.)
Am besten war Traute W a ß 1 e r als 'aujnde, von perversem Haß erfüllte Ines, die im Leben nur eine Postangestellte war und das Format eiriis'Teufels hätte. Bei Helmi M a r e i c h als grausam seelenlose Estelle und Rudolf S t r o b 1 als Garcin, einer mehr innerlich als äußerlich schmutzigen Gestalt, hätte die Regie Hans R ü d g e r s manches mehr dämpfen können. Eduard Fuchs als Kellner gab einen jovialen Höllenhund im Frack.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!