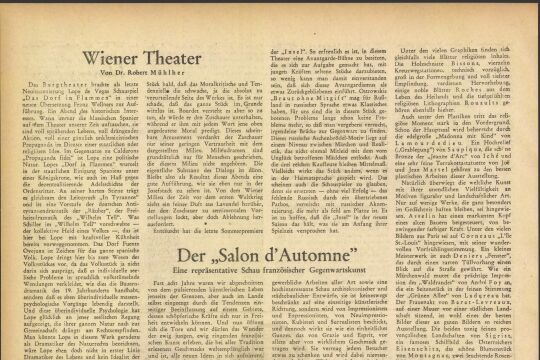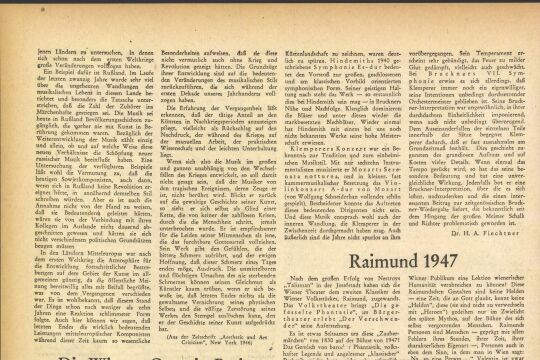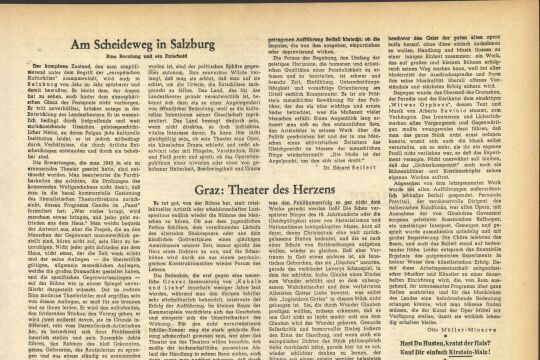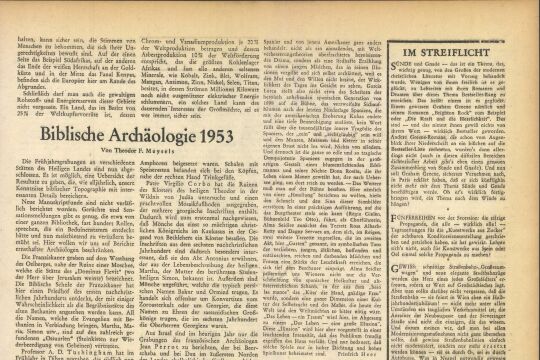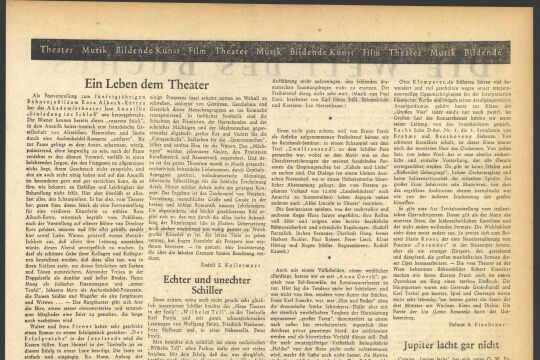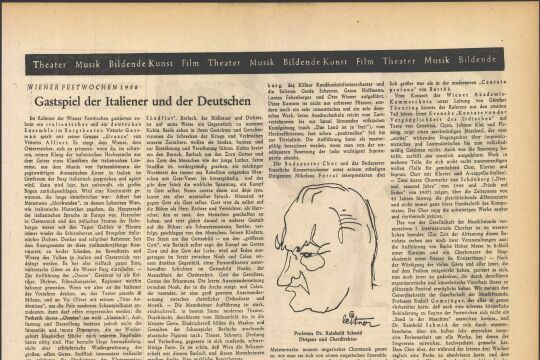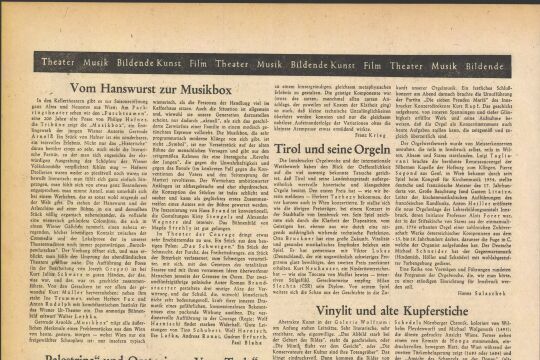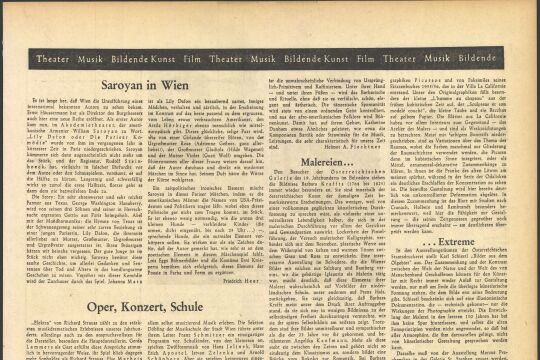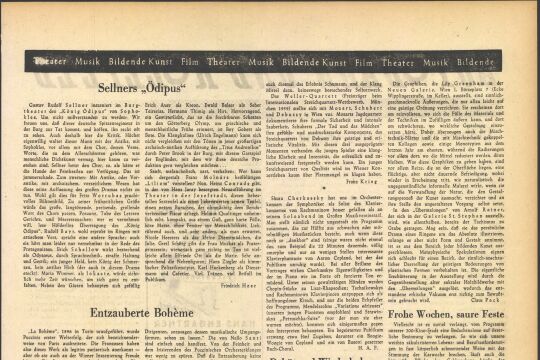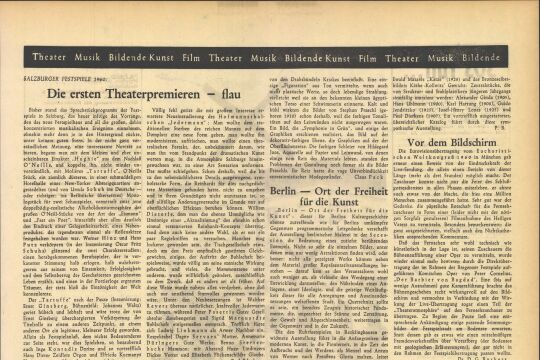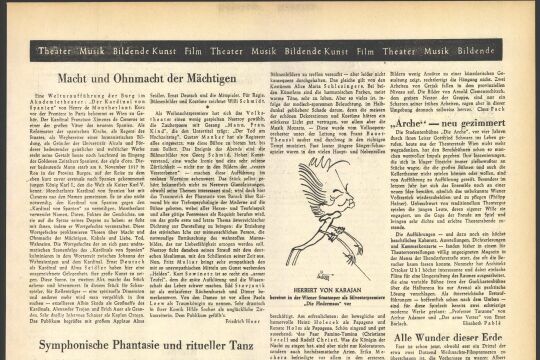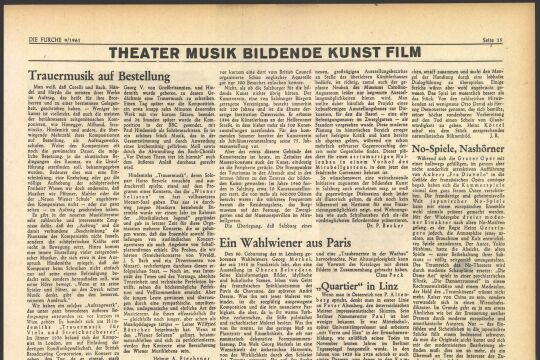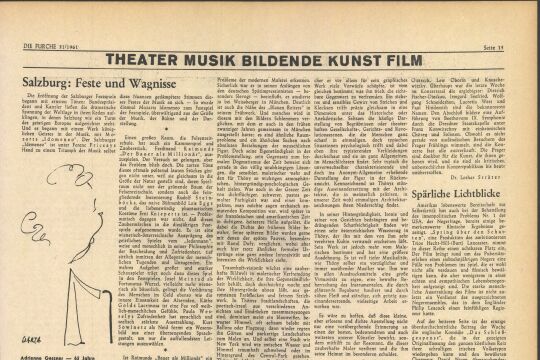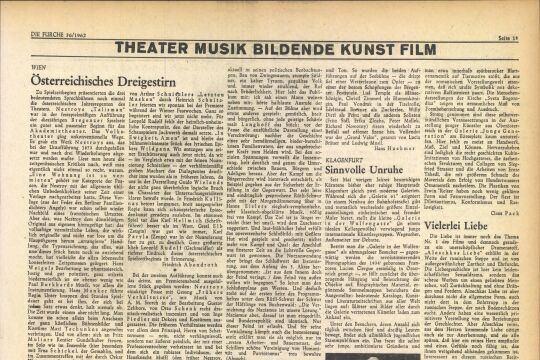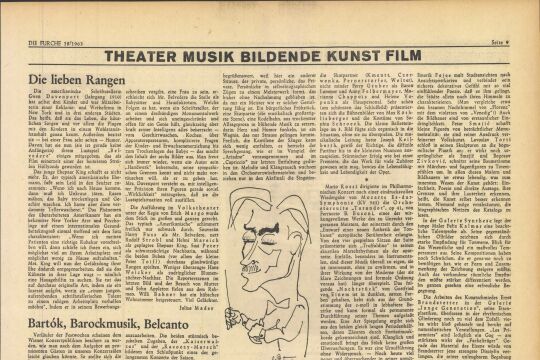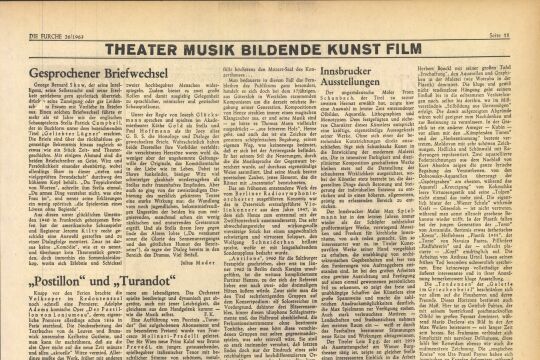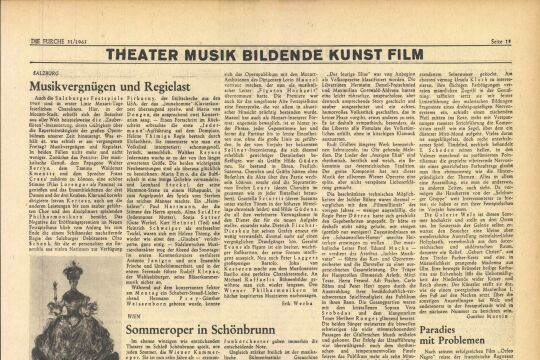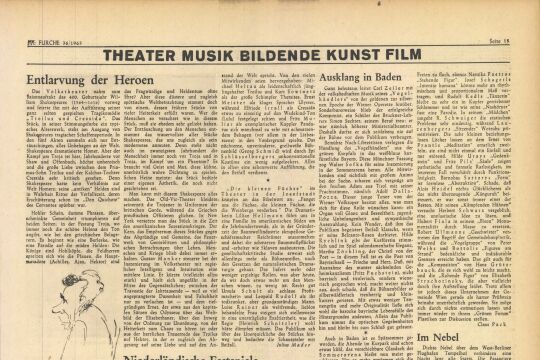Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nestroy und manche andere
An drei hintereinanderliegenden Theaterabenden dieser Festwoche drei N e s t r o y-Aufführungen, die jede in ihrer Art für einen der möglichen Interpretationsstile dieses von Jahr zu Jahr in neuen Facetten aufblitzenden Wiener Großmeisters repräsentativ waren. Drei Abende im Zenit des diesjährigen Festwochenmottos „Meisterwerke des Volkstheaters“.
„Früh-Nestroy“, da und dort sogar historischer „Vor-Nestroy“: das war die Aufführung des Pawlatschenthea-t e r s, die wir heuer vor dem Pötzleins-dorfer Schloß, natürlich nicht vor der „Verschwender“-Fassade, sondern stilgerecht vor dem Dienerschaftstrakt sahen. „Nagerl und Handschuh“ nennt der Dichter seine „neue Parodie eines schon oft parodierten Stoffes“. Aber das Original ist das Märchen vom Aschenbrödel, das ja als solches nicht zu parodieren ist. Das Hauptelement dieses überaus lustigen, sich stellenweise sogar überschlagenden Abends war daher auch nicht die Satire, sondern die breite und farbenfrohe Hanswurstiade, aus der ja das Wiener Volkstheater hervorgegangen ist. NestToy bei seinen WeigertenUfspf'üri-Sen noch in der Nähe 'de “älteren' Zeitgenossen, aber in der Zeichnung der' Figuren sie alle bereits weit überragend. Gandolf Buschbecks wieder einmal ungemein fingerspitzensichere Regie führte die köstlich aufeinander eingespielten Künstler seiner schon zusammengewachsenen Wandertruppe an der „langen Leine“. Er ließ sie kobolzen und outrieren nach Herzenslust, aber er ließ keinen auch nur sekundenlang aus dem Rollenprofil heraustreten. Susi Peter, den eigentlichen Pawlatschenstar, braucht man ebensowenig eigens zu loben wie Hilde S o-c h o r und Helly S e r v i. Man wartet ja schon jedes Jahr auf das Wiedersehen. Auch Harry Fuss und Oskar W e g r o-s t e k sind uns schon ganz vertraut. Die große, neue Überraschung des Abends: neben Alfred Böhm der Ur-Wiener „Kapitalist“ des Wolfgang Hebenstreith. Nestroy hätte seine Freude an ihm gehabt.
„Hoch-Nestroy“ in Reinkultur: „Die verhängnisvolle Faschingsnacht“ im Theater der J o s e f s t a d t. Dieses kaum viel später entstandene Stück des noch nicht einmal Vierzigjährigen ist ganz und gar seine Handschrift. Der rührstückschreibende „Volksfreund“ Holte!, den er parodierte, schüttelte den Kopf darüber, daß sich die „niederen Stände“ von ihm nicht zum Modell edler Figuren gebrauchen lassen wollten. Nestroy ist hier der Mann des plebejischen Protestes (der nichts mit Revolution zu tun hat), der die allzu harmonische Weltordnung verhöhnt, der sich auch die eigene Schlechtigkeit nicht abschwindeln läßt. Wenn Karl Paryla (Holzhacker Lorenz) sein „'s ist alles nicht wahr“ singt, dann wird dieser Ur-Nestroy in aller bedrohlichen Härte präsent. Daß sich Paryla diese Wirkung durch ein Zuviel an gestikulierendem Spiel manchmal selbst wieder wegnimmt, hängt mit seinem schauspielerischen Temperament zusammen, das auch ein so souveräner Regisseur wie Heinrich S c h n 11 z 1 e r nicht ganz zu zügeln vermochte. Alle anderen Akzente setzte er in seiner Inszenierung, für die Stefan Hlawa das richtige, die Biedermeierkulisse dezent andeutende Bühnenbild schuf, meisterhaft. Paul Hörbigers Tatelhuber „vom Lande“ bekam die biedere Klotzhaftigkeit. der die fahrige, neureiche Gschaftlhuberei der Schwiegertochter (Bibiana Zell er), die ganze Welt der werdenden Großstadt Wien sinnvoll entgegenstand. Der Schatz dieses Abends aber war Luzi Neudecker. Sie spielte die Magd Sepherl und brachte das Vollendete zuwege: eine Figur ganz und gar zu entwickeln mit aller Dienstmädchenpoesie und Sentimentalität und sie dann ganz, ganz zart selbst zu ironisieren. Hans W e i g e 1 s Bearbeitung war (bis auf einige kleine Schwankungen, etwa im zu ooerettenhaften Walzergesang der an sich bezaubernden Elfriede Ott) recht kompetent.
Auch „Das Mädl aus der Vorstadt“ ist kein Spätwerk Nestroys. Es wurde im nämlichen Theater an der Wien uraufgeführt, das sich das Burgtheater zu seiner Festwochenpräsentation aussuchte. Aber der Stil, den Leopold Lindtberg für diesen an schauspielerischer Vollendung die beiden anderen noch übertreffenden Abend gewählt hatte, war der einer biedermeierlichen Beschwingtheit, die kaum schwarze Farbtöne kannte. Kostüm und Bühnenbild (Fritz B u t z) führten eher zum Rokoko zurück als in den herben Vormärz hinein. Die Tendenz der (am Programm nicht genannten) Bearbeitung war auf liebenswürdige Gemütlichkeit gerichtet, Adolf Müllers Musik hatte Alexander Steinbrecher fast zu stimmungsselig bearbeitet. Findet man sich mit dieser von Lindtberg in gewohnter Souveränität bis ins Detail durchgehaltenen Auffassung ab, dann freilich war jeder Darsteller eine Erfüllung. Josef M e i n r a d, der schwerenöterische, weltschmerzliche Schnoferl (nicht die Vorstadtfigur), Richard E y b-n e r, der ganz köstliche Backhendlfriedhof (nicht der kriminelle Spekulant), Susi N i c o 1 e 11 i, die „grande dame“ (nicht die neureiche Kornhändlerswitwe). Möglich, daß man auch das alles aus dem vielschichtigen Werk Nestroys herauslesen kann.
Eindeutig übernommen hat sich diesmal das Volkstheater mit dem literarisch an sich berechtigten Versuch, neben Nestroy auch das humorige Werk des anderen Jubilars — Gerhart Hauptmann — zum Leben zu bringen. „Schluck und Jau“ lebt von den Hauptfiguren der beiden Landstreicher und dem Königstraum für einen Tag, den der eine von ihnen durchmißt. Hier ist jene schlesische Poesie zu Hause, die dann aufleuchtet, wenn Schluck (von Kurt S o w i n e t z intuitiv richtig erfaßt) das Wort „kinstlich“ spricht oder wenn Jau (elementar bewältigt von Jochen Brockmann) beim Liedchen der Prinzessin verstohlen weint, um sich gleich darnach wieder der Tafel zuzuwenden. Aber dazu gehört eben auch noch das neuromantische Gespinst der spätritterlichen Märchenhandlung des Rahmens, etwas dünn, und daher besonders behutsam zu behandeln.
Und da versagte Georg Lhotzkys vielleicht zu angestrengte und stürmische Regie leider ganz. Die Schauspieler des Volkstheaters können manches, aber das können sie eben nicht.
Wie man heute humorig ist, wollen uns die Herren B a r a s c h und Moore samt ihrem ungenannt gebliebenen wienerischen Bearbeiter mit der Geschichte „Der selige Herr Leidenfrost“ plausibel machen. Auf die geschmacklose Geschichte wäre gut und gern zu verzichten. Nicht aber auf die von Edwin Z b o-n e k inszenierte Vorstellung in den Kammerspielen. Wenn das halt der Waldbrunn spielt und der besonders nett profilierende Hans Unterkirchner und der lebensechte Emil F e 1 d m a r und die souveräne Marte H a r e 11... dann schweigt des Kritikers Unhöflichkeit.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!