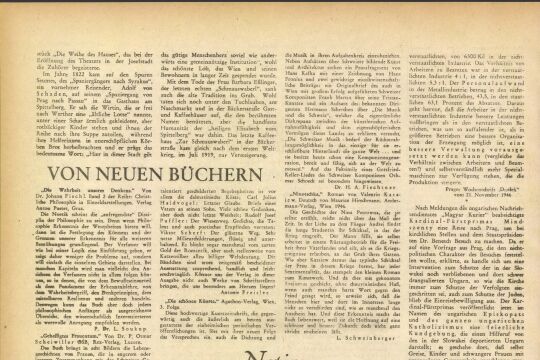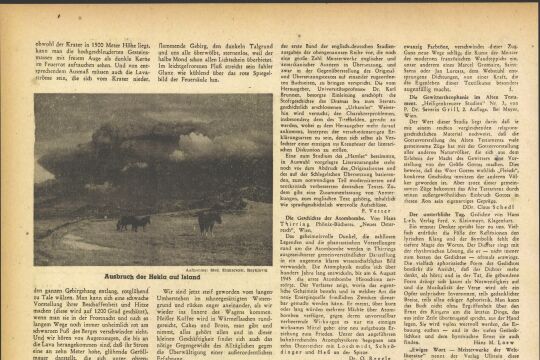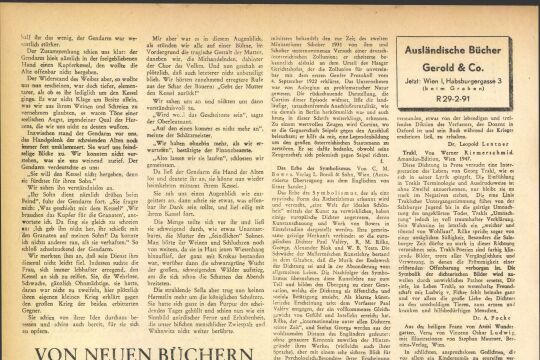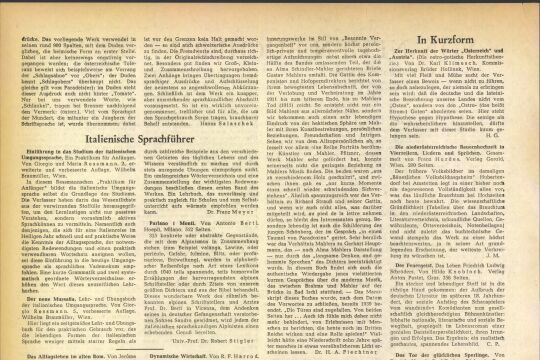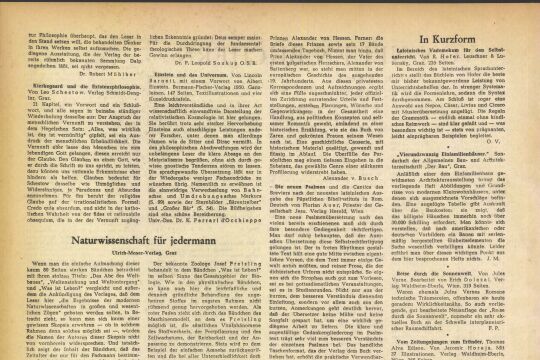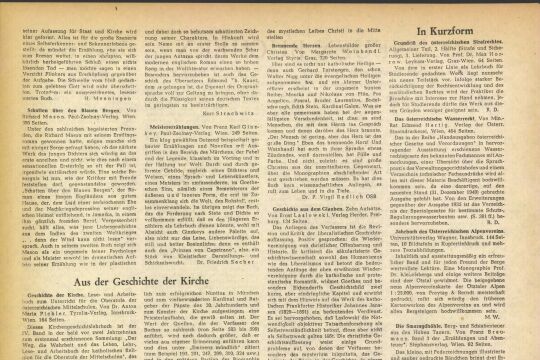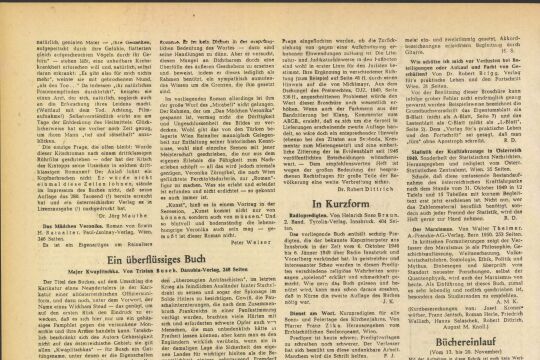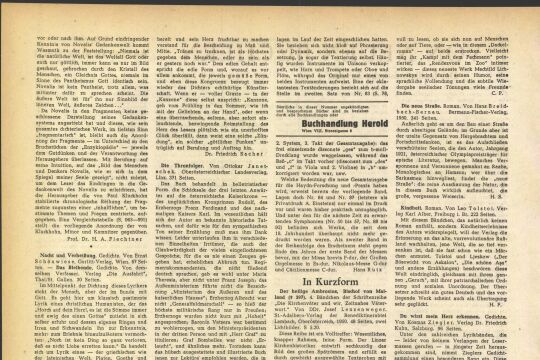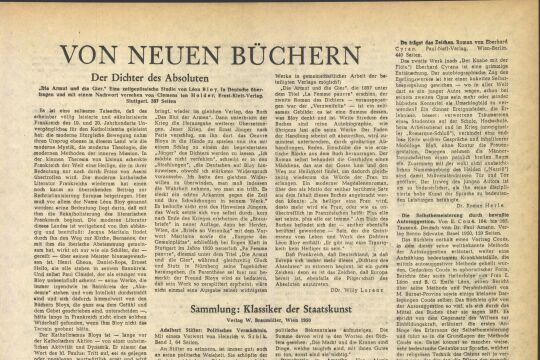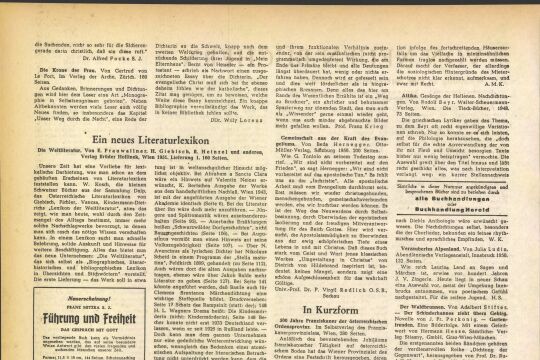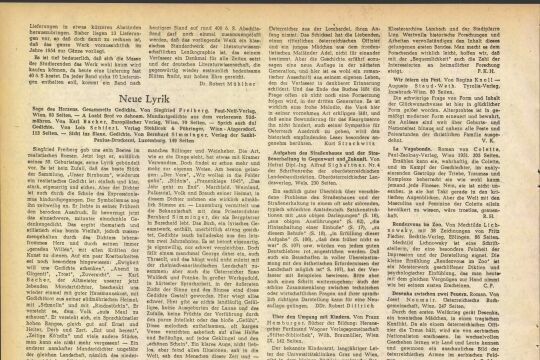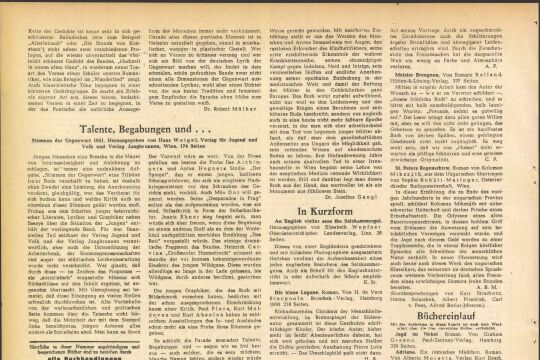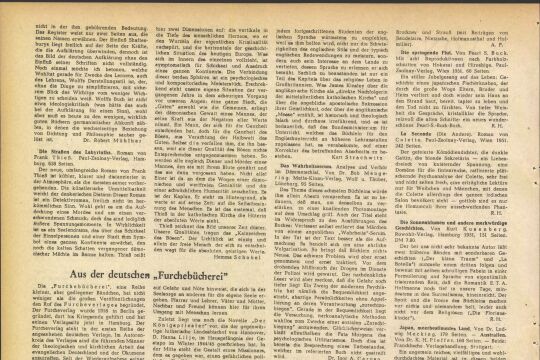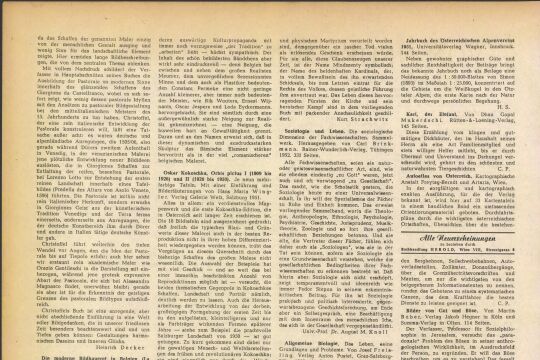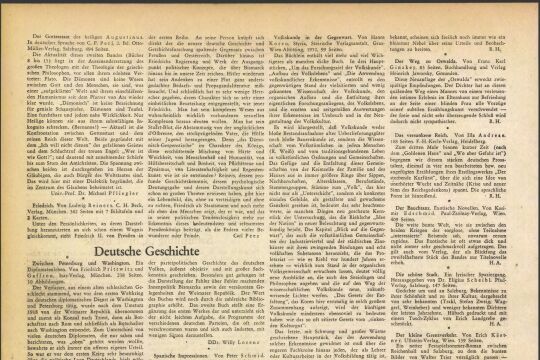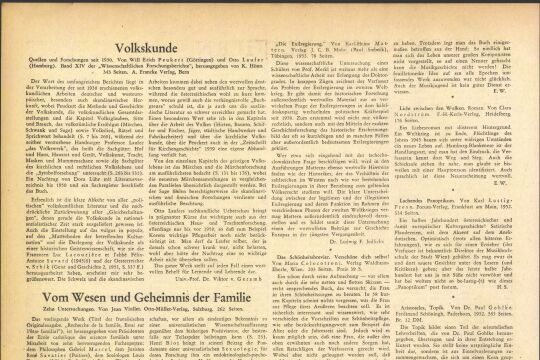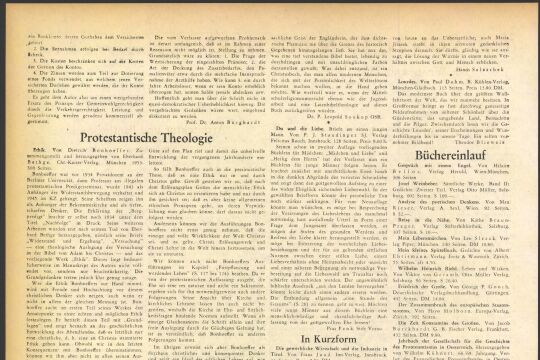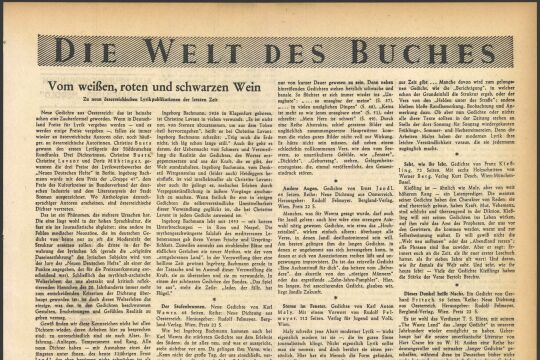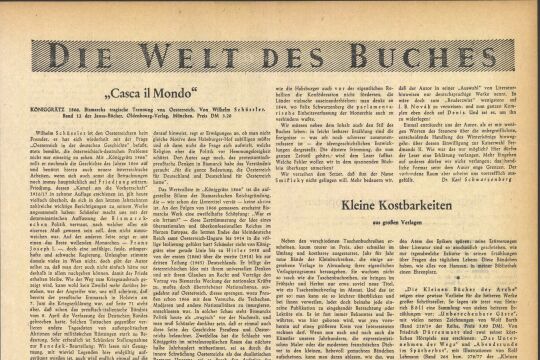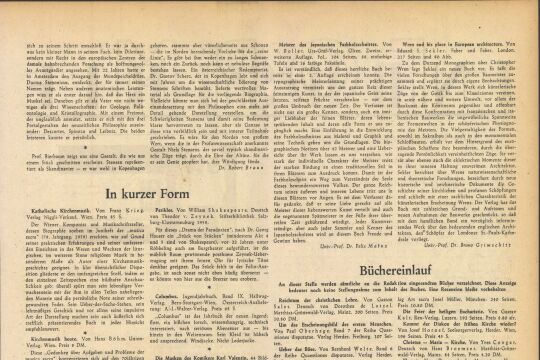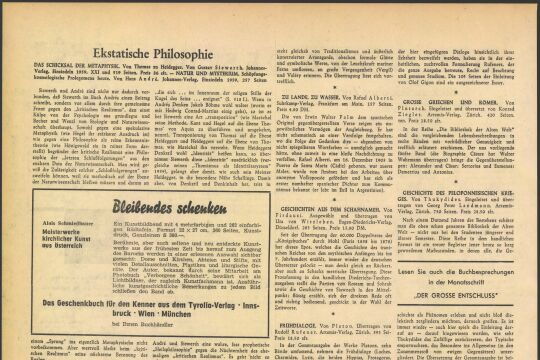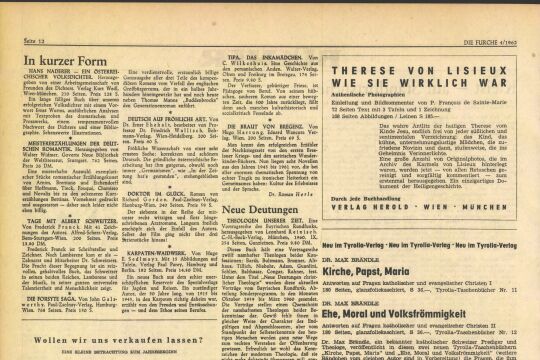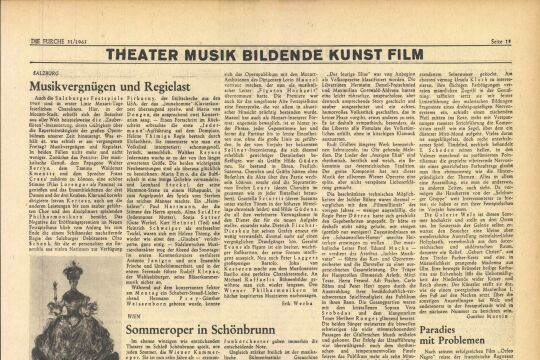Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Neue Lyrik aus osterreich
Die wichtigste Lyrikpublikation des Jahres 1955, das wir nun ganz überblicken können, ist sicher das dritte Gedichtbändchen von Christine Biiiti, „Lampe und Delphin“, das in der so ansprechend ausgestatteten Reihe „Neue Lyrik“ des O 11 o - M ü 11 e r - V e r I a g e s, Salzburg, erschienen ist. An Christine Bustas Gedichten bewundern wir immer wieder die Einfachheit der Aussage und die enge Verschlingung jahreszeitlicher Geschehnisse mit Leben und Lieben des Menschen. Hier wird der Mensch wieder ganz hineingenommen in eine heilende Schöpfung, in der alle Wesen nahe dem Ursprung und miteinander ausgesöhnt leben. Wer so nahe dem Ursprung lebt, der hat die einfachen, gültigen Zeichen gefunden, die für die Welt stehen könnten: die Lampe in den Katakomben, die das Licht bewahrt, das von ihr immer wieder neuen Ausgang nimmt, und den fruchtbringenden Delphin, das alte mythische Fischsymbol. Der Ton der Gedichte ist melancholisch, aber nie verzweifelt; immer spüren wir in ihnen ein „Tasten nach Zeichen“, die inmitten des ewigen Wechsels in der Natur das erhaltende, bewahrende Element darstellen: „Was du erkennst, ist erkannt als magisches Zeichen, deutlicher nur als Gefahr, in Strenge und Schönheit gesetzt.“
Ebenfalls in dieser Reihe ist Hermann L i e n-h a r d s Bändchen „Das S p i e g e 1 h a u s“ (Otto-Müller-Verlag, 195 5, 120 Seiten, Preis 29 S) erschienen. Viele seiner Gedichte sind Fragmente. Aber sie sind es bewußt und wollen nicht mehr sein. So sind sie ehrlich und bieten keine falschen, allzu frühen Lösungen. Insbesondere die Verse, die eine Reiseimpression wiedergeben oder aus unmittelbarer Erfahrung zu stammen scheinen, haben den Charakter der Skizze. Es sind Gedichte des Aufbruchs. Lienhard ist unterwegs. „Dies ist mein Schiff“, heißt der erste der vier Abschnitte des Bandes, und es wäre glücklicher gewesen, das ganze Bändchen so zu benennen. Denn das Bild des Schiffes, das auf hoher See ist, kehrt immer wieder, vom „schiffbrüchigen Herz“ bis zum „Schiffsbauch Europas“. Am Acheron beginnt die Fahrt, Harlem, Husum, Venedig, Schanghai sind seine Stationen. Manches echte Seefahrerlied des Geistes, meerweit und welthältig, gelingt dabei. Ein Aufenthalt in Paris hat die stärksten Spuren hinterlassen. Die geschlossensten Verse aber hat Lienhard, der Organist in seiner Geburtsstadt St. Veit an der Glan ist, dem Umgang mit der Musik abgewonnen: was sonst noch bruchstückhaft erscheint, ist hier schon Gebild und Sprache geworden.
Ein drittes Bändchen aus dem Otto-Müller-Verlag, ebenfalls in dem schmucken, biegsamen Plastikeinband, haben wir noch zu besprechen: „Die F e u e r 1 i 1 i e“ von Maria Zittrauer. Es enthält einfache, anspruchslose Lieder, Das liedhaft-naturverbundene Element dieser bescheiden auftretenden Verse, die nicht große Literatur sein wollen, werden allen, die Einkehr bei Gedichten suchen und bei ihnen rasten wollen, etwas geben können. Die heute über 40 Jahre alte Dichterin ist als Wirtin eines Landgasthauses in der Nabe von Badgastein tätig. Es ist gut bei ihr einkehren ... (Preis 29 S).
„Ahnung und Gestalt“ heißt ein Salzburger Almanach, der die Lyrik der Georg-Trakl-Pieisträger sammelt und vorstellt (Otto-Müller-Verlag, Salzburg, 104 Seiten.) An Hand dieses Bändchens, das jeweils drei bis acht Gedichte von 14 der 15 bisherigen Georg-Trakl-Preisträger bringt, kann man die Entscheidung der Jury überprüfen. Und man wird ihr recht geben: die Preiswürdigkeit der vier in erster Linie ausgezeichneten Dichter, Christine B u s t a und Christine L a v a n t, Michael Guttenbrunner und Wilhelm Szabo, erweist sich in jedem einzelnen ihrer Gedichte aufs neue. Mit der Auswahl der sieben durch Ehrengaben anerkannten Dichter freilich können wir nicht recht übereinstimmen; sie reicht von dem phänomenalen Talent Andreas Ökopenko bis zur herzlich schwachen Edith S i e g 1 (von der, als Ausnahme, auch nur ein einziges Gedicht Aufnahme fand). Dazwischen liegen so reizvolle Verse wie die eines Herbert Zand und manches Unbedeutende. Ergänzt werden diese Gedichte durch die Lyrik der Trakl-Preisträger des Jahres 1952, so daß der hübsch ausgestattete Almanach jetzt von Gerhard Amanshauser bis zu Maria Z i 11-rauer reicht und somit in Salzburg Heimatrecht gewonnen hat.
„Schalmei des Einsamen“ heißt ein Band Gedichte, den Ekkehard Röhrer 1955 im Europäischen Verlag, Wien, zum Druck befördert hat (45 Seiten). Er ist Maria Zittrauer gewidmet und zerfällt in zwei Teile. Sonst läßt sich über diese gutgemeinten Reime nicht viel sagen.
Ernst J i r g a 1 hat in den letzten Jahren zwei Lyrikbändchen publiziert: zunächst die „Etüden“ in der O e s t e r r e i c h i s c h e n Verlagsanstalt, Innsbruck (45 Seiten), dann „Schlichte Kreise“ in der neuen, von Rudolf F e 1 m a y e r betreuten Reihe „Neue Dichtung aus Oesterreich“, die im Bergland-Verlag, Wien, erscheint (1955, 65 Seiten, Preis 22 S).
Etüden sind Fingerübungen — so will Jirgal die Verse des erstgenannten Bandes auch verstanden wissen: als Fingerübungen eines Schriftstellers, der sich auf neue, größere Aufgaben vorbereitet; neben den eigentlichen Etüden umfaßt das Bändchen: „Totenheere“, „Klage um Andre Gide“; „Catalani-sches Fragment“ und die Gedanken über das „Pferd“. Jirgal ist in der modernen Lyrik, wie sie heute in Frankreich und im englischsprachigen Bereich geschrieben wird, zu Hause. Zuweilen hat man den Eindruck, er sei zu gut in ihr zu Hause und bemühe sich nun, einerseits die Forderungen dieser Lyrik zu verwirklichen, anderseits aber das schon Geleistete nicht nachzuahmen oder zu wiederholen. Das, was er in den „Etüden“ anstrebte, hat Jirgal in der zweiten Publikation, den „Schlichten Kreisen“, zum Teil schon verwirklicht: seine Verse sind freier, gelöster geworden und weniger geschraubt. Besonders sein Gedicht in Prosa „Lob der Provence“ haben wir schätzen gelernt; zwischen Bildungslyrik und Impressionen gelingen ihm immer wieder einige gültige Verse, die ihm einen eigenen Platz in der österreichischen Lyrik der Gegenwart anweisen.
*Der Donau-Verlag, Wien-München, hat In diesem Herbst seine Lyrikreihe um zwei Neuerscheinungen vermehrt: einmal um „Hinter der Erde“ von Harald Z u s a n e k, in dem sich der bekannte junge Dramatiker als Lyriker vorstellt und zugleich bestätigt, daß er doch in erster Linie eben Dramatiker ist; und dann um „Netze im Meer“ von Daniel B r i e r (beide Bändchen je 72 Seiten). Auch Daniel Brier ist nicht wesensmäßig Lyriker: er war mit Leib und Seele Rundfunkmann, Leiter des Radioparlaments, Hörspielregisseur, Verfasser geistreicher Glossen zur Woche; viel zu früh hat ein heimtückisches Leiden den 36jährigen im vorigen Februar hinweggerafft. Seine Gedichte haben essayistischen Charakter, den weiten Atem, die Kühnheit und Unbekümmertheit einer starken und eigenwilligen Persönlichkeit. Sie sind gescheit, unkonventionell und enthalten Welt. Manche mögen dilettantisch sein, genialisch danebengelungen. Manche aber haben die Ueberzeugungskraft echter visionärer Schau, wie etwa das „Protokoll“. Alle Gedichte jedoch lassen die Größe des Menschen Brier ahnen, dessen Zauber sich niemand, der ihn gekannt' oder seine Stimme über den Aether vernommen hat, entziehen konnte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!