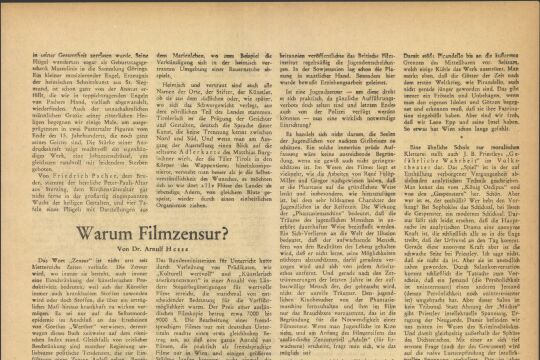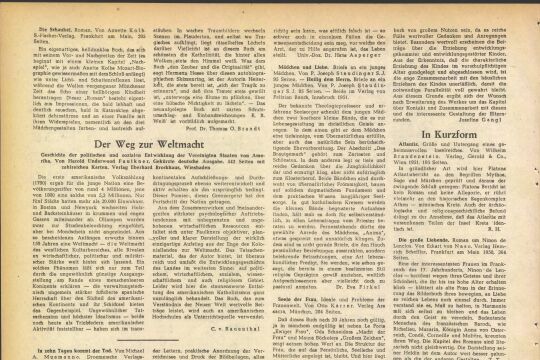Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Reisen nach Nirgendwo…
Merkwürdig ist das in diesem Herbst. Es scheint, als hätten sich die Wiener Bühnen zu einer Art Ausflugsprogramm aus der Gegenwart (die natürlich nicht mit deren naturalistischem Abziehbild verwechselt werden darf) abgesprochen. Gleich drei Stücke in einer Woche, die uns in Traumländer entführten, ohne mehr als die Andeutung eines Weges zurück zu geben. Am dichterischsten — sofern man dieses Wort steigern kann — tut dies ohne Zweifel Georges S c h e h a d ė. „Die Reise“, die dieser hintergründig-stille Libanonfranzose arrangiert, führt zunächst einmal in ein viktorianisches Traumengland, zu dessen Salzluft er als Nachfahr der Phönizier eine geheime Affinität besitzen muß. Im Bristol von 1850, einer Dickens-Landschaft also, begegnen wir dem jungen Mann mit dem Symbolnamen Christophen der einer liebenswürdigen Idylle durch ein Seefahrerabenteuer zu entfliehen versucht Diese zunächst nur im Wachtraum vollzogene Reise konfrontieit ihn mit der Fragwürdigkeit seines unreifen Wunschbildes. Er kehrt in die Realität des Knopfhändlerdaseins zurück. Dem „schwarzen Mann“, der ihn nun wirklich zur Ausfahrt holen will, erteilt er eine gepreßte Absage. Es läge nahe, sich hier an Rustan und Zanga zu erinnern. Aber „Traum und Leben“ sind nicht so scharf geschieden wie bei Grillparzer. Schehade schafft, eigener, ein wenig koketter Aussage zufolge, ganz ohne Programm, ohne Symbolbedeutung. Und doch glauben wir, den Sinn des Stückes vom Gang der Handlung her interpretieren zu können: die Verlockung zum „Ozeanischen“ wird als die eigentliche Unreife empfunden, der Ausbruch ins Abenteuer als chaotische Versuchung der Lebensschwachen und Gescheiterten. Erst das Zurückfinden in die kleine Alltagsrealität, die durch einen freundlich heilenden Priester vollzogene Objektbesetzung eines vagen Traums ‘eitet die Reife ein. Keine Resignation steht am Ende, sondern frühe, heitere Erkenntnis: Die Kleinen und Stillen sind mehr als die Großen und Hohlen.
Das alles hätte man vielleicht viel müheloser aus der Stückbegegnung selbst herauslesen können, wenn die Inszenierung besser gewesen wäre. So enttäuschte Axel C o r t i s szenische Wiedergabe am Akademietheater in vielen Punkten. Der traumhafte Andeutungscharakter aller, auch der nur scheinbar realistischen Vorgänge fehlte. Man spielte breites Genretheater, handfest-vordergründig und dadurch strek- kenweise lähmend langweilig. Die Umbaulösung zum Ende war deprimierend einfallslos. So reizvoll verspielt lörg Zimmermanns Bühnenbild auch war, die dramaturgische Logik fehlte ihm. Kein Mensch wußte, wer in dem Handelskontor des Mr. Strawberry nun eigentlich das „Beiseitereden“ hören sollte und wer nicht. Ganz prächtig und wahrscheinlich dem Stil des Stückes am besten entsprechend der Christopher des Ernst Anders, losef Meinrads Individualitätsstärke verpflanzte mit sicherem Temperament auch den englischen Kaufmann ins Raimundsche Wien. Albin Skoda spielte die Alptraumgestalt eines degradierten Admirals, der einem Kafkaschen Gericht vorsitzt. Eine Wohltat, die lyrischen Einblendungstexte von dieser wohl vollendetsten Stimme des heutigen Wiener Sprechtheaters zu hören …
Ein Traumland von zuckriger Biederkeit und süßer Langeweile auch das Vorkriegs- Kleinbürgermilieu, in dem John van D r u t e n seine Fortsetzungsgeschichte „So war Mama“ angesiedelt hat. Solche Sachen sind eben nur noch an der lose f- Stadt erträglich. Edwin Zbonek gruppierte die lebenden Bilder in den ungemein geistreichen Interieurs von Lorenz Withalm 60, daß man sich bei jedem neuen Aufblenden ein Weilchen an ihnen freuen konnte. Wollte man dann gähnen, war es schon wieder vorbei und das nächste
„Black out“ kam dran. Daß Susi Nico- letti einen Mittelpunkt jedes Ensembles bildet, auch wenn sie kein Wort sagt, braucht man kaum zu wiederholen. Eine bemerkenswerte Partnerin fand sie in Luzi Neudecker (Tochter Katrin), deren jüngere Schwester (Gertraud Jesserer) ihr an sehr persönlicher Meisterung einer Schablonenrolle nicht nachstand. Jochen Brockmann (Onkel Chris) ist nahe an der Gefährdung durch kraftmeierische Manier. Aber Beifall gab es natürlich in starkem Maß.
A n o u i l h s Traumwelt wird in ihrem ironischen Charakter dann am besten sichtbar, wenn man seine Stücke unter Verzicht auf ernst zu nehmende Direktheit von vornherein stilisiert und „verfremdet“. Dies scheint auch die richtige Grundidee des Regisseurs und Bühnenbildners Veit R e 1 i n gewesen zu sein, als er die mit der sentimentalen Illusion spielende Komödie „L e o- k a d i a“ zur Eröffnung der neuen Spielzeit seines „Ateliers“ auswählte. Nur mit der Verwirklichung haperte es etwas, bei der noch sehr jungen „Wunschmaid“ der Erika Kronowetter, aber auch bei seiner eigenen Prinzendarstellung, der die Regiezucht fehlte. Das, was diese Inszenierung wollte, verkörperte nur eine Schauspielerin in ganz vorzüglicher Weise: Susanne Engelhart, die Herzogin-Tante. Ein kleines Kabinettstück.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!